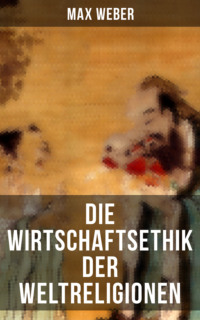Kitabı oku: «Die Wirtschaftsethik der Weltreligionen», sayfa 18
Für die Anhänglichkeit von Kreisen der Kaufmannschaft an den Taoismus war, sahen wir, ausschlaggebend: daß ihr Spezialgott des Reichtums, also der Be rufsgott der Kaufmannschaft, ein von taoistischer Seite gepflegter Gott war. Der Taoismus hat ja eine ganze Anzahl von solchen Spezialgöttern zu Ehren gebracht. So den als Kriegsgott kanonisierten Heros der kaiserlichen Truppen, Studentengötter, Götter der Gelehrsamkeit und vor allem auch: der Langlebigkeit. Denn hierin lag eben, wie in den eleusinischen Mysterien, auch beim Taoismus der Schwerpunkt: in den Verheißungen von Gesundheit, Reichtum und glücklichem Leben im Diesseits und Jenseits. Die Lehre von den Handlungen und Vergeltungen stellt für alle Handlungen Belohnungen und Strafen durch die Geister in Aussicht, sei es im Diesseits, sei es im Jenseits, sei es an dem Täter selbst, sei es – im Gegensatz zur Seelenwanderungslehre – an seinen Nachkommen. Die Jenseitsversprechungen insbesondere zogen ein großes Publikum an. Da die Lehre, daß das »richtige Leben« des einzelnen für sein Verhalten, das des Fürsten für das Schicksal des Reichs und die kosmische Ordnung entscheidend sei, den Taoisten ebenso selbstverständlich war wie den Konfuzianern, so mußte auch der Taoismus ethische Anforderungen stellen. Aber diese unsystematischen Ansätze zu einer Verknüpfung des Jenseitsschicksals mit einer Ethik blieben ohne Folge. Die nackte Magie, von der konfuzianischen Bildungsschicht nie ernstlich bekämpft, überwucherte immer wieder alles. Eben infolgedessen hat sich die taoistische Lehre in der geschilderten Art zunehmend zu einer sakramentalen Therapie, Alchimie, Makrobiotik und Unsterblichkeitstechnik entwickelt. Der Urheber der Bücherverbrennung, der Feind der Literaten ist durch die Unsterblichkeitstränke der Taoisten mit ihnen zusammengeführt worden. Seine Expedition nach den Inseln der Unsterblichen im Ostmeer wird in den Annalen verzeichnet. Andere Herrscher mehr durch ihre Versuche, Gold zu machen. Innerhalb der für die Lebensführung der Gebildeten maßgebenden Schicht des literarisch geschulten Beamtentums blieb die ursprüngliche Lehre Laotses in ihrem Sinne unverstanden und in ihren Konsequenzen schroff abgelehnt, die Magie der seinen Namen führenden Priester aber wurde mit duldsamer Verachtung als geeignete Kost für die Massen behandelt.
Darüber, daß der Taoismus sowohl in seiner hierarchischen Organisation, wie seiner Pantheonbildung (namentlich: der Trias der höchsten Götter), wie in seinen Kultformen, wenn nicht alles, so doch vieles, erst dem Buddhismus nachgeahmt hat, herrscht im allgemeinen unter den Sinologen kein Zweifel, wenn auch der Grad der Abhängigkeit bestritten ist.
In seinen Wirkungen war der Taoismus noch wesentlich traditionalistischer als der orthodoxe Konfuzianismus. Dies ist von einer durchaus magisch orientierten Heilstechnik, deren Zauberer ja an der Erhaltung der Tradition und vor allem der überlieferten Deisidaimonie direkt mit ihrer ganzen ökonomischen Existenz interessiert waren, nicht anders zu erwarten. Und es nimmt daher nicht wunder, dem Taoismus die ausdrückliche Formulierung des Grundsatzes: »führe keine Neuerungen ein«, zugeschrieben zu finden. In jedem Falle führte von hier nicht nur kein Weg zu einer rationalen – sei es inner- oder außerweltlichen – Lebensmethodik, sondern die taoistische Magie mußte eines der ernstlichsten Hindernisse für die Entstehung einer solchen werden. Die eigentlich ethischen Gebote waren im späteren Taoismus – für die Laien – materiell wesentlich die gleichen, wie im Konfuzianismus. Nur daß der Taoist von ihrer Erfüllung persönliche Vorteile, der Konfuzianer mehr das gute Gewissen des Gentleman erwartete. Der Konfuzianer operierte mehr mit dem Gegensatz: »recht« – »unrecht«, der Taoist, wie jeder Magier, mehr mit »rein« – »unrein«. Trotz seines Interesses für Unsterblichkeit und jenseitige Strafen und Belohnungen blieb er innerweltlich orientiert wie der Konfuzianer. Der Gründer der taoistischen Hierarchie soll sich das, die Aeußerung des Achilleus in der Unterwelt noch überbietende Wort des Philosophen Tschuang-Tse ausdrücklich angeeignet haben: daß »die Schildkröte lieber lebend den Schwanz durch den Kot schleifen als tot in einem Tempel verehrt werden wolle«.
Nachdrücklich ist daran zu erinnern, daß die Magie auch im orthodoxen Konfuzianismus ihren anerkannten Platz behalten hat und ihre traditionalistischen Wirkungen übte. Wenn, wie erwähnt, noch im Jahre 1883 ein Zensor dagegen protestierte, daß die Deicharbeiten am Hoangho nach moderner Technik, also anders als in den Klassikern vorgesehen, vorgenommen würden, so war dabei zweifellos die Befürchtung vor Beunruhigung der Geister ausschlaggebend. Nur die bei den volkstümlichen Magiern vorkommende emotionale und die bei den Taoisten heimische apathische Ekstase, überhaupt alle in diesem psychologischen Sinn »irrationale« Magie und jede Form von Mönchsaskese lehnte der Konfuzianismus durchaus ab.
Hinlänglich starke Motive für eine religiös orientierte, etwa puritanische, Lebensmethodik des einzelnen konnte die chinesische Religiosität also weder in ihrer offiziellen staatskultischen noch in ihrer taoistischen Wendung aus sich heraussetzen. Es fehlte bei beiden Formen jede Spur einer satanischen Macht des Bösen, mit welcher der im chinesischen Sinn fromme Mensch – er sei orthodox oder heterodox – um sein Heil zu ringen hätte. Die genuin konfuzianische Lebensweisheit war »bürgerlich« im Sinne des optimistischen aufgeklärten Beamtenrationalismus mit seinem, jeder Aufklärung leicht beigemengten, supersti tiösen Einschlag. »Ständisch« aber war sie als eine Moral des literarischen Intellektuellentums: Bildungsstolz war ihre spezifische Note.
Selbst dem denkbar grenzenlosesten utilitarischen Optimismus und Konventionalismus konnte jedoch die Tatsache nicht entgehen: daß diese beste der möglichen sozialen Ordnungen, innerhalb deren Unglück und Unrecht nur die Folge von Unbildung des einzelnen oder charismatischer Unzulänglichkeit der Regierung – oder, nach taoistischer Lehre, von magisch relevanten Verfehlungen – sein sollten, angesichts der tatsächlichen Verteilung der Glücksgüter und der Unberechenbarkeit des Lebensschicksals doch oft auch mäßigen Ansprüchen nicht genügte. Das ewige Problem der Theodizee mußte auch hier entstehen. Und wenigstens dem Konfuzianer stand ein Jenseits oder eine Seelenwanderung nicht zur Verfügung. Infolgedessen findet sich in leisen Spuren innerhalb der klassischen Schriften die Andeutung einer Art von esoterischen Prädestinationsglaubens. Die Vorstellung hatte einen etwas zwiespältigen Sinn, ganz entsprechend dem Charakter der chinesischen Bureaukratie als einer dem Wesen nach dem Kriegsheldentum fernstehenden, ebenso aber auch ständisch von allem rein Bürgerlichen geschiedenen Literatenschicht. Die Konzeption einer Vorsehung fehlte dem Volksglauben, scheint es, gänzlich. Dagegen entwickelte er deutliche Ansätze eines astrologischen Glaubens an die Herrschaft der Gestirne über das Schicksal des einzelnen. Der Esoterik des Konfuzianismus – soweit man von einer solchen sprechen kann – scheint der Vorsehungsglaube nicht schlechthin fremd. Aber – namentlich bei Mencius zeigt sich das – die Vorsehung bezog sich im allgemeinen nicht auf das konkrete Schicksal des einzelnen Menschen, sondern nur auf die Harmonie und den Verlauf der Schicksale der sozialen Gesamtheit als solcher, ganz wie bei allen urwüchsigen Gemeinschaftskulten. Andererseits aber war auch die jedem rein menschlichen Heldentum – welches den Glauben an eine gütige Vorsehung überall stolz abgelehnt hat – spezifische Auffassung der Vorherbestimmung als eines irrationalen Verhängnisses im Sinne etwa der hellenischen »Moira«, einer unpersönlichen Schicksalsmacht also, welche die großen Peripetien im Leben des einzelnen bestimmt, im Konfuzianismus nicht wirklich durchgeführt. Sondern beides stand nebeneinander. Seine eigene Mission und was sie beeinflußte, sah Konfuzius offenbar als positiv providentiell geordnet an. Daneben findet sich nun der Glaube an die irrationale Moira. Und zwar in sehr charakteristischer Wendung. Nur der »höhere Mensch«, so heißt es, weiß überhaupt vom Schicksal. Und ohne Schicksalsglauben, wird hinzugefügt, kann man kein vornehmer Mensch sein. Der Glaube an eine Vorherbestimmung diente also hier, wie auch sonst, dazu, diejenige Art von stoischem Heldentum, welche dem literarischen Intellektualismus allein zugänglich ist: die »Bereitschaft«, etwa im Sinne Montaignes, zu unterbauen, um mit Gleichmut das Unabänderliche hinzunehmen und eben darin die Gesinnung des vornehm gebildeten Kavaliers zu bewähren. Der gemeine Mann jagt, schicksalsfremd oder in Angst vor dem Verhängnis, nach Glück und Gut, oder er steht – und dies schien, nach den Missionarberichten, praktisch die Regel zu sein – dem Schicksalswechsel, wenn auch nicht als einem Kismet, so doch als einem Fatum, resignierend gegenüber. Während der konfuzianische »höhere« Mensch, vom Verhängnis wissend und ihm innerlich gewachsen, in stolzem Gleichmut seiner Persönlichkeit und ihrer Pflege zu leben gelernt hat368. Man sieht: hier wie immer diente dieser, eine restlos rationale innerweltliche Theodizee wenigstens für den einzelnen ablehnende (daher von manchem Philosophen als die Ethik gefährdend verworfene und innerhalb des Konfuzianismus gegen den sonstigen Rationalismus des Systems in Spannung lebende) Glaube an die Irrationalität der Prädestination, der zu den andern uns schon bekannten irrationalen Bestandteilen des konfuzianischen Rationalismus hinzutritt, als Stütze der Vornehmheit. In einem charakteristisch anderen Sinne als der an einem persönlichen Gott und seiner Allmacht orientierte puritanische Prädestinationsglaube, der zwar gleichfalls die Güte der Vorsehung hart und klar ablehnte, aber dabei dennoch für sich nach dem Jenseits blickte. Das Jenseits aber kümmerte im Konfuzianismus den vornehmen so wenig wie den gemeinen Mann. Das einzige über den Tod hinausreichende Interesse des ersteren war die Ehre seines Namens, für die er den Tod zu leiden bereit sein mußte. Und in der Tat haben konfuzianische Herrscher und Generäle – wenn im hohen Spiel des Krieges und der Menschenschicksale der Himmel gegen sie war – mit Stolz zu sterben gewußt, besser als wir das an ihren christlichen Kollegen bei uns zu erleben hatten. Daß dieses spezifische Ehrgefühl Kennzeichen des vornehmen Mannes war, und daß es sich wesentlich an eigene Leistungen, nicht an Geburt knüpfte, war wohl das stärkste Motiv hochgespannter Lebensführung, welches der Konfuzianismus überhaupt kannte369. Auch darin war diese Lebensführung durchaus ständisch und nicht in unserem okzidentalen Sinne »bürgerlich« orientiert.
Damit ist auch schon gesagt, daß die Bedeutung einer solchen Intellektuellenethik für die breiten Massen ihre Schranken haben mußte. Zunächst waren die lokalen und vor allem die sozialen Unterschiede der Bildung selbst enorme. Die traditionalistische und bis in die Neuzeit stark naturalwirtschaftliche Bedarfsdeckung, aufrechterhalten bei den ärmeren Völkskreisen durch eine nirgends in der Welt erreichte, an das Unglaubwürdige grenzende Virtuosität im Sparen (im konsumtiven Sinne des Worts), war nur möglich bei einer Lebenshaltung, welche jede innerliche Beziehung zu den Gentlemanidealen des Konfuzianismus ausschloß. Nur die Gesten und Formen des äußeren Sichverhaltens der Herrenschicht konnten hier, wie überall, Gegenstand allgemeiner Rezeption sein. Der entscheidende Einfluß der Bildungsschicht auf die Lebensführung der Massen hat sich aller Wahrscheinlichkeit nach vor allem durch einige negative Wirkungen vollzogen: die gänzliche Hemmung des Entstehens einer prophetischen Religiosität einerseits, die weitgehende Austilgung aller orgiastischen Bestandteile der animistischen Religiosität andererseits. Es muß als möglich gelten, daß dadurch wenigstens ein Teil jener Züge mitbedingt ist, welche man zuweilen als chinesische Rassenqualitäten anzusprechen pflegt. Vor allem die kühle Temperierung der konfuzianischen Sozialethik, dann ihre Ablehnung anderer als rein personaler – familialer, scholarer oder kameradschaftlicher – Bande spielten hier mit.
Die Wirkung der Erhaltung dieses Personalismus zeigt vor allem die Sozialethik. Es fehlte in China bis in die Gegenwart das Verpflichtungsgefühl gegenüber »sachlichen« Gemeinschaften, seien sie politischer oder ideeller oder welcher Natur immer370. Alle Sozialethik war hier lediglich eine Uebertragung organischer Pietätsbeziehungen auf andere, die ihnen gleichartig gedacht wurden. Die Pflichten innerhalb der fünf natürlichen sozialen Beziehungen: zum Herrn, Vater, Ehemann, ältern Bruder (einschließlich des Lehrers) und Freund enthielten den Inbegriff aller unbedingt bindenden Ethik. Der konfuzianische Grundsatz der Reziprozität, welcher allen außerhalb dieser Beziehungen liegenden natürlichen sachlichen Pflichten zugrunde liegt, enthielt keinerlei pathetisches Element in sich. Alle in der genuinen Sozialethik der Nachbarschaftsverbände überall bodenständigen Pflichten, so namentlich die überall als Zeichen vornehmer Lebensführung geltende, von allen heiligen Sängern gepriesene, von jeder religiösen Ethik rezipierte Gastfreiheits- und Wohltätigkeitspflicht der Besitzenden, hatten unter der Einwirkung der konfuzianischen Rationalisierung und Konventionalisierung der ganzen Lebensführung sehr stark formelhaften Charakter angenommen. So namentlich das »Praktizieren der Tugend« – wie der charakteristische übliche Ausdruck lautete – in Gestalt der Gastlichkeit für Arme am 8. Tage des 12. Monats. Das Almosen – das urwüchsige Kerngebot aller ethischen Religiosität – war ein traditioneller Tribut geworden, dessen Verweigerung gefährlich war. Die christliche Bedeutsamkeit des Almosens hatte dazu geführt, die »Armen«, da ihre Existenz für das Seelenheil der Reichen notwendig war, als einen gottverordneten »Stand« innerhalb der christlichen Gemeinschaft anzusehen. In China hatten sie sich in gut organisierten Gilden zusammengeschlossen, die zu prinzipiellen Feinden zu haben niemand leicht wagte. Daß im übrigen Hilfsbereitschaft dem »Nächsten« gegenüber im allgemeinen nur erwartet wurde, wo ein konkreter persönlicher oder sachlicher Anlaß dazu vorhanden war, dürfte nicht nur in China das Normale sein und nur der Landeskenner kann beurteilen, ob tatsächlich, wie gesagt wird, hier ausgeprägter als anderwärts. Da der Volksreligiosität hier noch, wie der magischen Religiosität ursprünglich überall, dauernde leibliche Gebrechen als Folgen irgendeiner rituellen Sünde galten und das Gegengewicht religiöser Mitleidsmotive fehlte, so mag es, so sehr die Ethik (Mencius) den sozialen Wert des Mitleids rühmte, recht wohl sein, daß diese Empfindung nicht eben sehr entwickelt wurde. Jedenfalls nicht auf dem Boden des Konfuzianismus. Selbst die (heterodoxen) Vertreter der Feindesliebe (z.B. Mo ti) begründeten diese wesentlich utilitarisch. –
Die heiligen persönlichen Pflichten der Sozialethik konnten nun untereinander in Konflikt geraten. Dann mußten sie eben relativiert werden. Zwangsteilungen von Familien- und fiskalischen Interessen, Selbstmorde und Weigerungen von Vätern, ihre Söhne (als Hochverräter) zu verhaften, abwechselnd Verordnung von Bambushieben für solche Beamten, die nicht trauerten, und für solche, die zu viel trauerten (also durch Amtsablehnung der Verwaltung Schwierigkeit machten) sind Zeugnisse davon. Aber ein Konflikt der Interessen des eigenen Seelenheils mit den Anforderungen der natürlichen sozialen Ordnungen nach christlicher Art war undenkbar. Ein Gegensatz von »Gott« oder »Natur« gegen »positives Recht« oder »Konvention« oder irgendwelche andere verpflichtende Mächte, und deshalb auch irgendein religiöses oder rationales, mit einer Welt der Sünde oder des Unsinns in Spannung oder Kompromiß lebendes, religiös unterbautes Naturrecht fehlte, außer aus den schon erwähnten, auch aus diesem Grunde selbst in den leisesten Ansätzen, wie jeder Blick auf die Fälle, in welchen die Klassiker gelegentlich von »natürlich« reden, sofort zeigt. Denn dann ist immer der Kosmos der mit sich harmonischen Natur- und Gesellschaftsordnung gemeint. Gewiß erreicht fast kein Mensch die Stufe der unbedingten Vollendung. Aber jeder Mensch ist vollkommen zulänglich, sich innerhalb der sozialen Ordnungen, die ihn daran nicht im mindesten hindern, eine für ihn ausreichende Stufe der Vollkommenheit zu erwerben, indem er die offiziellen sozialen Tugenden: Menschenfreundlichkeit, Rechtlichkeit, Aufrichtigkeit, rituelle Pietät und Wissen, ausübt, je nachdem mehr in aktiver (konfuzianischer) oder mehr in kontemplativer (taoistischer) Färbung. Wenn die soziale Ordnung trotz Erfüllung jener Pflichten nicht zum Heil und zur Zufriedenheit aller führt, dann ist – sahen wir schon wiederholt – der charismatisch ungenügend qualifizierte Herrscher persönlich daran schuld. Darum gibt es im Konfuzianismus keinen seligen Urstand, sondern, wenigstens nach der klassischen Lehre, als Vorstufe der Kultur nur bildungslose Barbarei (für die man ja in den stets mit Einbruch drohenden wilden Gebirgsstämmen das Beispiel nahe hatte). Auf die Frage, wie man die Besserung der Menschen am schnellsten erreiche, antwortet der Meister im Lapidarstil: man möge sie zuerst bereichern und dann erziehen. Und in der Tat entsprach dem englischen formelhaften »How do you do«? – charakteristisch das ebenso formelhafte »Hast du Reis gegessen«? des Chinesen als Begrüßungsformel. Da Armut und Dummheit die einzigen beiden sozusagen »erbsündlichen« Qualitäten, Erziehung und Wirtschaft aber in der Prägung der Menschen allmächtig waren, so mußte der Konfuzianismus die Möglichkeit eines goldenen Zeitalters nicht in einem unschuldsvollen primitiven Naturstand, sondern vielmehr in einem optimalen Kulturstand erblicken.
Nun wird uns in einer merkwürdigen Stelle der klassischen Schriften einmal ein Zustand geschildert, in welchem die Herrscherwürde nicht erblich, sondern durch Wahl besetzt ist, die Eltern nicht nur die eigenen Kinder als ihre Kinder lieben und umgekehrt, Kinder, Witwen, Alte, Kinderlose, Kranke aus gemeinsamen Mitteln erhalten werden, die Männer ihre Arbeit und die Frauen ihr Heimwesen haben, Güter zwar gespart, aber nicht zu Privatzwecken akkumuliert werden, die Arbeit nicht dem eigenen Vorteile dient, Diebe und Rebellen nicht existieren, alle Türen offen stehen und der Staat kein Machtstaat ist. Dies ist der »große Weg« und sein Resultat die »große Gleichartigkeit« – wogegen die durch Selbstsucht erzeugte empirische Zwangsordnung mit individuellem Erbrecht, Einzelfamilie, kriegerischem Machtstaat und der exklusiven Herrschaft der individuellen Interessen in charakteristischer Terminologie die »kleine Ruhe« genannt wird. Die Schilderung jener anarchistischen Idealgesellschaft fällt derart aus dem Rahmen der empirischen konfuzianischen Gesellschaftslehre heraus und ist speziell mit der Kindespietät als der Grundlage aller konfuzianischen Ethik so unvereinbar, daß die Orthodoxie sie teils auf Textverderbnis zurückführte, teils »tao-istische« Heterodoxie darin witterte (wie übrigens auch Legge tut), während begreiflicherweise jetzt die moderne Schule Kang-yu-wei's gerade diesen Ausspruch als Beweis für die konfuzianische Legitimität des sozialistischen Zukunftsideales zu zitieren pflegt. Tatsächlich dürfte auch diese Stelle ebenso wie manche andere im Li-ki der Ausdruck für die von de Groot besonders klar vertretene Ansicht sein: daß viele später und jetzt als heterodox oder doch unklassisch und sogar als eine besondere Religion angesehene Lehren sich ursprünglich zur Orthodoxie etwa so verhielten, wie christliche Mystik zur katholischen Kirche und sufistische Mystik zum Islam. Wie jede kirchliche Anstaltsgnade mit der individuellen Heilssuche des Mystikers stets nur künstlich in ein Kompromiß gebracht werden konnte, obwohl andererseits die kirchliche Anstalt selbst die Mystik als solche nicht grundsätzlich verwerfen durfte, so geriet hier die letzte Konsequenz des konfuzianischen Optimismus: die Hoffnung auf Erreichung rein irdischer Vollkommenheit ganz aus eigener ethischer Kraft der Individuen und durch die Macht geordneter Verwaltung, mit der ebenfalls grundlegenden konfuzianischen Anschauung in Spannung: daß die materielle und ethische Wohlfahrt des Volkes und aller einzelnen letztlich bedingt sei nur durch die charismatischen Qualitäten des vom Himmel legitimierten Herrschers und die staatliche Anstaltsfürsorge seiner Beamten. Aber eben diese Lehre führte den Taoismus zu seinen Konsequenzen. Die als heterodox geltende Lehre vom Nichtstun der Regierung als der Quelle alles Heils war ja nur die letzte Konsequenz des ins Mystische umschlagenden orthodox konfuzianischen Optimismus. Nur ihr akosmistisches Vertrauen auf die eigene Qualifikation und die Entwertung der Anstaltsgnade, welche daraus folgte, ließ dabei sofort die Gefahr einer Häresie entstehen. Die Ueberbietung der innerweltlichen Laiensittlichkeit durch das Aufsuchen besonderer Heilswege war eben hier, wie überall, das prinzipiell der Anstaltsgnade Bedenkliche, – ganz wie im kirchlichen nicht asketischen Protestantismus. Denn an sich war ja Tao: der »Weg« zur Tugend selbstverständlich, wie wir sahen, auch ein zentraler orthodox konfuzianischer Begriff. Und ebensogut, wie die mehr oder minder konsequenten, den Eingriff des Staates nur im Falle von allzu bedenklichen Exzessen der Reichtumsdifferenzierung vorbehaltenden, oben erwähnten Laissezfaire-Theorien einiger Konfuzianer, konnte sich natürlich die Mystik auf die Bedeutung der gottgewirkten, natürlichen, kosmischen und sozialen »Harmonie« berufen, um das Prinzip des Nichtregierens daraus abzuleiten. Ebenso schwierig und zweifelhaft, wie die Feststellung, ob vom Standpunkt der mittelalterlichen Kirche ein Mystiker noch orthodox sei, war daher für den Konfuzianismus die entsprechende Feststellung für diese Lehren. Es ist also sehr verständlich, wenn de Groot die übliche Behandlung des Taoismus als einer eigentlichen Sonderreligion neben dem Konfuzianismus überhaupt ablehnt, obwohl die Religionsedikte der Kaiser selbst mehrfach und ausdrücklich neben dem Buddhismus den Taoismus als einen nur geduldeten unklassischen Glauben nennen. Der Soziologe hat sich im Gegensatz dazu an die Tatsache der hierokratischen Sonder organisation zu halten.
Letztlich waren, material, die Scheidungen orthodoxer und heterodoxer Lehren und Praktiken ebenso wie alle entscheidenden Eigentümlichkeiten des Konfuzianismus durch seinen Charakter als einer ständischen Ethik der literarisch geschulten Bureaukratie einerseits, andererseits aber durch die Festhaltung der Pietät und speziell der Ahnenverehrung als der politisch unentbehrlichen Grundlage des Patrimonialismus bedingt. Nur wo diese Interessen bedroht schienen, reagierte der Selbsterhaltungsinstinkt der maßgebenden Schicht mit dem Stigma der Heterodoxie371.
In der grundlegenden Bedeutung des Ahnenkultes und der innerweltlichen Pietät als der Grundlage der patrimonialen Untertanengesinnung lag nun auch die wichtigste absolute Schranke der praktischen Toleranz des konfuzianischen Staates372. Diese zeigte einerseits Verwandtschaft, andererseits auch charakteristische Unterschiede zu dem Verhalten der okzidentalen Antike. Der Staatskult kannte nur die offiziellen großen Geister. Aber auch die taoistischen und buddhistischen Heiligtümer begrüßte der Kaiser gegebenenfalls, nur daß er nicht, wie z.B. selbst vor dem heiligen Konfuzius, den Kotau machte, sondern sich mit einer höflichen Verbeugung begnügte. Geomantische Dienste werden staatlich entlohnt373. Das Fung-schui war offiziell anerkannt374. Gelegentlich finden sich Unterdrückungen von Exorzisten aus Tibet, – welche die Alten »Wu« nannten, fügt das Dekret hinzu375, – aber sicher aus rein ordnungspolizeilichen Gründen. Am Kult des taoistischen Stadtgottes nahm der Stadtmandarin offiziell teil und die Kanonisierungen durch den taoistischen Patriarchen bedurften des kaiserlichen Plazet. Weder existierten garantierte Ansprüche auf »Gewissensfreiheit«, noch waren andererseits Verfolgungen wegen rein religiöser Ansichten die Regel, außer wo entweder magische Gründe (ähnlich den hellenischen Religionsprozessen) oder politische Gesichtspunkte sie forderten. Aber diese verlangten immerhin ziemlich Erhebliches. Die kaiserlichen Religionsedikte und selbst ein Schriftsteller wie Mencius machten die Verfolgung der Ketzerei zur Pflicht. Die Mittel und die Intensität, auch der Begriff und das Ausmaß des »Ketzerischen« wechselten. Wie die katholische Kirche die Leugnung der Sakramentsgnade und das römische Reich die Ablehnung des Kaiserkults, so hat der chinesische Staat die nach seinen Maßstäben staatsfeindlichen Häresien teils durch Belehrung (noch im 19. Jahrhundert durch ein eigenes amtlich verbreitetes Lehrgedicht eines Monarchen) bekämpft, teils aber mit Feuer und Schwert verfolgt. Entgegen der Legende von der unbeschränkten Duldsamkeit des chinesischen Staates hat noch das 19. Jahrhundert in fast jedem Jahrzehnt eine Häretikerverfolgung mit allen Mitteln (einschließlich der Zeugentortur) gesehen. Und andererseits war fast jede Rebellion mit einer Häresie intim verknüpft. Der chinesische Staat war, gegenüber etwa dem antiken römischen, insofern in einer besonderen Lage, als er außer den offiziellen Staatskulten und dem obligatorischen Ahnenkult der einzelnen auch, seit der endgültigen Rezeption des Konfuzianismus, eine offiziell allein anerkannte Lehre besaß. Insofern näherte er sich einem »konfessionellen« Staat und stand im Gegensatz zum vorchristlichen antiken Imperium. Das »heilige Edikt« von 1672 gebot daher ausdrücklich (in der siebenten seiner sechzehn Sentenzen) die Ablehnung falscher Lehren. Dabei aber war die orthodoxe Lehre keine dogmatische Religion, sondern eine Philosophie und Lebenskunde. Das Verhältnis war in der Tat ähnlich, wie wenn etwa die römischen Kaiser des 2. Jahrhunderts die stoische Ethik offiziell als allein orthodox und ihre Annahme als Vorbedingung für die Uebertragung staatlicher Aemter rezipiert hätten.
Demgegenüber war nun, wie in Indien und auf dem Boden jeder zur mystischen Erlösung führenden Religiosität überhaupt, die populäre Form der Sekten religiosität die Spendung von Sakraments gnade. Wurde der Mystiker zum Propheten, Propagandisten, Patriarchen, Beichtvater, so wurde er damit in Asien unvermeidlich auch zum Mystagogen. Aber das kaiserliche Amtscharisma duldete gerade solche Mächte mit selbständiger Gnaden gewalt neben sich so wenig wie die Anstaltsgnade der katholischen Kirche es tun konnte. Es waren dementsprechend fast immer die gleichen Tatbestände, welche den Häretikern in den Motiven der kaiserlichen Ketzeredikte vorgeworfen wurden. Zunächst natürlich die Tatsache, daß nicht konzessionierte neue Götter verehrt wurden. Da aber im Grunde überhaupt das ganze volkstümliche Pantheon, soweit es vom staatskultischen abwich, als unklassisch und barbarisch galt, so war nicht dieser Punkt, sondern es waren die folgenden drei die wirklich entscheidenden376:
Die Ketzer tun sich, angeblich zur Pflege tugendhaften Lebens, zu nichtkonzessionierten Gesellschaften zusammen, welche Kollekten veranstalten.
Sie haben Leiter, teils Inkarnationen, teils Patriarchen, welche ihnen jenseitige Vergeltung predigen und das jenseitige Seelenheil versprechen.
Sie beseitigen die Ahnentafeln in ihren Häusern und trennen sich zu mönchischem oder sonst unklas sischem Lebenswandel von der Familie ihrer Eltern.
Der erste Punkt verstieß gegen die politische Polizei, welche nichtkonzessionierte Vereine verbot. Tugend sollte der konfuzianische Untertan privatim in den fünf klassischen sozialen Beziehungen üben. Er brauchte dazu keine Sekte, deren bloße Existenz ja das patriarchale Prinzip, auf welchem der Staat ruhte, verletzte. – Der zweite Punkt bedeutete nicht nur offenbaren Volksbetrug: – denn eine jenseitige Vergeltung und ein besonderes Seelenheil gab es ja nicht –, sondern er bedeutete auch ein Verschmähen des (innerweltlichen) Anstaltscharisma des konfuzianischen Staates, innerhalb dessen für das (diesseitige) Seelenheil zu sorgen Sache der Ahnen und im übrigen ausschließlich des vom Himmel dazu legitimierten Kaisers und seiner Beamten war. Jeder derartige Erlösungsglaube und jedes Streben nach Sakramentsgnade bedrohte also die Ahnenpietät sowohl wie das Prestige der Verwaltung. Aus dem gleichen Grunde war schließlich der dritte Vorwurf der entscheidendste von allen. Denn die Ablehnung des Ahnenkults bedeutete die Bedrohung der politischen Kardinaltugend der Pietät, an der die Disziplin in der Amtshierarchie und der Gehorsam der Untertanen hing. Eine Religiosität, welche von dem Glauben an die allentscheidende Macht des kaiserlichen Charisma und der ewigen Ordnung der Pietätsbeziehungen emanzipierte, war prinzipiell unerträglich.
Dazu fügen die Motive der Dekrete je nach Umständen noch merkantilistische und ethische Gründe377. Das kontemplative Leben, sowohl die individuelle kontemplative Heilssuche, wie, und namentlich, die Mönchsexistenz, war, mit konfuzianischen Augen gesehen, parasitäre Faulheit. Sie zehrte am Einkommen der erwerbstätigen Bürger, die buddhistischen Männer pflügten nicht (wegen des »Ahimsa«: des Verbotes, lebende Wesen – Würmer und Insekten – zu gefährden) und die Frauen webten nicht; das Mönchtum war überdies oft genug nur Vorwand, sich den Staatsfronden zu entziehen. Selbst Herrscher, welche den Taoisten oder Buddhisten, in der Zeit von deren Macht, den Thron verdankten, wendeten sich zuweilen alsbald gegen sie. Der eigentliche Kern der buddhistischen mönchischen Askese: der Bettel, wurde dem Klerus immer erneut ebenso untersagt wie die Erlösungspredigt außerhalb der Klöster. Diese selbst wurden, nachdem sie konzessionspflichtig geworden waren, zahlenmäßig scharf beschränkt, wie wir sehen werden. Die damit kontrastierende zeitweise entschiedene Begünstigung des Buddhismus beruhte wohl (wie bei den Mongolenkhanen die Einführung des Lamaismus) auf der Hoffnung, diese Lehre der Sanftmut zur Domestikation der Untertanen benutzen zu können. Allein die gewaltige Ausbreitung der Klöster, welche sie im Gefolge hatte, und das Umsichgreifen des Erlösungsinteresses führten schon sehr bald zu scharfer Repression, bis die buddhistische Kirche im 9. Jahrhundert jenen Schlag erhielt, von dem sie sich nie wieder ganz erholt hat. Wenn ein Teil ihrer und ebenso der taoistischen Klöster erhalten und sogar auf den Staatsetat genommen wurde, jedoch unter strengem staatlichen Diplomzwang für jeden Mönch: – nach Art des preußischen Kulturkampfes wurde eine Art von »Kulturexamen« gefordert –, so war dafür, nach de Groots sehr plausibler Annahme, maßgebend wesentlich das Fung-schui: die Unmöglichkeit, einmal konzessionierte Kultstätten ohne vielleicht gefährliche Erregung von Geistern zu beseitigen. Wesentlich dies bedingte jene relative Toleranz, welche die Staatsräson den heterodoxen Kulten zubilligte. Diese Toleranz bedeutete keinerlei positive Schätzung, sondern mehr jene verächtliche »Duldung«, welche jeder weltlichen Bureaukratie der Religion gegenüber die natürliche, überall nur durch das Bedürfnis nach Domestikation der Massen temperierte Haltung ist. Der »vornehme« Mensch befolgte diesen wie allen nicht offiziell von Staats wegen verehrten Wesen gegenüber den dem Meister selbst in den Mund gelegten sehr modernen Grundsatz: die Geister durch die bewährten Zeremonien zur Ruhe zu bringen, aber von ihnen »Distanz zu halten«. Und die Praxis der Massen diesen geduldeten heterodoxen Religionen gegenüber hatte nichts mit unserem Begriff der »Konfessionszugehörigkeit« zu tun. Wie der antike Okzidentale je nach Anlaß Apollon oder Dionysos verehrte und der Süditaliener die konkurrierenden Heiligen und Orden, so zollte der Chinese den offiziellen Zeremonien der Reichsreligiosität, den buddhistischen Messen, – die dauernd bis in die höchsten Kreise beliebt waren, – und der taoistischen Mantik ganz die gleiche Beachtung oder Mißachtung, je nach Bedarf und jeweiliger Bewährung der Wirksamkeit. Für die Begräbnisriten wurden im Pekinger Volksbrauch nebeneinander buddhistische und taoistische Sakramente verwendet, während der klassische Ahnenkult die Grundfärbung abgab. Unsinn war es jedenfalls, die Chinesen als der Konfession nach »buddhistisch« zu zählen, wie früher oft geschah. Nach unserem Maßstab wären eigentlich nur die eingeschriebenen Mönche und Priester »Buddhisten«.