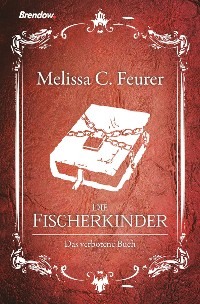Kitabı oku: «Die Fischerkinder», sayfa 6
„Ich muss ihn mit in die Stadt nehmen“, sagte der Wachmann, als hätte er nichts von alledem mitbekommen, und griff nach Ari. Doch die Umklammerung der Mutter war stärker.
„Nein!“ Sie erhob sich und schob das Kind hinter ihren Rücken. „Nicht meinen Jungen mitnehmen. Ich zahle zurück, was er gestohlen hat. Ich verspreche es.“
„Zurückzahlen?“ Die Bestohlene bleckte die Zähne. „Richtiges Brot, ohne Laub oder Stroh, könntest du dir gar nicht leisten!“
Als wäre ihre kleine Menschenansammlung nicht schon aufsehenerregend genug gewesen, stieß in diesem Moment ein dickbäuchiger Mann zu ihnen. „Aber, aber“, sagte er und legte der Frau mit dem Brotlaib eine massige Hand auf den Rücken. „Was ist geschehen, Liebes? Warum bist du nicht in deinem Laden?“
„Wir wurden schon wieder bestohlen, Othmar.“ Seine Frau straffte die Schultern und hielt ihm anklagend das Brot entgegen. „Seit Monaten geht das nun so. Und immerzu sage ich dir, du musst härter durchgreifen. Aber dieses Mal …“ Sie sah zu Ari, der ihren Blick verbissen erwiderte. Die Tränen hatten glänzende Linien auf seinem schmutzigen Gesicht hinterlassen. „ … dieses Mal kommen sie damit nicht davon.“
„Sie wollen doch nicht etwa die Mutter dieser beiden Kinder mitnehmen?“, wandte der Dickbäuchige sich an den Wachmann.
„Den Jungen“, erwiderte dieser mit militärischer Knappheit. Die Frau quittierte dies mit einem grimmigen Nicken, und Aris Mutter begann wieder zu schluchzen, kniete neben ihrem Sohn nieder und drückte ihn so fest an sich, dass der Säugling zwischen ihnen noch lauter schrie.
„Meine Güte, wem ist denn damit gedient?“, entfuhr es Othmar. „Arbeitet dein Mann nicht auf meinen Feldern?“ Er wandte sich an die auf dem Boden kniende Mutter. Diese nickte mit steinerner Miene.
„Er soll die nächste Woche unentgeltlich arbeiten, und ich will die Sache vergessen.“
„Aber Othmar!“, protestierte seine Frau, doch er hatte schon ein ledergebundenes Notizbuch aus einer unter seinem mächtigen Bauch verborgenen Hosentasche gezogen und schrieb etwas darin auf.
„Ich wollte dich fragen, ob du Hilfe im Laden brauchst“, wandte Othmar sich schließlich wieder an seine Frau, als hätte er den Zwischenfall bereits vergessen. „Aber daraus wird nun nichts mehr. Ich muss schon in fünf Minuten wieder an der Scheune sein und Professor Winkelbauers Schülerin treffen.“
Mira riss den Blick von Ari und seiner Mutter los und besah sich Othmar genauer. Er trug Hemd und Stoffhosen wie jeder andere auch. Zwar zierten große Schweißflecken den Stoff unter seinen Armen, doch war er ansonsten kaum weniger gepflegt als jeder Staatsbeamte in der Innenstadt. Wie ein Landwirt sah er rein gar nicht aus.
„Das sind wir“, sagte Mira jedoch und streckte ihm die Hand entgegen. „Wir sind Professor Winkelbauers Schülerinnen.“
Othmar führte Vera und Mira durch eine Gasse, an deren Ende ein massiges Holzgebäude stand. Es hatte kein zweites Stockwerk, war dafür aber mehr als zehnmal so breit wie hoch. Neben den schmalen Häusern, die sich dicht an dicht in den Straßen des Armenviertels drängten, wirkte es geradezu lächerlich groß.
„Da wären wir.“ Othmar öffnete ein schweres Schiebetor und ließ sie in das Halbdunkel dahinter treten. Es handelte sich um einen Lagerraum. Leinensäcke, vermutlich voller Getreide, stapelten sich bis an die niedrige Decke; Fässer, Eimer, Bewässerungsschläuche und allerlei Gerätschaften lagen in gut sortiertem Chaos bereit. Alles sah ungeheuer alt und abgenutzt aus, abgesehen von dem blitzsauberen, silbernen Scanner neben der Hintertür und einem Schreibtisch, der in einer Ecke zu ihrer Rechten auf einem Teppich stand und nicht so recht zum Rest der Einrichtung passen wollte.
„Ich wusste nicht, dass ihr zu zweit kommt.“ Othmar ging geradewegs zu dem Tisch, auf dem Unterlagen zu ordentlichen Türmen gestapelt waren.
„Ich begleite Vera“, beeilte Mira sich zu erklären und versuchte, zu wiederholen, was ihr Vater gesagt hatte: „Die Landwirtschaft halte ich für eine spannende Sache. Ein Einblick in das aufblühende Versorgungssystem unseres Staates k-“
„Schon gut!“ Othmar lachte. „Ich dachte, die Jugend interessiere sich nicht für die Landwirtschaft. Aber wenn ihr das alles für so spannend haltet, will ich euch erst einmal herumführen.“ Er zerrte das ledergebundene Notizbuch aus seiner Hosentasche und legte es auf seinen Schreibtisch. „Muss mir alles aufschreiben“, meinte er, als er den Blicken der beiden Mädchen folgte. „Der Kopf ist das reinste Sieb. Wahrscheinlich würde ich am Morgen vergessen, zur Arbeit zu gehen, wenn ich es mir nicht notieren würde.“ Lachend tätschelte er das Notizbuch und kam schließlich um den Schreibtisch herum zu Mira und Vera. „Dann wollen wir mal!“
Sie folgten Othmar durch den Lagerraum und zur Hintertür. Mira staunte, als er die Torflügel aufschwang und stolz nach draußen wies. Aber es war kein gutes, beeindrucktes Staunen, auch wenn Othmar ihren Blick hoffentlich so deutete, sondern eines, das sich mit Entsetzen mischte.
Leonardsburg lag hinter ihnen. Auf der anderen Seite des Gebäudes erstreckten sich nur noch die Felder. Hellbraune, dunkelbraune, grüne und gelbliche Quadrate, die sich wie ein Flickenteppich bis zum Horizont aneinanderreihten. Kein Strauch, kein Baum, nichts, das in den heißen Sommermonaten Schatten spenden konnte oder bei Regen Schutz vor Wind und Wetter bot.
Nun wusste Mira auch, warum Othmar nicht aussah, wie sie sich einen Mann vorgestellt hatte, der sommers wie winters draußen auf den Feldern arbeitete, pflügte, pflanzte, pflegte, bewässerte und erntete. Die Wahrheit war, dass Othmar vermutlich einen Großteil seiner Zeit am Schreibtisch verbrachte und andere für sich schuften ließ.
Sie beugten die Rücken über ihre Arbeit. Ganze Reihen von ihnen tummelten sich dort draußen. Von Hand lockerten die einen mit kleinen Harken die Erde auf, während andere Unkraut ausrissen und in große Körbe warfen, die sie bei sich trugen. Mit Sensen wurden Wiesen gemäht, aus schwarzen Säcken Dünger verteilt und mit monströsen Spritzen winzige, grüne Pflänzchen mit Insektiziden besprüht.
„Wir sind eines der größten Unternehmen der Region“, erklärte Othmar stolz, „das fast zu hundert Prozent ohne Fahrzeuge auskommt. Es gibt Firmen, die alte Düngerstreuer, Mähdrescher und Traktoren zu Elektrofahrzeugen umbauen. Aber Strom ist teuer. Ich spare eine Menge durch die billigen Arbeitskräfte aus den Armenvierteln.“ Er lachte, sodass sein dicker Bauch wackelte. „Es gibt so viele, die Arbeit suchen, dass ich gar nicht alle einstellen kann. Und genügsame Menschen sind das. Verlangen nicht viel für ihre Arbeit.“
„Oder gar nichts“, überlegte Mira bitter und dachte an Aris Vater, der in der nächsten Woche umsonst hier draußen würde arbeiten müssen. Was würde aus der Familie werden, wenn er eine ganze Woche lang keine Rationskarten nach Hause brachte? Ari hatte einen Laib Brot gestohlen – sicher kein Lausbubenstreich. Wahrscheinlich reichten die Rationen, die Aris Vater für seine Arbeit auf den Feldern zugeteilt bekam, schon so kaum zum Leben.
Vera schien Ähnliches durch den Kopf zu gehen. Mit offensichtlicher Bestürzung beobachtete sie die Menschen, die Othmar für sich auf den Feldern schuften ließ. Sie sahen nicht einmal von ihrer Arbeit auf, gönnten sich kein Innehalten und keine Unterbrechung. In ewig gleichbleibenden Bewegungen verrichteten sie ihre mühsame Tätigkeit.
Wenn Othmar Vera ins Gesicht sah, würde er dort nichts sehen, das regem Interesse an seiner Arbeit auch nur nahekam. Und wenn er wirklich Winkelbauers Freund war, dann war es alles andere als ratsam, sich ihn zum Feind zu machen.
Mira gab sich einen Ruck. „Welche Getreidesorten bauen Sie an?“, fragte sie so interessiert wie möglich. „Und wann ist Zeit für die Ernte? Wie viele Bürger können Ihre Erträge mit Brot versorgen?“ Es spielte keine Rolle mehr, dass sie Vera die Aufgabe zugewiesen hatte, die Fragen zu stellen. Sie waren beide nicht auf das hier gefasst gewesen.
Nur allzu bereitwillig gab Othmar Auskunft. Er erklärte so ausführlich und redete so viel, dass er gar keine Gelegenheit hatte, den Blick zu bemerken, mit dem Vera immer noch seine Arbeiter musterte, oder mitzubekommen, wie sie angeekelt zur Seite trat, als der Wind eine feuchte, scharf riechende Wolke Insektizide in ihre Richtung wehte.
„ … arbeiten ganzjährig hier. Dazu kommen im Sommer über hundert Erntehelfer.“
„Und wie viele von ihnen lassen Sie umsonst für Sie arbeiten?“, fragte Vera unvermittelt.
Mira, die Othmars Antworten in Kurzform notierte, glaubte einen Moment, sich verhört zu haben. Othmar schien es ähnlich zu gehen.
„Umsonst?“, fragte er irritiert und sah Vera mit schief gelegtem Kopf an. „Ich sagte, die Leute aus den Armenvierteln verlangen nicht viel. Natürlich bekommen sie Lohn für jeden Arbeitstag.“ Er nickte durch das geöffnete Tor zum Ausweisscanner an der Wand. „Jeden Abend werden ihre Arbeitsstunden verbucht und an die Zuteilungsstelle für Rationen übermittelt.“
Ehe Vera an den Vorfall mit Ari und dem gestohlenen Brot erinnern konnte, platzte Mira mit der nächstbesten Frage heraus, die ihr einfiel: „Was machen die Sommerarbeiter im Winter, wenn Sie nichts für sie zu tun haben?“
„Sie suchen sich anderswo Arbeit“, erwiderte Othmar, warf Mira aber nur einen Seitenblick zu, während er weiterhin Vera musterte, die seinen Blick so fest erwiderte wie Ari vorhin den der wütenden Frau. So verbissen kannte Mira sie gar nicht. Vera musste ernstlich erschüttert sein über das, was sie hier sahen.
„Es gibt genügend Fabriken“, fuhr Othmar fort. „Auch wenn die Stellen dort nicht so beliebt sind wie die auf den Feldern. Fabrikarbeit ist undankbar. Vieles, was früher automatisch ablief, muss heute mühsam von Hand erledigt werden. Und manche der Arbeiter sehen nie etwas von ihrem Lohn.“ Er zuckte die Schultern. „Immerhin werden sie, wenn sie eine Stelle haben, in die Zuteilungslisten für die Grundrationen aufgenommen. Das sichert vielen Familien das Überleben.“
„Sie meinen, wer keine Stelle hat, bekommt auch keine Rationen?“
Othmar runzelte die Stirn. „Natürlich nicht. Warum sollte der Staat für jemanden aufkommen, der nichts zu seinem Erhalt beiträgt?“
„Aber was machen diese Leute?“
„Ich dachte, euch interessiert die Landwirtschaft“, sagte Othmar und erinnerte Mira wieder daran, dass er mit Winkelbauer unter einer Decke steckte und dass mit ihm deshalb – auch wenn er wesentlich freundlicher als der boshafte Staatswirtschaftslehrer schien – nicht zu spaßen war. Die falschen Fragen zu stellen konnte gefährlich sein; möglicherweise nicht nur für ihre Note in Staatswirtschaft.
Sie gaben sich wirklich Mühe. Vera kehrte zu ihrer gewohnten Schüchternheit zurück, doch wenn man sie so gut kannte wie Mira, konnte man in ihren Blicken und Gesten die Feindseligkeit erkennen, die sie dem Landwirt entgegenbrachte. Es war nicht schwer zu erraten, woran sie dachte: Sie konnte es nicht ertragen, welches Unrecht diesen Menschen, insbesondere Ari und seiner Familie, geschah.
Sie war ganz still geworden, als sie sich schließlich mit drei Seiten handschriftlichen Notizen und schwirrenden Köpfen von Othmar verabschiedeten. Er brachte sie zur hinteren Lagertür zurück, öffnete sie ihnen und verabschiedete sich herzlich, aber knapp. „Ihr findet den Weg alleine, nicht wahr?“, fragte er mit einem Blick auf seine schuftenden Angestellten. „Euer Professor meinte, ich könnte euch vielleicht jemanden mitschicken, der euch zum Rand der Innenstadt begleitet …“
Er verstummte, und Mira ergriff die Gelegenheit beim Schopf. „Aber nein“, winkte sie ab. „Sie brauchen vermutlich all Ihre Leute hier draußen auf den Feldern. Wir haben ja gesehen, wie beschäftigt alle sind. Den Weg zu finden ist kein Problem.“
Othmar schien das nur gelegen zu kommen. Kaum einige Sekunden später war er davongeeilt, so schnell sein Bauch es zuließ, und Mira und Vera fanden sich alleine im Lagerraum wieder.
Das Tor auf der anderen Seite ließ sich nur schwer öffnen. Mira musste sich mit aller Kraft dagegenstemmen. In Gedanken war sie bereits dabei, sich eine Ausrede zurechtzulegen, warum sie nicht mit Vera in die Innenstadt zurückging. Ihr Gespräch mit dem Landwirt hatte länger gedauert, als sie erwartet hatte. Mittlerweile war es halb sechs, und die Sonne stand tief. Draußen auf den Feldern hatten sie zusehen können, wie sie sich dem Flickenteppich aus verschiedenfarbigen Flächen genähert hatte.
„Warum hilfst du mir denn nicht?“ Mira, die sich immer noch mit der Tür abmühte, sah sich ärgerlich nach Vera um. Doch die war nicht wie vermutet direkt neben ihr. Ein paar Meter hinter Mira war sie stehen geblieben und starrte auf den Schreibtisch in der Scheunenecke, der so furchtbar deplatziert aussah. Othmars kleines Notizbuch lag zuoberst.
„Oh nein, denk nicht mal daran!“, flüsterte Mira. Ärger konnte sie jetzt wirklich nicht gebrauchen. In einer halben Stunde musste sie am Westturm sein, um mehr über das verbotene Buch herauszufinden. Vera durfte diesen Plan unter keinen Umständen durchkreuzen.
„Was soll aus Ari und seinen Geschwistern werden, wenn sein Vater nicht einmal den Lohn für seine harte Arbeit nach Hause bringt?“, fragte Vera. „Das alles ist eine schreiende Ungerechtigkeit! Wenn ein Kind so hungrig ist, dass es Brot stiehlt –“
„Was sollen wir denn machen?“
Vera schluckte hörbar und starrte wie gebannt auf den Schreibtisch. „Er hat gesagt, ohne sein Notizbuch kann er sich nichts merken.“
„Wir können es aber doch nicht einfach stehlen!“, sträubte sich Mira. „Ich weigere mich, sein Buch zu –“ Sie verstummte. Immerhin wäre das Notizbuch des Landwirts nicht ihr erstes gestohlenes Buch. Und Vera wusste das genau.
„Na schön!“ Sie ging an ihrer Freundin vorbei. Selbst würde diese ja doch nicht den Mut haben, sich dem Schreibtisch auch nur einen einzigen weiteren Schritt zu nähern. Sie keuchte bereits entsetzt auf, als Mira nach dem Büchlein griff und es aufklappte. Das Leder unter ihren Fingern fühlte sich samtig und teuer an. Wie alles an Othmar und seiner Frau passte es nicht in die karge Umgebung der Armenviertel.
Othmar schien sich tatsächlich einfach alles zu notieren: die Zeit des Abendessens, die Mengen an Saatgut und Insektiziden, die wann von wo geliefert wurden, und solche Dinge wie: „Rasieren und Haare kürzen.“
Auf der letzten Seite standen lediglich ein Termin mit einem anderen Landwirt und die Erinnerung, Aris Vater für die kommende Woche den Lohn zu streichen. Ohne länger zu zögern, packte Mira das dicke Papier und riss es mit einem lauten Ratschen aus dem Büchlein.
„So“, sagte sie zufrieden zu Vera und legte das kleine Buch wieder auf den Schreibtisch. Aber Vera schüttelte nur den Kopf und legte den Finger an die Lippen.
Wie erstarrt stand Mira auf dem weichen Teppich, der unter dem Schreibtisch verlegt war. Jetzt hörte sie es auch: die sich nähernden Schritte von der jenseitigen Hallenhälfte.
Wie auf ein unsichtbares Zeichen rannten sie beide los. Zu zweit und in Panik ließ sich das Tor beinahe mühelos aufschieben, und schon Sekunden später stürmten sie die Straße hinab.
„Du bist mir etwas schuldig“, keuchte Mira, als sie zwei Gassen weiter zum Stehen kamen und sich vorlehnten, um nach Luft zu schnappen. Sie hatte die Hände auf die Knie gestützt und sog die kühl gewordene Abendluft in ihre Lungen, bis ihr Atem wieder langsamer ging. Nur ihr Herzschlag wollte sich nicht beruhigen. „Ich habe Kopf und Kragen riskiert, um etwas zu tun, das dir am Herzen liegt.“ Sie sah Vera an, der die Ponyfransen an der Stirn klebten. In ihrem Blick lag etwas Ahnungsvolles, gemischt mit ein bisschen Furcht. „Jetzt“, sagte Mira jedoch ruhig, als hätte sie davon nichts bemerkt, „bist du an der Reihe.“
Kapitel 6
Im Inneren des Berges
Vera machte ein missmutiges Gesicht, während sie mit Mira im Schatten des Westturmes ausharrte. Mira konnte es ihr kaum verübeln – sie hatte sie ziemlich überrumpelt. Wahrscheinlich hatte es auch wenig Sinn, jetzt mit ihr darüber zu diskutieren oder sich gar zu entschuldigen. Mira war ohnehin vollauf damit beschäftigt, nach Edmund Porter Ausschau zu halten.
Sie starrte noch die Straße vor ihnen hinab, als unvermittelt jemand neben sie trat. „Ihr seht immens verdächtig aus, wie ihr hier herumlungert“, knurrte er, und Mira machte einen kleinen Satz zur Seite, so heftig fuhr sie zusammen.
Auch Vera riss die Augen auf und erstarrte zu Eis. Mira fuhr herum und erwartete felsenfest, sich Auge in Auge mit einem blau uniformierten Wachmann wiederzufinden. Ihr Gegenüber war tatsächlich im gleichen Alter wie die meisten Wachposten – vielleicht Anfang 20, gerade die Ausbildung beendet und ehrgeizig, spätestens bis zu seinem dreißigsten Geburtstag ein höheres Amt errungen zu haben. Allerdings trug er Hemd und Stoffhosen und einen Haarschnitt, der so raspelkurz und so hell war, dass er ebenso gut eine Glatze hätte haben können.
„Los, wir haben keine Zeit zu verlieren“, kommandierte er, ohne sich mit einer Begrüßung aufzuhalten. „Viel auffälliger, als hier herumzustehen, geht es ja fast nicht mehr.“ Er wollte sich in Bewegung setzen, aber Mira hielt ihn auf. „Wer bist du?“, fragte sie. Ehe er sich nicht wenigstens vorstellte, war sie nicht bereit, ihm auch nur einen einzigen Schritt zu folgen. Vera zu überreden, sie zu begleiten, und sie dann in eine Falle zu locken – das konnte sie nicht riskieren.
Der Angesprochene drehte sich um und funkelte Mira an, als wäre sie ihm geradewegs in den Rücken gefallen. „Ben“, sagte er knapp.
„Schön.“ Mira ließ sich nicht einschüchtern. Das wäre ja gelacht! Nur weil er ein paar Jahre älter war und einen Befehlston wie die städtischen Wachmänner beherrschte, würde sie sich nicht alles gefallen lassen. „Das ist Vera. Und ich bin Mira –“
„Miriam Robins“, erwiderte er ungeduldig. „Ich weiß schon. Tochter eines erfolgreichen Staatsbeamten.“ Er verdrehte die Augen und sah dann mit wachsamem Blick die leere Straße hinab. „Und Vera Petersen. Tochter eines ehemals erfolgreichen Staatsbeamten. Können wir jetzt endlich gehen?“
„Wohin?“, fragte Vera und sah nun ihrerseits die Gasse hinab. Es war offensichtlich, dass sie nicht freiwillig hier war. Aber Ben hätte sich nicht weniger dafür interessieren können.
„Das werdet ihr schon sehen“, sagte er und setzte sich in Bewegung. Er war groß gewachsen und mit seinen langen Beinen so schnell, dass die beiden Mädchen in einen leichten Trab verfallen mussten, um zu ihm aufzuschließen. „Es ist ein Stück zu laufen, und ich schlage vor, dass ihr euch so still und unauffällig wie möglich verhaltet“, setzte Ben über die Schulter gewandt hinzu.
Er versprach nicht zu viel: Sie liefen eine ganze Weile und auf seinen Wunsch hin in absolutem Schweigen. Nur als sie die letzten Häuser der Stadt hinter sich ließen, wagte Mira die Frage: „Treffen wir Edmund Porter draußen auf den Feldern? Er hat dich doch geschickt, oder?“
Ben quittierte ihr Misstrauen mit einem genervten Blick und einer Geste, die sie zum Stillsein ermahnte. Also trottete Mira wortlos hinter ihm her und beschloss, es darauf ankommen zu lassen, ihm zu vertrauen. Trotz seines barschen Auftretens hatte er etwas an sich, dass es ihr abwegig erscheinen ließ, dass er sie hinters Licht führte.
Sie folgten einer Straße, bogen rechts in einen Feldweg ein, gingen eine Weile hügelaufwärts, dann über einen schmäler werdenden Pfad wieder hinab. Der Himmel über ihren Köpfen verlor zunehmend an Helligkeit. Schon war aus dem fast wolkenlosen Blau ein samtenes Lila geworden, und Mira konnte bereits den ersten Stern erspähen. Zu ihrer Linken erhob sich der felsige Grundriss des Klippenberges. Er überragte die hügelige Landschaft hier draußen ein gutes Stückchen. Mira erkannte ihn an seinen zerklüfteten Kanten, die man sogar von manchen höher gelegenen Punkten in der Innenstadt sehen konnte. Das Grau des Felsens hob sich in den Abendstunden nur noch schwach vom Dunkel des Himmels ab.
Wenn Ben sie hier zurückließe, würden sie sehen müssen, wie sie zurück in die Stadt fanden. Und das vor Beginn der Ausgangssperre in kaum drei Stunden. Vielleicht war es ein Fehler gewesen, ihm zu vertrauen. Ja, vielleicht hätte sie erst gar nicht zu diesem ominösen Treffen am Westturm kommen dürfen. Schon gar nicht mit Vera, die eigentlich gar nicht hier sein wollte. Neben sich hörte Mira sie schnell und regelmäßig atmen. Ein Atemzug pro Schritt.
Als Ben plötzlich stehen blieb, rannte Mira fast in ihn hinein.
„Hört zu.“ Offenbar war das Redeverbot aufgehoben. Er gab sich nicht einmal sonderlich große Mühe, leise zu sprechen. „Sobald ihr einen Fuß in unser Hauptquartier setzt, gehört ihr genauso zu den Fischerkindern wie wir alle.“
„Hauptquartier?“, wiederholte Mira, und Vera fragte alarmiert: „Wer sind die Fischerkinder?“
Aber Ben dachte gar nicht daran, ihnen zu antworten.
„Es hat keinen Sinn, uns zu verraten. Sie lassen niemanden davonkommen, der mit drinsteckt, auch nicht wenn er den Rest der Gruppe persönlich ans Messer liefert.“
Nun endlich dämmerte es Mira, und ihr Magen zog sich mit einem heftigen Ruck zusammen. „Ihr seid eine konspirative Kleinstgruppe.“
Ben schnaubte. „Schön gesagt“, meinte er sarkastisch. „Hast du den Rest auch verstanden?“ Er sah zuerst Mira, dann Vera an und warf schließlich einen Blick über die Schulter. „Es hat keinen Sinn, uns –“
„Wir haben nicht vor, euch zu verraten“, erwiderte Mira ruppig. Bens Misstrauen begann, ihr gehörig auf die Nerven zu gehen. „Ich bin hier, um mehr über das Buch zu erfahren.“
„Und sie?“ Ben nickte zu Vera, die stumm neben ihnen stand.
„Für Vera lege ich meine Hand ins Feuer“, wehrte Mira ab, ehe diese selbst das Wort ergreifen konnte. Vera und sie verraten … sie waren Freunde seit der Zeit der Nachmittagsbetreuung im staatlichen Erziehungshaus, und die Jahre hatten sie zusammengeschweißt.
„Na, da bin ich ja beruhigt“, knurrte Ben, ließ sie aber endlich in Frieden und wandte sich um. Sie befanden sich jetzt am Fuße des Klippenberges. Die ersten Meter konnte man mit ein wenig Anstrengung bergan laufen, doch schon bald wurde der Hang so steil, dass es einer Kletterausrüstung bedurft hätte, um den Weg fortzusetzen. Der einzige halbwegs begehbare Pfad endete an der Tür einer Bruchbude von einer Hütte, die noch schäbiger aussah als die Behausungen in den Armenvierteln.
Ben steuerte direkt darauf zu. Mira konnte nichts Außergewöhnliches an dem winzigen Steinhäuschen finden. Es war moosbewachsen und windschief. Hinter dem einzigen Fenster klemmte etwas Schwarzes und versperrte ihnen die Sicht ins Innere.
Das konnte ja wohl unmöglich der geheime Treffpunkt sein! Niemand, der noch ganz bei Trost war, konnte auf die Idee kommen, ein verbotenes Treffen so offensichtlich abzuhalten. Eine Hütte außerhalb der Stadt war das letzte Versteck, das Mira zu einem solchen Zweck gewählt hätte. Selbst Edmund Porters Buchhandlung schien ihr ungefährlicher.
Daran änderten auch die Sicherheitsvorkehrungen nichts, die man offenbar getroffen hatte. Ben klopfte in einem geradezu lächerlich einprägsamen Rhythmus an die hölzerne Tür, und schon Sekunden später ließ eine Stimme von drinnen vernehmen: „Credo in unum Deum.“
Mira warf einen Blick zu Vera, um zu sehen, ob sie das Gesprochene verstanden hatte, doch ihre ängstlich geweiteten Augen ließen das Gegenteil vermuten.
Ben jedoch zögerte nicht einmal. „Et in unum Dominum Jesum Christum“, erwiderte er laut und deutlich.
Mira lauschte angestrengt, und das vertraute Wort ließ ihr Herz einen kleinen Hüpfer machen: Die Rede war von Jesus. Hatte in ihr noch irgendein Zweifel bestanden, ob sie Ben trauen konnte, hatte er sich nun in Luft aufgelöst. Unbestreitbar hatte Edmund Porter ihn geschickt, um sie abzuholen und hierher zu bringen.
Deshalb vergeudete Mira auch keine Zeit, als schließlich und endlich die Tür aufschwang. Direkt hinter Ben trat sie ein.
Der Innenraum der Hütte war winzig. Selbst ihr unscheinbares Äußeres strafte er Lügen. Von außen hatte es so ausgesehen, als könnten, dicht gedrängt, vielleicht acht oder neun Leute darin Platz finden. Doch als Vera sich als Letzte hineinzwängte, konnten sie sich kaum mehr rühren. Den meisten Platz brauchten ein rechteckiger Holztisch und Edmund Porter, der ihnen geöffnet hatte.
Mira war enttäuscht. Sicher, es hatte sie erschreckt, herauszufinden, dass sie sich auf dem Weg zum geheimen Treffen einer verbotenen Kleinstgruppe befanden; aber der Gedanke hatte auch etwas ungemein Spannendes und Anziehendes gehabt. Wie die Abenteuer in den Büchern, die sie gelesen hatte, war es gefährlich und aufregend zugleich. Dass die Gruppe lediglich aus Edmund Porter und dem unfreundlichen Ben bestand, entsprach rein gar nicht ihren Erwartungen.
„Mira Robins“, begrüßte Edmund Porter sie jedoch mit einem Schulterklopfen und so warmherzig, dass sie ihren Unmut hinunterschluckte. „Und Vera Petersen. Es ist gut, zu sehen, dass ihr sicher hier angekommen seid.“
Ben, der sorgfältig die Tür hinter ihnen verriegelt hatte, wandte sich zu ihnen um. Er stieß dabei an Mira und fegte mit dem Ellbogen beinahe eine flackernde Öllampe vom Tisch, deren Licht der schwarze Stoff schluckte, der in den Fensterrahmen geklebt war. Sie kam bedenklich ins Wackeln, aber Ben nahm sich kaum die Zeit, sie wieder in die Tischmitte zu schieben. „Bist du sicher, dass du ausgerechnet –“, setzte er an, doch Edmund Porter fiel ihm ins Wort: „Ganz und gar sicher. Ich vertraue ihr.“
„Das ist dein Problem“, brummte Ben. „Du verschenkst dein Vertrauen viel zu leichtfertig, Vater.“
„Vater?“ Mira sah im schwachen Licht der Öllampe von Ben zu Edmund Porter. Die dichten Brauen – bei Ben freilich in blond und nicht in grau – und die hellblauen Augen. Vielleicht noch die gerade, schmale Nase. Das waren die einzigen Ähnlichkeiten zwischen Edmund Porter und Ben.
„Also hat sich mein Sohn gar nicht vorgestellt“, seufzte Edmund Porter. „Nun, aber zum Kennenlernen ist heute Abend noch genug Zeit. Ihr wart die Letzten, also können wir gehen.“
Als Edmund Porter sich bückte und den Teppich aufzurollen begann, musste Mira einen Schritt zurücktreten. Sie versuchte, Ben nicht allzu nahe zu kommen – mit dem einzigen Ergebnis, dass sie ihm auf den Fuß trat und sich letzten Endes doch dicht an ihn pressen musste, um Edmund Porter Platz zu machen. Sie vermied es, Ben anzusehen, und beobachtete stattdessen jede von Edmund Porters geübten Bewegungen. Unter dem Teppich befand sich eine Falltür. Ein runder Metallgriff war mit einem Stück Schnur mit dem Läufer verbunden, und Mira ahnte, dass sie ihn über die verräterische Klappe ziehen würde, wenn man diese ruckartig genug zuzog.
Edmund Porter schloss sie auf und hob den Deckel an. Dahinter herrschte die schwärzeste Dunkelheit, die Mira je gesehen hatte. Zwei Leitersprossen waren im Schein der Öllampe zu erkennen, darunter verlor sich alles in bleierner Finsternis. Edmund Porter kletterte als Erster hinab, und das mit solcher Behändigkeit, wie man sie einem Mann in seinem Alter und mit seiner Statur niemals zugetraut hätte. Sie hörten seine Schritte auf den Leiterstufen, auch als sie ihn längst nicht mehr sehen konnten.
Mira wurde flau im Bauch. Der Schacht, der kaum breit genug für den rundlichen Mann gewesen war, schien weit in die Tiefe hinabzuführen. Irgendwo dort unten, in der dumpfen Enge eines unterirdischen Raumes, endete er. Sie musste zugeben, dass ein Versteck unter der Erdoberfläche geradezu genial war – wesentlich sicherer als die Hütte am Fuß des Klippenberges. Aber der Gedanke, metertief unter dem Berg festzusitzen, während die Luft immer dünner wurde und die Wände immer näher kamen, verursachte ihr einen leichten Anflug von Panik.
„Das Treffen findet doch nicht etwa da unten statt?“ In Veras Stimme klang die gleiche Beklommenheit, die Mira verspürte.
„Ich dachte, ihr wollt mehr über das Buch erfahren?“, fragte Ben. „Dafür gibt es keinen sichereren Ort als ein von vielen Metern massivem Felsen umgebenes Quartier.“ Er grinste. „Los jetzt! Ich kann die Falltür ja nicht ewig offen lassen.“
Weil er ungeduldig war und Mira sich nicht die Blöße geben wollte, ihre Angst zu zeigen, gab sie sich einen Ruck und setzte den ersten Fuß auf die Leiter. Schritt für Schritt, Handgriff für Handgriff arbeitete sie sich nach unten vor, während die Luft um sie herum immer kühler wurde und immer modriger roch. Viel früher als gedacht, fühlte sie festen Boden unter ihren Füßen.
„Sehr schön!“ Edmund Porter sorgte dafür, dass Mira Platz für Vera machte, die ihr flink und nahezu lautlos gefolgt war. Wahrscheinlich hatte sie ihre Scheu vor dem dunklen Schacht nur deshalb so schnell überwunden, weil sie nicht alleine mit Ben hatte bleiben wollen.
Als dieser ihnen folgte, verlosch das Licht, das durch das Quadrat über ihnen fiel, und schließlich klappte auch die Falltür mit ohrenbetäubendem Lärm zu. Der Knall hallte von den Wänden wider und machte Mira bewusst, wie nahe diese waren. Sie streckte die Hand aus und berührte beinahe sofort schroffen Stein.
Ben knipste eine Taschenlampe an, und zu Miras Erleichterung fiel der Schein nicht zu allen Seiten auf Wände, sondern hinter Edmund Porter auch in die Öffnung eines weitläufigen Tunnels. Die Wände waren nackter Fels, und Feuchtigkeit glänzte auf ihnen. Auch die Luft war feucht und schwer. Sie legte sich auf Miras Gesicht und trieb ihr trotz der Kühle den Schweiß aus den Poren, kaum setzten sie sich in Bewegung.
Sie ging dicht neben Vera, und jeder Schritt schnürte ihr mehr die Luft ab. Wie lange würde dieses Treffen wohl dauern? Eine Stunde, vielleicht zwei? Mira war nicht sicher, ob sie es so lange in der Enge des unterirdischen Geheimverstecks aushalten würde. Schon jetzt hatte sie das Gefühl, nicht ausreichend Luft zu bekommen. Sie war heilfroh, dass sie nichts zu Abend gegessen hatte. Allein der muffige Geruch dieses finsteren Verlieses ließ die Galle in ihrem Hals aufsteigen.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.