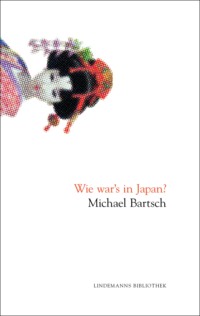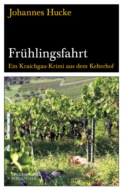Kitabı oku: «Wie war's in Japan?»

Für Chisako
Michael Bartsch hat in Hamburg, Genf und Freiburg Jura und Literaturwissenschaft studiert und wurde in Wirtschaftswissenschaften promoviert. Er ist Professor für Urheberund Medienrecht an der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe, unterrichtet Softwarerecht an der Universität Karlsruhe und arbeitet als Rechtsanwalt auf diesen Gebieten. Seine Liebe gehört der Literatur und der Musik.
Michael Bartsch
Wie war’s in Japan?

Wie war’s in Japan?
Das bin ich nach meinen zwei Reisen so oft gefragt worden, dass ich es hier zusammengefasst habe.
Japan ist interessant. Es gibt leider nur dieses nichtssagende Wort, um auf die Frage, wie es in Japan war, mit einem Wort zu antworten. Interessant bedeutet: sehr anders als Europa; sehr unerwartet; sehr uneinheitlich; sehr gespannt zwischen dem Alten und dem Neuen.
Japan ist nicht schön. Natürlich ist Japan doch sehr schön, was die Landschaft, die alten Gebäude – Tempel, Schlösser, Bauernhäuser – und viele Gegenstände der alten Lebenskultur – Lackwaren, Kimonos, Schriftbilder – angeht. Aber diese Dinge sind im Alltag kaum zu sehen. Zu sehen sind städtische Agglomerationen, die sich ewig hinziehen und die jedem Anspruch an Ordnung und Ästhetik widersprechen; das Gewirr der Verkehrswege, dreifach übereinander auf immer höheren Betonstelzen; Reklame überall.
Japan ist anstrengend, jedenfalls das öffentliche Leben. Überall viele Menschen, überall eilige Menschen. Wenn man in einem der riesigen Bahnhofsgewirre ein paar Stufen hochsteigt und auf die rennenden Leute schaut, bekommt man Augenflimmern. Die schwüle Hitze im Sommer wird durch rabiate Klimaanlagen kompensiert. In einem Lokal war die Anlage so stark gestellt, dass die Papierserviette vom Tisch wehte. Aber trotz des Rennens und Hastens haben die Leute keine verkniffenen oder aggressiven Mienen. Die Disziplin ist unantastbar. Die Eisenbahnwagen halten auf den halben Meter genau; der Bahnsteig ist beschriftet; jeder weiß, wo er sich anzustellen hat. Man muss die Japaner sehr bewundern für diese Zurückhaltung und Gelassenheit.
Japan ist kurios. Alles ist hier verpackt, viele Sachen zweimal. In einem kleinen Supermarkt haben wir zwei kleine Mohrrüben in einer Plastikumhüllung mit ausführlicher Beschriftung gesehen. Kurios sind auch die Uniformen. Das Personal der Schnellzüge ist feiner gekleidet als die Jumbojet-Piloten der Lufthansa. Die Männer auf dem Rollfeld des Flughafens haben militärische Uniformen an mit Streifen, Schultergurten und Helmen, alles ein bisschen übertrieben, aber nicht auf die italienisch-operettenhafte Art, sondern ins männlich-militärische gezogen, also die Helme und Mützen etwas zu groß, der Schultergurt zwecklos. Sie sehen aus unserer Perspektive, von oben aus dem Ankunftsgebäude, wie Playmobil-Figuren aus. Überhaupt lieben die Japaner Uniformen.
Japan ist höflich. Die Grobheit der äußeren Erscheinung des Landes, vor allem diese Architektur, die Menschenfülle und das Tempo, mindern die japanische Höflichkeit durchaus nicht. Auf Höflichkeit ist jederzeit Verlass.
Japan ist überraschend. Die Japaner als die Preußen Asiens? Weit gefehlt. Preußisch-exakt sind die öffentlichen Verkehrsmittel. Schon der private Autoverkehr läuft sehr unpreußisch. Vorfahrt hat das größere Auto. In vielen Lokalen, in den kleingewerblichen Betrieben und Handwerkstätten geht es eher südfranzösisch als preußisch zu; in Behörden auch. Japan ist zumeist von sorgloser und dauerhafter Unaufgeräumtheit; neben einem schön herausgeputzten Einfamilienhaus lagert lange schon rostiger Schrott. An einem Haus ist das Regenfallrohr undicht, seit Jahren, die Wand ist schwarz und unten schon bemoost. Viele Häuser sind in einem Zustand wie alte, sehr lange getragene Kleidung; nicht zerlumpt, aber mit Patina.
Japan ist beeinträchtigend. Man ist in dieser Welt der fremden Schriften wieder Analphabet. Man wünscht sich japanische Stille, aber in den großen Einkaufszentren gibt es dreierlei Musik: die allgemeine Beschallung im japanischen Stil, die Abteilungsmelodie, die in der Gemüseabteilung anders ist als bei den Schreibwaren, immer dieselbe kleine Schnulze, und dann die Sondermusik für einzelne Verkaufsaktionen, die aus Videoapparaten quillt.
Japan ist angenehm. Man fühlt sich immer sicher. Es gibt keine Unfreundlichkeit oder Unhöflichkeit von Personal; wer einen Dienst zu leisten hat, tut dies auf eine Weise, von der man hier nur träumen kann. Wer etwas gibt oder nimmt, wer bittet oder dankt, tut dies mit einer Handbewegung von solcher Eleganz, dass der humane Kern dessen, was Höflichkeit ist, aufs Schönste zu sehen ist.
Japan ist gesund. Das Essen ist viel gesünder als bei uns. Man sieht das den Japanern an, vor allem den älteren.
Mit einer japanischen Ehefrau Hochzeitsreise nach Japan zu machen, ist ein privates Glück und ein touristischer Vorteil. Man kommt an Orte und in Situationen, die Touristen kaum zugänglich sind. Man wohnt in einer Familie. Man sieht außer bei den Hauptsehenswürdigkeiten keine Europäer. Die Hauptpersonen dieser Aufzeichnungen sind deshalb meine Ehefrau Chisako und meine Schwiegereltern Reiko und Hitoshi als unsere Gastgeber, denen ich sehr dankbar bin.
Stadtbilder
Von japanischem Städtebau, von japanischer Architektur zu sprechen, ist falsch. Besser spricht man von Nicht-Planung und Nicht-Architektur. Gäbe es hier ein Büro für Stadtplanung und noch das alte kaiserliche Rechtssystem, so könnte man sich die Strafen für die Stadtplaner nicht grausam genug vorstellen.
Hier steht alles ohne die geringste Ordnung, ohne das geringste Konzept unvermittelt auf engstem Raum nebeneinander und durcheinander, das Alte (häufig sehr Ungepflegte) und das Neue; der Wohnblock, die Fabrik, die Tankstelle, der Tempel, das Einfamilienhaus, die Werkstatt, das Bürogebäude. Und alles ist übersät mit Reklame. Und alles ist mit einem wirren Netz an elektrischen Leitungen überzogen, die durch die Luft geführt werden, an Masten mit 10 oder 20 Kabeln. Es gibt keinen größeren Gegensatz als den zwischen dem durchschnittlichen japanischen Stadtbild und dem Garten eines japanischen Tempels.
Die langgestreckten Wohnblocks sind architektonisch so reizvoll wie ein DDR-Plattenbau. Aber die über die ganze Länge durchgezogenen Balkone mit Betonbrüstungen oder einfachen Metallgittern geben den Gebäuden italienisches Leben; überall ist Wäsche zum Trocknen aufgehängt, über den Geländern hängen Bettdecken.
Mitten in Tokio, einer Stadt mit höchsten Grundstückspreisen, stehen kleine zweistöckige Häuschen in ganz heruntergekommenem Zustand; die Fassaden altersschwarz; längs und quer sind Kabel angenagelt. Auf dem Innenstadtring der S-Bahn in Tokio wächst neben einem abbruchreifen, ungenutzten Häuschen eine Palme wie Unkraut. Wir sind mit dieser Ringbahn durch halb Tokio gefahren; ich ganz vorne an der verglasten Tür des Fahrers, die Kamera bereit, um auf dieser Strecke Eindrücke von Tokio zu fotografieren. Ich habe nicht ein Bild gemacht; es war alles zu trostlos.
Dabei hat das alte Japanische durchaus seine Bedeutung und seine Präsenz. Es gibt viele Wohnhäuser im alten Stil; sie stehen unvermittelt neben allem anderen, was sonst in Japan steht. Auch die Wohnhäuser, die im europäischen Stil gebaut sind, haben, vielleicht unbewusst, charakteristische Züge der alten Architektur bewahrt. Sie liegen gern etwas erhöht hinter einer Mauer, die das Grundstück zur Straße abtrennt, ein wenig geschützt wie eine Burg. Die Eingangssituation hat ihr Modell in den alten Samurai-Häusern. Dazu gehört die Mauer, die den Eingang eingrenzt, und hinter der Mauer wächst ein typisch japanischer Baum. Die Häuser betonen einen Absatz zwischen Erdgeschoss und erstem Obergeschoss, dem in der alten Architektur ein Rücksprung der Fassade entspricht, und haben nach altem Brauch in viele Teilflächen gegliederte Dächer.
Wo Japan das alte ästhetische Bewusstsein hat, sind die Ergebnisse großartig. Das Ryokan, das im Kapitel „Höflichkeit“ vorkommt, ist ein ganz neues und modernes Gebäude; zu den Baumaterialien gehören Stahl, Glas und Beton. Nichts ist so geformt, wie es früher geformt wäre; nichts ist historisierend. Die Dinge sind neu, aber die in ihnen wohnende Ästhetik ist alt, eine Ästhetik, die dem Bewohner ein Grundgefühl gibt, das man vielleicht mit den Worten ruhig, unaufdringlich, naturnah beschreiben kann und das auch aus dem Fehlen von Zierrat und Ornament herrührt.
Bei einem Spaziergang sehen wir zwei Männer in weißen Overalls, Firmenaufdruck auf den Rücken. Sie sitzen auf Leitern und arbeiten fleißig und fachkundig. Sie haben Gürtel mit den notwendigen Werkzeugen umgeschnallt. Als wir nach einer Stunde wieder bei ihnen vorbeikommen, stehen die Leitern an einem etwas anderen Platz, und die Männer arbeiten weiterhin. Sie putzen, beschneiden und richten einen Baum in einem Vorgarten. Die Pflanzen, die uns als so japanisch ins Auge fallen, sind Kunstprodukte. Der Gärtner zwingt ihnen seinen stilistischen Willen auf. Bonsai-Pflanzen sind nur die zimmertauglichen Ableger. Auch große Bäume werden durch Stangen und Seile in Form gebracht und gehalten, mit Sorgfalt geputzt und geschnitten. Das Ergebnis ist so naturfern wie der Garten von Versailles, erscheint uns aber als eine Art höherer Natur, so wie ein Baum aussähe, wenn er feines japanisches Stilgefühl hätte.
Im Überblick und aus einer gewissen Entfernung hat das Land dann Einheitlichkeit. Man sieht vom Zug aus das gleichmäßige Durcheinander der Gebäude; ein Reisfeld, das bis an die Fabrik herangeht; zwischendrin ein Wohnhaus im altjapanischen Stil; riesige Drahtkäfige – Abschlagplätze für die Golfspieler; Werkstätten, Büros, enge Reihenhäuser.
Das alles, soweit die Ebene geht. Die Hügel sind bewaldet und unbesiedelt, obwohl das Land so knapp ist; nach alter Überzeugung wohnen auf den Hügeln die Götter.
Höflichkeit
Eine Szene: Wir sind in einem Ryokan, einem traditionellen japanischen Landhotel. Das Zimmermädchen bringt uns in unser Zimmer und zeigt und erklärt uns alles. Jetzt geht es darum, ihr das Trinkgeld zu geben. Es befindet sich in einem mitgebrachten Briefumschlag. Das Zimmer ist von dem Vorraum, in dem man die Schuhe lässt, durch eine Schiebetür abgetrennt, einen Holzrahmen mit feinem Holzgitter und Japanpapier. An dieser Grenze zwischen innen und außen findet die Szene statt. Beide Frauen knien einander gegenüber und verbeugen sich mehrfach, sie sprechen Höflichkeitsformeln. Chisako legt den Umschlag hinüber. Das Zimmermädchen erklärt, ihn nicht nehmen zu können, verbeugt sich weiterhin, Chisako ebenfalls und schließt nach einiger Zeit dabei die Schiebetür. Erst jetzt, ungesehen, kann das Zimmermädchen den Briefumschlag nehmen und gehen.
Höflichkeit ist das Benehmen bei Hofe. Hierfür gibt es ein Regelwerk, seit der Hof in die Stadt gezogen ist, der Adlige also nicht mehr als Ritter draußen auf der Burg lebte und auf der rauhen Bärenhaut lag, sondern ins Stadtschloss zog. Hier war er Herrscher wie zuvor, aber im Rahmen einer städtischen Kultur.
Das geschieht in Europa zuerst in Oberitalien, und dort entsteht die Fachliteratur. Castiglione schreibt „Il libro del cortegiano“, das für Europa auf lange Zeit maßgebliche Buch, alsbald auch ins Deutsche übersetzt: „Der Hofmann“. Es ist ein Ausgleich zu finden zwischen der aus der Ritterzeit stammenden Gefolgstreue der Adligen, die nicht mehr der Lebenslage und der Intellektualität entspricht, und der frühen städtischen Bürgerlichkeit, die zum Prinzip der Gleichheit unter dem Aspekt der Kultur tendiert. Der Fürst muss auch hier Fürst bleiben, vorzugsweise dadurch, dass er in diesen neuen Herausforderungen im neuen Benehmen der Erste, der princeps ist, denn das alte Befehlen wäre unkultiviert.
Schwierig war das Spiel auch für die Adligen bei Hofe, denn ein Fehltritt konnte mit Verbannung enden, also mit sozialer Hinrichtung. Wer das Spiel der kultivierten Verfeinerung, das auf einer Fiktion der Gleichheit beruhte, nicht mitspielen konnte, war ein Bauer und sollte besser wieder auf sein Landgut gehen. Deshalb also die Notwendigkeit neuer Verhaltensnormen und, bei Castiglione nachlesbar, die Notwendigkeit einer Fundierung unterhalb der Etikette, durch das Bild eines Menschen, der erzogen wurde und sich selbst erzogen hat.
Auch in Japan ist offenkundig, dass die Höflichkeitsrituale vom Hofe stammen: der trippelnde Laufschritt der Angestellten in Behörden; die weißen Handschuhe der Busfahrer; überhaupt die besondere Bedeutung von Uniformen; die Tatsache, dass es in Japan kein korrektes Wort für „nein“ gibt; das besondere Verständnis von Ehre, freiwilliger, aber strikt verbindlicher Gefolgschaft und Einordnung.
Das Valeur, die Gestimmtheit der Szenen zwischen Auftraggebern und Dienstleistern (modern gesprochen) ist aber in Japan ganz anders höflich als zum Beispiel in Frankreich. Für mich zählt das Benehmen mancher Kellner in feinen Restaurants oder mancher Bankangestellten zur typisch französischen Höflichkeit. Sie halten alle Regeln ein, aber nicht aus Selbstzweck, sondern um sich damit die Freiheit zu nehmen, den Gast oder Kunden eine diffuse Verächtlichkeit spüren zu lassen, wie wenn man bei uns dauernd „Sehr wohl mein Herr, natürlich, sogleich mein Herr“ sagte. Vielleicht spielen sie unbewusst oder halbbewusst darauf an, dass es nach einer bürgerlichen Revolution keine Höflichkeit und kein Dienen im alten Sinne mehr geben könne, und karikieren dezent, was ihnen aufgegeben ist.
In allen japanischen Filmen und Büchern, die früheres oder herkömmlich gebundenes Leben zeigen, ist als Verhaltenskonstante die Distanz zwischen den Menschen zu sehen. Es ist ein Sichzurücknehmen. Vielleicht geht es nicht so sehr darum, dem anderen nicht weh zu tun, als darum, sich nicht selbst durch die eigene Ärgerlichkeit, die eigene ungezügelte Tat zu beschmutzen. Das wäre eher ein Aspekt der Ehre als ein Aspekt der Freundlichkeit.
Die Höflichkeit in Japan soll wirken wie ein Maschinenöl, das auch bei harter Last im Getriebe verhindert, dass die Metallteile sich berühren. Sie bleiben immer getrennt, und sei die Ölschicht auch noch so dünn. Eine unmittelbare Berührung wäre eine Beschädigung.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.