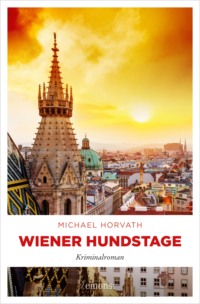Kitabı oku: «Wiener Hundstage», sayfa 4
Das Anwesen in Gumpoldskirchen bestand aus einem alten Vierkanthof, zwei oder drei Geräteschuppen und einer kleinen Schmiede. Ich konnte mich noch an einen großen, brummigen Schmied erinnern, zu dem die Bauern aus der Umgebung kamen, wenn eine Pflugschar gesprungen war. Dann heizte er die Esse an, schwang den klobigen Hammer und tauchte das glühende Metallblatt in einen Holztrog voll Wasser. Doch seit zwei Jahrzehnten blieb die Schmiede ungenutzt. Ein gepflegter Obstgarten mit Weinlaube und Gemüsebeeten gehörte ebenfalls dazu. Weiter außerhalb des Ortes gab es noch ein Pflegeheim, doch dorthin hatte es mich selten verschlagen.
Als Kind waren mir die Dimensionen riesig vorgekommen; der Garten war ein weitläufiger Park gewesen, in dem man sich verirren konnte. Als ich durch das Tor in den kühlen, schattigen Innenhof trat, wunderte ich mich wieder einmal darüber, wie sehr alles zusammengeschrumpft war.
Ein junger Geistlicher, den ich noch nie gesehen hatte, teilte mir mit, dass der alte Pfaffe anwesend war.
»Werden Sie erwartet?«, fragte er höflich.
Ich verneinte. Ich heftete mich an seine Fersen, als er lostrabte, um Dominik in seiner Klause aufzuscheuchen.
Er klopfte an die Tür, dann flüsterte er etwas in den Raum, und dann brummte eine Bassstimme: »… keine Zeit. Soll sich anmelden. Wir haben hier nicht Tag der offenen Tür.«
Der Geistliche drehte sich zu mir herum und hob bedauernd die Hände.
»Was ist«, rief ich laut. »Seit wann empfängt Don Camillo keine Ketzer mehr?«
Die Tür wurde ganz aufgerissen. Dominik schob seinen Adlatus mit einer Handbewegung zur Seite, als würde er Fliegen verscheuchen.
»Das gibt’s doch gar nicht«, dröhnte er. »Wenn man den Teufel nennt, kommt er gerennt!«
»… und er hat wirklich ›Akt der Toleranz gegenüber Andersdenkenden‹ gesagt?« Dominik wieherte erneut los und hielt sich den gewiss nicht unbeträchtlichen Bauch, der im Rhythmus seines Gelächters mitschwang.
»Du bist fett geworden«, sagte ich, nachdem er sich beruhigt hatte. Wir saßen in der Weinlaube auf Heurigenbänken und tranken kalten Messwein aus dickwandigen Henkelgläsern. Hier draußen war es merklich kühler als in der staubigen Stadt. »Ein feister, ausgefressener Pfaffe«, ergänzte ich genüsslich. »Wie Bruder Tuck.«
»Bruder Tuck wird dir gleich zeigen, wo Gott wohnt«, brummte er erbost und schnappte sich eine Handvoll Käse-Halasz, die er auf einen Sitz verschlang. »Aber ernsthaft, Bürschchen: Weißt du, wer heute Morgen bei mir anrief?«
»Immermann?«, schlug ich grinsend vor. Ich wusste, dass der Bischof auf Dominiks Werteskala noch tiefer rangierte als sein marianischer Kardinal. Etwa einen Kilometer tiefer.
»Nicht ganz«, sagte er, kaum ungehalten darüber, dass ich ihm die Pointe ruiniert hatte, und wiegte seinen massigen Schädel hin und her. »Aber schon recht gut. Der Anruf kam aus seinem Büro.«
»Mir fehlen die Worte.«
»Gott sei’s gedankt. Sie wollten wissen, wie lang ich dich kenne, was ich über deine Arbeit weiß, wie du’s mit der Religion hältst, ob ich dir in jungen Jahren die Beichte abgenommen habe, ob du – wie war das gleich? – seriös bist, als Journalist, du weißt schon.« Er steckte sich eine filterlose Gitane an, inhalierte mit sichtbarem Genuss und ließ den Rauch langsam durch die Nase entweichen. Nicht alles ist light in diesem Leben.
»Woher wissen die, dass wir befreundet sind?«
Dominik zuckte mit den mächtigen Schultern. »Weiß der Teufel … Es ist schon sehr merkwürdig, dass Immermann dir ein Interview vorschlägt. Das sieht ihm gar nicht ähnlich.«
»Apropos Interview«, begann ich vorsichtig. Ich hielt es für eine gelungene Überleitung. »Ich bin heute Günther Abfalter begegnet –«
Weiter kam ich nicht. Offensichtlich hatte ich von allen möglichen Wegen den schlechtesten beschritten. Blitzschnell veränderte sich Dominiks unbekümmerte Körperhaltung; er ähnelte jetzt einem Boxer, der zur finalen rechten Geraden ansetzt.
»Daher weht der Wind! Oh nein, Paul, vade retro – kein Wort mehr darüber!« Er hieb mit einer kindskopfgroßen Faust auf den Tisch, dass die Gläser wackelten.
»Nimm Rücksicht auf mein Trommelfell«, warf ich ein. »Alles, was ich von dir wissen will, ist …«
»… was mir Abfalter während der Beichte gesagt hat. Vergiss es.« Er trank sein halb volles Glas leer und schenkte sich nach, ohne mich zu bedenken. In der Nachbarschaft krähte ein Hahn. Vielleicht hatte Dominiks Stimme sein Zeitgefühl durcheinandergebracht.
»Du verstehst mich falsch. Es ist mir wichtig, dass –«
»Ich versteh dich sehr gut. Glaubst du, du bist der Erste, der es versucht? Jeder männliche Journalist in Österreich würde sein rechtes Ei dafür hergeben.«
Wider Willen musste ich lachen. Und während ich lachte, wuchs die Wut über so viel Sturheit.
»Du bist sexistisch«, sagte ich. »Was ist mit den Frauen?«
Er grunzte.
»Sei so gut und hör mir zu, ohne Rambo in Kutte zu spielen.«
»Nein«, sagte er und zielte mit seinem dicken Zeigefinger auf meine Nase. »Du hörst mir zu, Paul. Du bist, wie gesagt, nicht der Erste, der das wissen will, und du kriegst die gleiche Antwort wie die Kleine, die die ganze Sache aufgebracht hat, und alle anderen aus eurer blöden Branche. Die Antwort heißt: Beichtgeheimnis.«
Abermals krähte der Hahn.
»Du sturer Hund«, rief ich, »ich will nicht, dass du dein Schweigegelübde brichst. Sag mir nur: ja oder nein.«
»Ja oder nein was?«
»Wenn Abfalter gelogen hätte – immer vorausgesetzt, er weiß, was er sagt …«
»Er weiß, was er sagt.«
»… also wenn er gelogen hätte, dann wüsstest du das jetzt.«
»Ja.«
»Ja, er hat gelogen?«
»Ja, ich wüsste es.«
»Weißt du’s?«
»Beichtgeheimnis.«
»Auch dann noch, wenn es um Mord geht?«
»Wie?«
»Liest du keine Zeitungen?«
»Nicht, wenn es sich vermeiden lässt.«
Ich schenkte mir nach und sagte ohne besondere Betonung: »Sarah Ortbauer ist ermordet worden.«
»Scheiße«, sagte Dominik, und schließlich: »Sie ist vor ein paar Monaten hier aufgetaucht und hat mir dieselbe Frage gestellt.«
»Und dieselbe Antwort erhalten.«
»Na klar. Letzte Woche hat sie mich angerufen. Da wollte sie wissen, ob mir eine Organisation namens ›Gladius Domini‹ geläufig ist.«
»Und?«
»Nie davon gehört.«
Und da witterte ich etwas. »Wie war noch einmal der Name?«
»Gladius Domini.«
Toms Telefonanruf … Er hatte nicht »Radius Hominis« gesagt, sondern »Gladius Domini«.
»Was wollte die Ortbauer sonst noch, Dom?«
»Das war’s auch schon. Oder warte. Sie erwähnte einen Namen … jemand, mit dem sie sich treffen wollte. Und ob er mir bekannt sei. Ein polnischer Name: Daszyński. Ja, ich glaube, das war der Name. Daszyński.«
Um einundzwanzig Uhr dreiundzwanzig kam ich am Schwedenplatz an und ging den Rest meines Heimwegs zu Fuß. Es war noch nicht dunkel, und die schwüle Stadtluft hüllte mich ein in eine stinkende, schweißtreibende Umarmung, die unwillkommener nicht hätte sein können. Den Abend verbrachte ich auf der Couch lümmelnd in meinem Wohnzimmer, in das Pressematerial über Immermann vertieft, das ich schließlich gegen Karlheinz Deschners gesammelte Werke eintauschte, um meinen Aggressionspegel noch ein wenig anzuheben. Ich trank Tee, rauchte drei Zigaretten und rief ein paar Leute an, unter anderem Sergej Markow, der mich für morgen zum Mittagessen einlud. Kurz nach Mitternacht schwirrte mir der Kopf, und ich warf mir die Jeansjacke über die Schulter, um dem jungfräulichen Tag meine Reverenz zu erweisen.
Die Luft war abgestanden, staubig und angereichert mit den Ausdünstungen eines langen, betriebsamen Tages, und sie führte eine zähe Feuchtigkeit mit sich, die das Atmen beklemmend machte. Ich drehte eine Runde durchs Karmeliterviertel, geriet auf die Hollandstraße und wandte mich stadteinwärts. Der Morgen steckte in den Kinderschuhen, und es sprach viel für ein einsames Bier im »Café Piccolo«, weshalb ich vor der Salztorbrücke links abbog und zielstrebig in Richtung Gredlerstraße marschierte. Doch als ich vor dem »Piccolo« stand, verlor ich mit einem Schlag alle Lust, meine Nase den rauchdurchzogenen, beißenden Küchendämpfen auszusetzen. Ich trat wieder auf die Taborstraße und spielte mit dem reizvollen Gedanken, nach Hause und ins Bett zu gehen, als ich bemerkte, dass die Fenster der kleinen Rive-Gauche-Buchhandlung noch hell erleuchtet waren. Und das brachte mich auf eine Idee.
Die Rive-Gauche-Buchhandlung war, wenn man aus dem Namen Schlüsse ziehen konnte, eine von der linken Sorte; ein Flussufer, an dem man nicht von vornherein nach kirchlichen Themen suchen würde. Andererseits sind ja GOttes Wege erwiesenermaßen unergründlich.
Mein Interesse hatte ein unscheinbarer Band in der Auslage geweckt. Er trug den Titel »In den Himmel kommen wir alle – Gespräche mit österreichischen Bischöfen« und war von der Machart her genau zwischen Buch und Broschüre angesiedelt. Der Autor hieß Heinz Kopetzky, und das Ganze roch geradezu nach Eigenverlag, handkopiert, Auflage achtzig Stück. Was wahrscheinlich zu hoch angesetzt war.
Ich klopfte ein paarmal an die Tür und spähte durch die Scheibe ins Innere. Gut vierzig Leute waren auf engem Raum versammelt und unterhielten sich über Weingläser mit rotem oder weißem Inhalt hinweg. Ich entdeckte kein bekanntes Gesicht, bis sich aus der wimmelnden Menge ein Mann in schwarzem Jeansanzug löste; er kam auf mich zu und sperrte auf. Ein Lärmballon zerplatzte über mir.
Ich sagte: »Ich würde gerne dieses Buch kaufen.« Dabei deutete ich auf die »Gespräche«.
»Nur, wenn Sie ein Glas Wein mit uns trinken.«
»Sonst nicht?«
»Sonst nicht.«
Der Mann war nicht ganz einen Meter achtzig groß. Er trug eine Art Che-Guevara-Bart und die dazugehörige Frisur, dichtes, schwarzes, halblanges Haar, in das sich einige verfrühte Silberfäden eingeschlichen hatten. Havanna und Barett fehlten, stattdessen trug er eine Brille mit Stahlgestell.
Ich sagte: »Das ist Nötigung zum Alkoholismus.«
»Genau«, antwortete er. »Aber damit dürfte ein geprüfter ›Magistrat‹-Stammgast keine Probleme haben.«
Dem war nichts entgegenzusetzen, also trat ich ein und drückte ihm die Hand.
»Versuchen Sie Ihr Glück in der Küche«, rief er mir nach.
Ich drängte mich auf der Suche nach dem Buffet vorsichtig an Menschentrauben vorbei, stets darum bemüht, niemandem das Glas aus der Hand zu schlagen. Mazurka, der Menschenfreund. Nach einem rekordverdächtigen Slalomlauf gelangte ich in den hinteren Teil des Geschäfts, passierte eine Schwingtür, deren Flügel ich in echter Grenzermanier hinter mir zupendeln ließ, und versorgte mich in einer viel zu engen Küche mit trockenem Weißen. So bewaffnet, warf ich mich ins Getümmel.
Ein Ellbogen stieß gegen meine Schulter, und eine weibliche Stimme murmelte: »Entschuldigung.«
Ich machte eine halbe Drehung und stand einer jungen rothaarigen Frau gegenüber, die mit einem schrägen Grinsen viel Weiß zeigte, während sie mit zwei Fingern auf die Brusttasche meiner Jacke tippte.
Sie sagte: »Schenken Sie mir eine Zigarette?«
Ich nickte, suchte mit den Augen eine Abstellfläche für mein Glas, fand keine und löste das Zigarettenproblem einhändig. Dann schüttelte ich eine zweite aus der Packung, zwickte sie mit den Lippen ein und warf das Zippo an.
Nach dem ersten Zug verzog sie den Mund. »Das schmeckt ja grässlich«, sagte sie.
»Kommt darauf an. Manche mögen den Benzingeschmack.«
Sie unterzog mich über den Rand ihres Glases hinweg einer kurzen Musterung, die möglicherweise zu ihrer Zufriedenheit ausfiel, und sagte lächelnd: »Ich denke, Sie sehe ich zum ersten Mal.«
»So ist es. Arbeiten Sie hier?«
»Nicht mehr. Ich habe früher hin und wieder ausgeholfen und damit mein Studium finanziert, doch jetzt fehlt mir die Zeit. Aber ich bin Stammkundin. Im Gegensatz zum Großteil der reizenden Leute, die Sie hier sehen. Die kommen nämlich eher zum Plaudern als zum Einkaufen her. Bei Kaffee oder Wein, je nach Tageszeit und Verfassung.«
»Das klingt ein bisschen boshaft.«
»Soll es auch.« Sie nickte bekräftigend. »Es ruiniert das Geschäft. Der Inhaber ist mittlerweile so hoch verschuldet, dass er jederzeit den Ehrenvorsitz im Verein der Pleitiers und Bankrotteure einnehmen könnte. Aber lassen wir das Thema. Wie heißen Sie übrigens?«
»Mazurka. Paul Mazurka.«
»Lustiger Name.«
»Finden Sie?«
»Ich heiße Christa Kramer. Trinken wir noch etwas?«
»Warum nicht?«
Sie ergriff mein Glas und schob sich geschmeidig durch einen lebenden Vorhang, der hinter ihr wieder zusammenging. Ich zog ein letztes Mal an der Zigarette, ließ sie unauffällig zu Boden fallen und beobachtete das Treiben, als ich eine melodiöse Männerstimme meinen Namen rufen hörte. Ich wandte den Kopf und sah Hanns Lex Streu auf mich zusteuern. Er leitete eine der drei Wiener Buchhandlungen, die ich regelmäßig heimsuchte.
»Was machst du hier?«, fragte ich, während wir uns die Hände schüttelten. »Hast du vor, zur Konkurrenz überzulaufen?«
»Bin ich lebensmüde? Der einzige regelmäßige Kunde ist hier der Exekutor!«
Nachdem er mir ausführlich dargelegt hatte, wie tief in den roten Zahlen die Buchhandlung stand und dass er ihr zwei, allerhöchstens drei Monate bis zur endgültigen Schließung gebe, sagte ich, mit dem rechten Zeigefinger auf meinen »Café Magistrat«-Bekannten deutend: »Kennst du den Mann an der Kassa?«
»Klar«, sagte Hanns, »das ist Heinz Kopetzky, Inhaber und Geschäftsführer in Personalunion. Der Mann mit den hohen Schulden. Schreibt für den ›Freigeist‹.«
»Wie war der Name?«
»›Der Freigeist‹. Nie gehört? Ein Journalist mit deiner Tendenz sollte doch –«
Er wurde von Christa Kramer unterbrochen, die mir ein volles Weinglas überreichte. Diesmal war es Rotwein.
Ich stellte sie einander vor, dann hakte ich nach: »Was ist das für ein Blatt?«
Hanns strich sich über den kurz geschorenen Hinterkopf und zog die Stirn in Dackelfalten. »Hmmm … wie wär’s damit: aufklärerisches Kleinforum für notorische Pfaffenhetzer mit polemischem Charakter, niedriger Auflage und vierteljährlichem Erscheinungsrhythmus, der immer dann eingehalten wird, wenn die Schreiber pünktlich abgeben, also nie?«
Ich grinste und sagte: »Ich brauche Informationen über Immermann.«
»Den Bischof? Dann ist Kopetzky der Richtige für dich.« Er warf einen Blick auf die Uhr. »Ich muss gehen«, sagte er. »Wir sehen uns, Paul.«
Christa Kramer sah mich neugierig an. »Was haben Sie denn mit dem Bischof vor?«
»Nichts Schlimmeres als ein Interview. Sie nehmen’s mir doch nicht übel, wenn ich mich jetzt verabschiede? Ich will sehen, ob Kopetzky etwas für mich tun kann. Vielleicht gehen wir nächste Woche gemeinsam essen?«
»Ich habe einen eifersüchtigen Freund.«
»Was haben Sie eigentlich studiert?«
»Sie werden es nicht glauben: Ich bin Anwältin.«
»Großartig. Hoffentlich sind Sie gut, dann kann ich Sie nach meinem nächsten Mord konsultieren.«
Nachdem wir Visitenkarten ausgetauscht hatten, legte sie mir ihre Hand auf den Arm und sagte, nahe an meinem linken Ohr: »Kommen Sie, ich will Sie mit Heinz bekannt machen.« Sie trug ein Parfum, das zu ihr passte, als wäre es exklusiv für sie angefertigt.
Kopetzky hatte seinen Standort am Kassenpult nicht verlassen; er befand sich in angeregtem Streitgespräch mit einer kleinen Gruppe dunkelhäutiger Tequilatrinker. Die Sprache, in der sie stritten, war Spanisch; ein Spanisch mit eindeutig lateinamerikanischem Einschlag.
»Mazurka?«, sagte Kopetzky und zog die Augenbrauen hoch. »Wen man nicht alles im ›Café Magistrat‹ kennenlernt. Haben Sie nicht mit Deschner …«
»Genau«, sagte ich.
»Und worum geht es diesmal?«
»Um Immermann.«
Er stutzte, dann feixte er. »Der hat sich doch aus der Medienwelt zurückgezogen und grollt allen gottlosen Journalisten. Wie haben Sie denn das geschafft?«
»Überhaupt nicht. Der Vorschlag kam von ihm selbst.«
»Es geschehen noch Zeichen und Wunder. Wo soll das Interview erscheinen?«
»Im ›Freien Wort‹.«
»Netter Witz.«
»Kein Witz. Die haben mich angerufen.«
In Kopetzkys Gesicht rührte sich etwas, das schließlich seine Augen erreichte und glitzerte. »Ihr Ernst?«, fragte er.
»Mein voller Ernst.«
»Warten Sie eine Sekunde«, sagte er.
Er verschwand für ein paar Minuten im Gewühl. Als er zurückkam, trug er einen Stapel Bücher und Zeitschriften, die wir gemeinsam durchgingen. Einiges kannte ich bereits, doch das meiste war mir neu. Als wir bei seinem Buch angelangt waren – »Gespräche mit österreichischen Bischöfen« –, sagte Kopetzky: »Ich habe mit fast allen gesprochen. Allen außer Immermann.« Nach einer kurzen Pause fügte er hinzu: »Und Kardinal Grunert natürlich.«
»Tolle Ausbeute«, sagte ich, nachdem er mir die Rechnung gemacht hatte. »Nur hab ich nicht genug Geld dabei.«
»Macht nichts. Zahlen Sie’s beim nächsten Mal.«
»Ich bin in zwanzig Minuten wieder da«, bot ich an.
Aber davon wollte Kopetzky nichts wissen. »Sie haben viel vor für heute«, sagte er lächelnd. »Und übrigens: Wenn die Ihr Interview im ›Freien Wort‹ abdrucken, lass ich mich taufen.«
Als ich eingeschlafen war – irgendwann nach vier Uhr früh –, geisterten Begriffe wie Synode, Infallibilität, Glaubensgewissheit und Trinität durch meine Träume. Ich lief durch lange dunkle Gänge, die nach Moder rochen und pulsierten wie der Verdauungstrakt eines hypertrophen Leviathans. Ich wurde verfolgt von neun gesichtslosen Kuttenträgern, die in der Rechten einen Hammer hielten und in der Linken Spanische Stiefel, und sie riefen mit dünnen, hohlen Vogelstimmen: »Summis desiderantes affectibus.«
Mittwoch
Schwarzmantel
Ein Diktafon ist eine ungeheuer praktische Sache. Es ist klein, es ist leicht, und man kann es ohne besondere Anstrengung sogar in die Brusttasche eines Sakkos zwängen. Es wird mit zwei Batterien gefüttert und geht ausgesprochen sparsam damit um, sieht rundum erfreulich aus, und, was das Beste ist, es erspart einem das leidige Mitschreiben bei Interviews. Ich habe diese kleinen Kästchen richtiggehend lieb gewonnen und könnte mir ein Leben ohne sie gar nicht mehr vorstellen. Man stellt die Maschine auf den Tisch, drückt einen Knopf, schaut seinem Gegenüber tief in die Augen und redet einfach drauflos. Zu Hause ruft man es ab, wieder nur ein Knopfdruck, genießt die eigene Eloquenz und mehr noch die peinlichen Ausrutscher des Gesprächspartners und tippt das Ganze in den Blechtrottel, so, wie’s aus dem Kopfhörer fließt. Das nennt man dann sorgfältig redigiertes Interview. Ein Instrument also, das seinem Erfinder den Nobelpreis hätte einbringen müssen. Es hat eigentlich nur einen Nachteil: Im entscheidenden Moment versagt es den Dienst. Ich habe bereits vier davon auf den Mist geworfen; dieses war Nummer fünf.
Während ich damit beschäftigt war, das bänderfressende kleine Monstrum zu verfluchen, klingelte das Telefon. Langsam hatte ich das Gefühl, nur mehr mit früh aufstehenden Telefonsüchtigen zu tun zu haben.
»Hab ich Sie geweckt?«, fragte Franjo Bregović.
»Keineswegs. Ich bin hellwach und zu allem bereit.«
»Ich möchte Ihnen gerne jemand vorstellen. Jemand, der Ihnen vielleicht weiterhelfen kann.«
»Wann und wo?«
»Kennen Sie das Quartier Latin?«
»Die Handvoll Lokale am Donaukanal? Nur vom Hörensagen und Vorbeigehen. Die gibt’s noch nicht so lang, oder?«
»Seit etwa drei Monaten. Ist Ihnen achtzehn Uhr recht?«
»Ja. Und in welchem?«
»Wie wär’s mit dem Boot?«
»Ah. In Fachkreisen als das Saufboot bekannt.«
»Das war einmal. Jetzt wurde es neu hergerichtet, heißt ›La Caleta‹ und ist auf höllisch gute Cocktails spezialisiert.«
»Wo ist der Unterschied?«
»Ich würde sagen, jetzt ist es mehr ein drinkboat.«
»Eine feine Differenzierung. Haben wir dort genug Ruhe zum Reden?«
»So früh am Abend sicher.«
»Ich werde hinkommen.«
Auf dem Weg zum Erzbischöflichen Palais suchte ich eine Niedermeyer-Filiale auf. Der Verkäufer lag mir eine Zeit lang mit verkaufsförderndem Gewäsch in den Ohren, bis er mich so weit hatte, dreihundert Schilling mehr als geplant über den Ladentisch wandern zu lassen, um ein Diktafon zu erstehen, »das Sie so schnell nicht im Stich lassen wird, ehrlich, und sehen Sie, die Benutzerfreundlichkeit, alles mit nur einer Hand, und dann die Extras, zum Beispiel …«.
Im »Daniel Moser« ließ ich mir einen Toast und einen Espresso bringen, testete meine Neuerwerbung, rauchte eine Zigarette und betrachtete die geschäftige Rotenturmstraße. Ich schlug den aktuellen »Kurier« auf und überflog ihn. Und blieb gleich am Anfang hängen. Eine kurze Meldung gab bekannt, dass der Sekretär des Kurienbischofs Jakob Roder beim Überqueren der Wienzeile einem Verkehrsunfall zum Opfer gefallen sei. Der Pkw-Lenker habe Fahrerflucht begangen; der Sekretär sei noch auf der Fahrt ins Unfallkrankenhaus Meidling verschieden. Jakob Roder sagte mir überhaupt nichts, doch den Namen des Sekretärs hatte ich irgendwo gelesen. Daszyński. Pawel Daszyński. Nein. Halt. Ich hatte den Namen nirgends gelesen – Dominik hatte ihn erwähnt. Daszyński war der Mann, den Sarah Ortbauer kurz vor ihrer Ermordung aufsuchen wollte. Und der wurde zwei Tage später Opfer eines tödlichen Unfalls mit anschließender Fahrerflucht. Was für ein bemerkenswerter Zufall.
Um zehn Uhr fünfzig zahlte ich, stand auf und nahm Kurs auf die Wollzeile. Ich umging eine Ansammlung, die sich vor einer Ausspeisung, wo man schlechte Pizza per Laufmeter kaufen konnte, gebildet hatte, und hielt vor einem großen dunklen Holztor, das jetzt geöffnet war. Dahinter war ein Eisengitter zu sehen und dahinter ein friedlicher Innenhof, der die Freuden klösterlichen Lebens heraufbeschwor. Auf der linken Seite schützte eine Glaswand den Hausmeister der Erzdiözese vor den Unbilden der Witterung. Neonlicht erleuchtete seinen Koben, der mit einer Eins-a-Telefonanlage und mehreren Monitoren ausgestattet war. Die Segnungen des Fortschritts hatten auch hier Einzug gehalten.
Ein kleiner uniformierter Mann mit rotem Gesicht und einer Trinkernase, auf der sich Schweißperlen festgesetzt hatten, stürzte heraus und schnarrte: »Eintritt verboten!«
Ich erklärte ihm, dass Bischof Immermann meiner harrte. Er glaubte es nicht. Es kostete nicht übermäßig viel Überzeugungskraft, bis er so weit war, einen Anruf zu riskieren. Ich sah seinen ausdrucksvollen Pantomimen durch die Glaswand zu. Schließlich betätigte er irgendeinen verborgenen Schalter, und das Gittertor schwang auf. Er sprang wieder heraus, wieselte auf mich zu und erklärte mir den Weg. Ich verstand kein Wort. Er durchsuchte mich nicht nach Waffen. Davon abgesehen arbeitete der Sicherheitsdienst der Erzdiözese einwandfrei und fehlerlos.
Ich ging über den Hof, stieg ein paar Treppen hoch, durchwanderte einige Kilometer Korridor und kam zu dem Schluss, dass die Angestellten dieser Firma gewiss gut in Form waren. Verschwitzt erreichte ich um zehn Uhr achtundfünfzig die Tür zum bischöflichen Sekretariat, klopfte an und trat, als keine Aufforderung kam, kurzerhand ein.
Ein gut gekleideter Herr sagte: »Einen Augenblick, bitte«, zog eine randlose Brille mit Goldbügeln von der Nase, legte sie auf einen Tisch, dessen Schreibfläche kaum größer war als ein durchschnittliches niederösterreichisches Zuckerrübenfeld, erhob sich nonchalant, öffnete eine Tapetentür und verschwand dahinter.
Ich sah mich um. Es war ein sehenswertes Büro, hell und großzügig, spärlich mit gediegenen, wahrscheinlich antiken Holzmöbeln eingerichtet. Hier konnte man sich wohlfühlen.
Der Mann kam wieder zurück. Er hatte erdnussbraunes, kurz geschnittenes, glattes Haar, das er straff nach hinten gebürstet trug. Er sah aus wie ein Manager. Vielleicht war er einer. Mit einer einladenden Geste forderte er mich auf, in einem Lederfauteuil Platz zu nehmen. Ich zog ein Päckchen Zigaretten aus der Brusttasche meines Jeanshemds. Er blickte auf und sagte: »Bitte, rauchen Sie nicht. Seine Exzellenz leidet unter einer Sommergrippe.«
Ich steckte die Packung wieder weg.
Wir warteten. Die Sekunden zogen vorbei wie eine Herde Kühe, träg und ziellos und ohne sich was dabei zu denken. Dann kam er, pünktlich auf die Minute. Ein schwarzer, bodenlanger Talar hüllte seine wohlgenährte Figur ein. Er hielt den Kopf leicht gesenkt, wie es einem Diener des HErrn wohlansteht. Der Kopf war rund, kahl und rosig. Pausbacken gaben dem runden Gesicht einen harmlosen Ausdruck, der durch einen gespitzten kleinen Mund noch verstärkt wurde. Der Mund sah aus, als würde er immer nur Teddybären küssen wollen. Nur die Augen gefielen mir nicht. Sie waren klein, wässrig und wimpernlos, versteckten sich in zwei fetten Hautfalten. Sie bewegten sich mit der Vorsicht und dem wachsamen Misstrauen von Irokesen auf dem Kriegspfad.
Der elegante Herr war aufgesprungen und scharwenzelte um Immermann herum wie ein alter, treuer Airedale Terrier um seinen Herrn. Ich erhob mich, deutete eine Verbeugung an und sagte mein Sprüchlein auf. Lächelnd nickte Seine Exzellenz, nahm mich jovial beim rechten Ellbogen und führte mich in das Zimmer hinter der Tapetentür.
Er sagte: »Es freut Uns sehr, dass Sie sich freimachen konnten und Unserer Bitte nachgekommen sind. Setzen Sie sich doch, junger Mann.«
Ich setzte mich an einen Couchtisch, dessen Oberfläche mit zarten Intarsien verziert war, packte Diktafon und Notizblock aus und wartete.
»Was halten Sie von einer Tasse Kaffee?«
»Viel«, sagte ich.
Immermann ging zu seinem Schreibtisch, flüsterte ein paar Worte in die Gegensprechanlage und kam wieder zurück. Keine Minute später brachte der elegante Herr ein Tablett mit Zuckerdose, Milchkännchen und zwei Porzellanschalen und stellte es auf dem Tischchen ab.
Nach kurzem einleitenden Phrasendreschen sagte ich, dabei den Aufnahmeknopf betätigend: »Sie halten den Kardinal nach wie vor für das Opfer einer Verleumdungskampagne. Was spricht dann gegen eine Untersuchung des Falls Grunert?«
»Sehen Sie, für mich ist der Kardinal unschuldig, da brauche ich gar keine weiteren Beweise.«
»Heißt das, dass Günther Abfalter in Ihren Augen ein Lügner ist?«
»Ich würde sagen, ein kranker Mensch, der den Bezug zur Realität verloren hat. Unsere Zeit, die sich vom Pfad des Glaubens und Gehorsams vor GOtt abgekehrt hat, bringt viele zerstörte Seelen hervor; das ist eine Tatsache, die sogar durch Ihre allwissenden Statistiken belegt wird.«
»Hm ja, gewiss. Aber sind es – in diesem wie in vielen anderen Fällen – nicht gerade Ihre Kirche und deren Repräsentanten, die die Menschen krank machen?«
»Schaun Sie, junger Mann, auf dieser Ebene bin ich nicht bereit, mich mit Ihnen zu unterhalten. Hier geht es doch um ganz andere Dinge.«
»Wie zum Beispiel?«
»Ein angesehener, rechtschaffener und treuer Diener der Kirche ist denunziert und verleumdet worden, da haben die Medien und Sie alle mitgespielt, ohne die Gerechtigkeit, die Sie so gern für sich in Anspruch nehmen, auch für Kardinal Grunert gelten zu lassen. Und da muss ich schon sagen, dass eine Fortsetzung dieses sonderbaren Gaudiums mit Unserem Zutun sicher nicht stattfinden wird.«
»Gaudium – ging es nicht vielmehr darum, die Wahrheit herauszufinden? Wenn der Kardinal einfach entschieden ›Nein‹ gesagt hätte, ›Nein, das habe ich nicht getan‹ …«
»Hätten Sie ihm geglaubt? Wahrheit.« Er schnaubte verächtlich. »Die Wahrheit ist Jesus Christus, der sich nicht verteidigt hat, obwohl er ohne Sünde war, der alle unsere Sünden auf sich genommen hat, der am Kreuz für uns Sünder gestorben ist.«
»Ein rasanter Vergleich, Heinrich Grunert und Jesus …«
»Kein Vergleich«, schwächte Immermann sofort ab, »sondern ein Gleichnis. Der Herr Kardinal hat sein Leben stets nach dem Vorbild Jesu Christi geführt, da ist ein solches Gleichnis durchaus angebracht.«
»Von alldem abgesehen: Denken Sie nicht, dass das Schweigen des Kardinals in hohem Maß mitverantwortlich ist für die rapide ansteigenden Kirchenaustritte und das Ergebnis des Kirchenvolksbegehrens?«
»Die Initiatoren dieses seltsamen Begehrens –«
»Allesamt gläubige Katholiken …«
»Unterbrechen S’ mich nicht. Diese Leute vertreten im Grunde niemand. Ich weiß gar nicht, wer die Forderungen stellt, denn wir kriegen ja keine Unterschriften, sondern nur eine Ergebniszahl. Eine anonyme Botschaft. Und was den Kardinal betrifft: Ich glaube nicht, dass man ihn mit den seltsamen Forderungen dieser Herrschaften in Verbindung bringen sollte. Ich persönlich halte das Begehren für einen Sturm im Wasserglas; mit einer Zielsetzung, die nichts mit den Zielen der römisch-katholischen Kirche zu tun hat. Wenn wir darauf eingehen, können wir ja gleich protestantisch werden.«
»Ich hätte es nicht präziser formulieren können. Übrigens ist Günther Abfalter nicht der Einzige, der Grunert sexuellen Missbrauch vorgeworfen hat.«
Der Bischof wurde nun tatsächlich ungehalten. »Das ist doch selbstverständlich, dass man jetzt auf den fahrenden Zug aufspringt. Seit Ihre Kollegin den ersten Stein geworfen hat, ist es große Mode geworden, den Herrn Kardinal mit abstrusen Geschichten zu denunzieren. Ich möchte ja nichts Schlechtes über das verstorbene Fräulein Ortbauer sagen, aber was sie da veranstaltet hat, war eine öffentliche Hinrichtung, ein Schauprozess …«
»Ein Autodafé?«, schlug ich vor.
Immermann blinzelte mich an, ohne etwas zu sagen. Es war Zeit, meinen ersten Hammer niedersausen zu lassen. Mit einem ablenkenden Blick auf meinen Notizblock sagte ich so beiläufig wie möglich: »Herr Bischof, denken Sie, dass ein Zusammenhang zwischen dem Mord an Sarah Ortbauer und dem … Unfall des Bischofssekretärs besteht?«
Es gibt Interviewpartner, bei denen diese Taktik zu staunenswerten Erfolgen führt. Plaudere kreuz und quer durch den Obstgarten, hör ihnen zu, ermuntere sie, sich alles von der Seele zu reden – vor allem aber stell nur Fragen, die sie auswendig kennen und bis zum Erbrechen beantwortet haben. Und dann, wenn sie sich in Sicherheit wiegen, gib ihnen den Rest. Immermann gehörte zu der Spezies, die immun gegen den Trick ist. Er hielt es nicht einmal für nötig, die schütteren Augenbrauen zu heben.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.