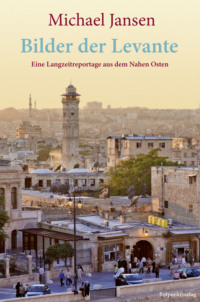Kitabı oku: «Bilder der Levante», sayfa 5
Ich hatte genug vom Leben im Wohnheim und zog in eine Zweizimmerwohnung in der Nähe der Rue Hamra, der Westbeiruter Hauptstraße. Zwei Monate später zog ich von dort weiter in eine Wohnung im vierten Stock ohne Fahrstuhl, auf einem Hügel über Raouche, im Dachgeschoss mit einem Streifen Meeresblick zwischen dem Shell-Gebäude und anderen Wolkenkratzern. Auf einem grünen Hügel unter meiner großen Terrasse grasten Ziegen, Glöckchen um den Hals, damit der alte Schäfer wusste, wenn eine sich davonmachte.
August 1963
Eines Morgens traf ich mich mit Usama Khalidi auf dem Campus, um den Besitzerwechsel seines vierzehn Jahre alten MG TC amtlich zu machen. Die Mechaniker nannten das Auto »Hadschi«, weil es so oft die Pilgerfahrt in ihre Werkstatt machte. Schon seit Monaten bewunderte ich Hadschi. Verlassen stand er beim Tor der Medizinischen Fakultät. Usama Khalidi, ein Professor für Biochemie, wollte den Oldtimer verkaufen, seit er ein Familienauto hatte. Als wir zur Behörde am Stadtrand fuhren, wo der Besitzerwechsel registriert und das Auto den méchanique, den Straßentauglichkeitstest, bestehen musste, erklärte mir Khalidi das geheimnisvolle Innenleben der Gänge; ich kannte bis dahin nur Automatikgetriebe. Ich sah zu und hoffte, alles verstanden zu haben. Auf dem Rückweg in die Stadt wurde ich ins kalte Wasser geworfen: Mitten im Mittagsverkehr hielt Khalidi vor seinem Wohngebäude, stieg bei laufendem Motor aus und sagte, ich solle nun übernehmen. Ich kletterte über das Getriebe und lernte das Schalten sofort. Knirschende Fehler vergab Hadschi. Soweit ich weiß, fuhr ich in Beirut als erste Frau einen Sportwagen. Viele sahen in Hadschi, einer Schönheit in British Racing Green, nur ein altes Auto, zu gestrig für Bewunderung.
Ich fuhr mit Hadschi durch ganz Beirut und wählte Routen, wo der Hall zwischen den Gebäuden am schönsten dröhnte. Weil Parkplätze im Zentrum schwer zu finden waren, nahm ich zum Einkauf auf dem Souk al-Franj die kleine rote Tram. Dort kaufte ich Käse bei Herrn Mamoud, einem kleinen runden Mann in engem beigem Overall, der im Sommer 250 Sorten Käse führte und im Winter 500, und frisches warmes Brot aus der Bäckerei direkt vor dem Suk.
Gaza, Ostern 1963
Neville Kanakaratne hatte mich zu einer Galaveranstaltung von UN-Friedenstruppen nach Gaza eingeladen, aber ich bekam für die Tage keinen Urlaub. So fuhr ich stattdessen Mitte April, in den Osterferien, für ein paar Tage hin. Wieder saß ich in einem UNRWA-Flugzeug, einer altertümlichen DC-3, in einem Schalensitz mit einer Decke gegen die Kälte, denn das Flugzeug war nicht luftdicht. Ich hatte im »Marna House« reserviert, einer kleinen Pension, geführt von Margaret Nassar, einer schönen Palästinenserin mit Geschäftssinn. Seit meinem ersten Besuch in Gaza wohnte ich immer dort. Für Besucher im Auftrag der UNO und Journalisten ist das Marna House in Gaza stets ein zweites Zuhause geblieben, auch wenn es an der Meeresfront inzwischen modernere Hotels gibt.
Das Abendessen mit den indischen Truppen war ein prachtvolles Ereignis im indischen Offizierskasino, geschmückt mit den Battle Honours des Regiments, Flaggen und Silber – glänzenden Kerzenleuchtern, Bechern, Tellern und Tabletts. Liebevoll poliert. Hinter jeder Person an der langen Tafel stand ein festlich uniformierter jawan, der Speisen und Getränke reichte.
Am nächsten Morgen organisierte Neville für mich eine private Akrobatikshow indischer Soldaten. Auf einem kleinen Sandhügel am Rand des Camps wurde ich mit einem Glas Bier in einen Korbstuhl gesetzt. Neville stand neben mir, ein verschmitztes Funkeln in den Augen, auf der anderen Seite stand Patrick, ein korpulenter Feldwebel irisch-indischer Abstammung. Auf der Ebene unter uns kletterten indische Soldaten einen eingefetteten Pfahl hinauf, machten Purzelbäume, überschlugen sich und stellten ihre Beweglichkeit und ihr Können zur Schau, während ich wie die junge Queen Victoria, leicht verschämt und leicht amüsiert, ihren Übungen zusah. Königinnen erwarten eine solche Behandlung, bloße Sterbliche nicht.
Bay City, Michigan, USA, 18. September 1961
Die Fernsehnachrichten meldeten den Tod von UNO-Generalsekretär Dag Hammarskjöld und fünfzehn Mitarbeitern bei einem Flugzeugabsturz über Nordrhodesien. Sie waren auf dem Weg zu Verhandlungen um einen Waffenstillstand zwischen den Kriegsparteien im Kongo gewesen. Verzweifelt rief ich gemeinsame Freunde in New York an und fragte: »War Neville im Flugzeug?« Niemand wusste es. Meine Eltern standen daneben und wunderten sich, was mich mit diesem Ereignis im fernen Afrika verbinden könnte.
Als Hammarskjölds Rechtsberater hätte Neville im Flugzeug sitzen sollen. Doch man hatte ihn nicht mitgenommen, weil er kein Französisch konnte, die Sprache beider Konfliktparteien in der ehemaligen belgischen Kolonie Kongo. Nevilles mangelnde Französischkenntnisse hatten ihm das Leben gerettet.
Wir hatten uns am Mount Holyoke College kennengelernt. Neville, ein kluger, eloquenter Delegierter der ceylonesischen UN-Gesandtschaft, hatte vor dem Club für Internationale Beziehungen – dessen Präsidentin ich später wurde – eine Vorlesung über die Entkolonialisierung Afrikas gehalten. Er war ein zierlicher Mann mit feinen Zügen und schütterem grauen Haar, prominenter Nase und großen, dichtbewimperten Augen. Er kam gern in das Frauencollege, wo ihn Studentinnen umringten und viele ihn bewunderten. War ich in New York, wo ich bei einem Freund in einer Dienstmädchenwohnung in Sutton Place wohnte, führte Neville uns zum Mittag- oder Abendessen aus. Bei seinen ceylonesischen Freunden zu Hause probierte ich zum ersten Mal Essen vom indischen Subkontinent. Das Fisch-Pickle trieb mir Tränen in die Augen, aber ich entwickelte trotzdem ein Faible für scharfes südasiatisches Essen.
Neville hatte mir eine Karte zur Eröffnung der UN-Generalversammlung 1960 geschenkt und setzte mich am richtigen Eingang zur riesigen Halle ab. Drinnen stand ich plötzlich neben Fidel Castro, der gerade andere Delegierte begrüßte. Von meinem Sitz in der ersten Reihe, eigentlich für hochrangige Beamten bestimmt und nicht für Collegestudenten, hatte ich einen guten Blick auf das Geschehen und die Anwesenden. Die Hauptrede an jenem Tag war auf Serbokroatisch, gehalten vom jugoslawischen Staatschef Tito. Viele Delegierte schlichen zwischendurch hinaus, aber ich traute mich nicht.
Im Frühjahr 1961 lud mich Neville zu seiner Abschiedsparty in seine New Yorker Wohnung ein. An dem Tag sollte ich in einem Seminar bei der eindrucksvollen Ruth Lawson, Professorin für Internationale Beziehungen, ein Referat halten. Ich zerbrach mir den Kopf, ob ich das Referat halten oder zur Party gehen sollte, und entschied mich schließlich für die Party. Wir trafen uns in kleiner Runde in Nevilles Wohnung. Er hatte eine Auswahl scharfer Gerichte gekocht, die er sich während seines Studiums in Cambridge selbst beigebracht hatte. Die meisten Gäste waren weiblich, viele den Tränen nahe; junge Frauen schätzten Neville, der schwul war, als guten Freund und wunderbaren Begleiter über alles. Niemand von uns wusste, dass er aus der Delegiertenlounge in die Räume des Generalsekretärs in den geheiligten 38. Stock ziehen sollte.
Am Morgen nach der Party ging ich in das winzige UNRWA-Büro, tief im Inneren des UN-Gebäudes. Ich wollte wissen, ob es schon Neuigkeiten zu meiner Praktikumsbewerbung für den Sommer im Beiruter Hauptsitz des Hilfswerks gab. Molly, die zuständige Angestellte, sagte: »Du hast Glück, der Generalkommissar ist gerade da. Ich schau mal, ob er Zeit hat.« John Davis sagte mir, dass manche in Beirut mich ablehnen würden: »Eine junge Amerikanerin könnte ein Problem sein.« Doch er entschied, mich als erste Praktikantin und Freiwillige des Hilfswerks anzunehmen. »Sie müssen aber für drei Monate hin. Für sechs Wochen lohnt sich die Reise nach Beirut nicht.«
Wäre ich nicht zu Nevilles Abschiedsparty gegangen, wäre mein Leben anders verlaufen. Zur Sicherheit hatte ich eine zweite Praktikumsbewerbung eingereicht, beim UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge in Genf. Den Platz bekam eine Kommilitonin. Professorin Lawson war krank geworden und hatte das Seminar gar nicht halten können. Von den beiden Praktika, die den Kurs erheblich bereicherten, war sie begeistert. Eine einfache Sache, diese Entscheidung.
Neu-Delhi, Indien, 1959
Nach dem ersten libanesischen Bürgerkrieg kehrte Godfrey nach Neu-Delhi zurück, ausgezeichnet mit dem Zedernorden der Republik Libanon. Seine Rolle in der Beendigung des Konflikts wurde von Ministerpräsident Jawaharlal Nehru im Parlament erwähnt. Er bewarb sich um eine weitere Entsendung in den Nahen Osten, doch stattdessen wurden ihm Washington oder Paris angeboten.
Als Godfrey zum Frühstück in Jawaharlal Nehrus Residenz eingeladen war, verspätete er sich wegen des Verkehrs in Delhi um ein paar Minuten und wurde ins Esszimmer geführt. Der Ministerpräsident, seine Tochter Indira Gandhi und Lady Edwina Mountbatten saßen schon am Tisch. Der Diener fragte leise, wie viele Eier Godfrey gerne hätte. »Eins.« Die anderen drei warfen sich einen Blick zu, ein diskretes Lächeln auf den Lippen.
Einige Jahre später fragte Godfrey Indira Gandhi, warum sie bei seiner Frühstücksbestellung gelächelt hätten. Sie antwortete, sie hätten oft gewettet, ob ein Gast eine Einei- oder Zweieierperson sei. »Bei Ihnen lagen wir richtig.«
Was seine Entsendung anbetraf, erzählte Godfrey, dass »Herr Nehru sich entschuldigt« und gesagt habe, er könne »die Bürokraten im Außenministerium nicht umstimmen.«
Godfrey verließ den diplomatischen Dienst. Kurze Zeit arbeitete er in Delhi für den National Herald, herausgegeben von Indira Gandhis Ehemann Feroze Gandhi. Dann wurde er Regionalkorrespondent für den indischen Statesman, kehrte Indien somit wieder den Rücken und zog zurück in die Beiruter Wohnung, in der er schon als Diplomat gelebt hatte, zufrieden, nun keine diplomatischen Empfänge mehr besuchen und eine Krawatte tragen zu müssen. Wäre er Diplomat geblieben, hätten wir uns nie kennengelernt.
4Autonomie
Indien, Februar 1967
Godfrey sollte für den Statesman zurück nach Indien, um über die Wahl zur ersten Parlamentskammer, der Lok Sabha, zu schreiben, die vierte Wahl seit der Unabhängigkeit. Er sollte weniger über Themen berichten als über Abläufe, wie Wahlkampf geführt wurde, Kandidaten, Wähler, Lokalkolorit. Die Redaktion fand, ihre Auslandskorrespondenten könnten einen frischen Blick auf die Mechanismen der indischen Demokratie öffnen. Godfrey traf sich in Delhi mit der Redaktion, und ihm wurde der Süden zugeteilt – Hyderabad, Karnataka, Tamil Nadu, Kerala und Goa. Er schlug vor, dass ich ihn begleiten solle. Seine Begründung: »Bevor wir heiraten, musst du sehen, ob du in Indien leben könntest, falls ich mal zurückkehren will.«
Ich bekam bei meinen Jobs Urlaub und ein Freund beim Christian Science Monitor sagte mir, er werde ein paar längere Artikel über die Wahlen nehmen. Am Flughafen von Bombay betrachtete ich stundenlang Leute, nahm dann einen Flug nach Hyderabad. Dort traf ich mich mit Godfrey in einem neu eröffneten Hotel, einem kleinen Palast im Stadtzentrum. Unser Badezimmer war größer als das Schlafzimmer, eingerichtet im angloindischen Kolonialstil. Um unser Wiedersehen zu feiern, bestellten wir zum Abendessen eine teure Flasche Chianti.
Die erste Etappe unserer Reise führte uns von Hyderabad nach Bangalore, Godfreys Heimatstadt. Vierzig Jahre zuvor war sein aggressiv protestantischer Vater, ein Zollbeamter auf dem Irrawady in Maymyo im britisch regierten Burma, in Rente gegangen, hatte seine Familie eingepackt und war nach Richmond Town in Bangalore gezogen, nachdem sein ältester Sohn ein katholisches anglo-burmesisches Mädchen geheiratet hatte. Über den Sohn, der eine Katholikin geheiratet hatte, zitierte Godfrey seinen Vater mit den Worten: »Ich lebe nicht im selben Land wie die.« Zwei Häuser, die sein Vater in Maymyo besaß, verkaufte er mit Verlust.
Godfrey, zur Zeit des Umzugs acht Jahre alt, zeigte mir seine damalige Schule, die Baldwin Boys’ School. »Ich war klein und schmal. Als mich mal ein Lehrer schlug, ging mein Vater mit einem Gehstock in die Schule und sagte dem Direktor, wenn irgendwer mich noch mal anfassen sollte, werde er den Stock einsetzen. Ich wurde nie wieder geschlagen.«
Als die drei ältesten groß waren, beschloss Godfreys Mutter, dass sie genug von Kindern hatte und begab sich auf ausgedehnte Besuche bei Freunden. Godfrey und D, anderthalb Jahre älter als er, verstanden sich nicht mit ihrem Vater. D nahm eine Lehrerstelle an und zog aus. Godfrey wollte außerhalb des engen evangelikalen Protestantismus seines Vaters unbedingt mehr über andere Religionen erfahren und las buddhistische Texte, den Koran und die hinduistische Gita. »Die Gita hat für meinen Vater das Fass zum Überlaufen gebracht, da hat er mich rausgeschmissen. Ich bin dann für eine Weile bei D eingezogen.« Mit fünfzehn ging Godfrey auf das Madras Christian College, wo er schließlich seinen Bachelor in englischer Literatur machte. Er belegte Kurse an der Universität von Madras, bis er eine Lehrerstelle an einer Jungenschule bekam, die er jedoch verließ, um sich freiwillig für den Krieg gegen Japan zu melden. Auf seiner Bewerbung sollte er die Teilstreitkräfte nach Präferenz auflisten. Er schrieb: »Infanterie, Infanterie, Infanterie.« Er wurde als offizieller Kriegskorrespondent der Luftwaffe zugeteilt.
In Bangalore wohnten wir in einem weitläufigen Bungalow aus britischen Zeiten mit verblasst rotem, durchhängendem Ziegeldach, einer Veranda mit wackligem Geländer und einem Ausblick auf einen staubigen Platz, wo nachmittags Jugendliche Cricket spielten und abends Stalljungen Polo-Ponys trainierten. Von dort aus erkundeten wir das Umland südlich von Mysore und begleiteten Kandidaten des Indischen Nationalkongresses und anderer Parteien. Einmal fuhren wir in Jeeps über Holperpisten durch die Dunkelheit, bis uns eine Delegation aus einem Dorf entgegenkam, in dem der Kandidat eine Wahlkampfrede halten sollte. Wir kletterten aus den Wagen und gingen in einer Prozession über Stoppelfelder, angeführt von Trommlern und den Dorfältesten mit hellen Petroleumlaternen, hinein in eine Halle, die ein riesiges Porträt des ermordeten John F. Kennedy zierte. Sie hatten gehört, »eine Amerikanerin« komme und wollten mir eine Ehre erweisen.
Am Mount Holyoke College war meiner Zimmergenossin Caroline und mir im Seminar über Innenpolitik aufgetragen worden, für den republikanischen Senatskandidaten Leverett Saltonstall, einen »Bostoner alter Schule«, Wahlkampf zu machen. Wir holten Flugblätter in seinem Hauptsitz in Holyoke, mit dem Bus nur ein kurzes Stück von South Hadley, dann fuhren wir zum Büro der Demokraten und holten uns Kampagnenmaterial des Präsidentschaftskandidaten Kennedy. Wir gingen von Tür zu Tür. Wir wollten potenzielle Wähler davon überzeugen, ihren Stimmzettel zwischen Saltonstall, einem beliebten Liberalen und seit 1945 im Senat, und dem attraktiven jungen Senator aus unserem Bundesstaat zu splitten. Amerikas Jugend – und viele andere in der ganzen Welt – standen in Kennedys Bann. Wir feierten, als beide »unserer« Kandidaten ihren Wahlkampf gewannen, Saltonstall mühelos, Kennedy knapp.
Auch am 17. April 1961 waren wir in Washington, ein dramatischer Tag für die neue Regierung. Als unser Studentengrüppchen aus Mount Holyoke und Amherst an einem Zeitungsstand vorbeischlenderte, entdeckte ich eine fettgedruckte Schlagzeile über die Invasion Kubas. Rebellen hatten mit Unterstützung der USA versucht, das Castro-Regime zu stürzen. Wir gingen weiter zum Weißen Haus und dem Büro von Theodore Sorensen, Kennedys Redenschreiber und Berater, bei dem wir schon lange zuvor einen Termin bekommen hatten. Er weigerte sich, Stellung zu nehmen. Am nächsten Tag versuchten ranghohe Regierungsmitglieder uns damit abzuwimmeln, dass es sich um »ein Überbleibsel der Regierung Eisenhower« handele. Wir waren nicht besänftigt. Unser Held hatte uns enttäuscht. Er hatte sich verhalten wie ein typischer imperialistischer Präsident, nicht wie einer, der mit der Vergangenheit bricht.
Von Kennedys Ermordung am 22. November 1963 erfuhr ich erst am Morgen danach, als ich vor meinem Weg zur Arbeit an der American University of Beirut zu Hause BBC hörte. Schockiert, sprachlos, betäubt, fuhr ich durch die gedämpft wirkenden Straßen Beiruts, still durch diesen Tod im fernen Dallas. Meine Kollegin Mona hatte rote Augen. Sie war noch im Schlafzimmer, als ihre Mutter gerufen hatte: »Sie haben den Präsidenten ermordet!« Mona sagte: »Ich dachte, sie meint unseren Präsidenten … nicht Kennedy.« Trotz seiner Schwächen und Fehler war Kennedy ein Präsident, den die Welt bewunderte. Der letzte US-Präsident, der Herzen und Gemüter für sich gewinnen konnte, im Ausland wie zu Hause.
Auf dem Land bei Mysore, Indien, Februar 1967
Der Kandidat, ein attraktiver junger Mann in beigefarbenem Tweedjackett und braunen Hosen, stellte uns kurz und sachlich der Dorfbevölkerung vor; Godfrey sei ein Korrespondent für den Statesman aus Kalkutta und Neu-Delhi, ich eine Journalistin, die für den Christian Science Monitor schreibe (der meine Artikel am Ende nicht veröffentlichte). Godfreys Pfeife, die er während der Rede des Kandidaten rauchte, sorgte für Belustigung. Für die Dorfbewohner waren wir Ausländer. Auch der Kandidat wurde dieser Kategorie zugeordnet.
Auf einer zweiten Reise mit einem Kandidaten einer anderen Partei offerierte man uns ein Mittagessen an einem Tisch mit Tellern und Besteck. Unser Gastgeber, der Kandidat und sein Team saßen derweil auf dem Boden und aßen mit den Händen von frischen, breiten Bananenblättern. Wir setzten uns zu ihnen. Godfrey fühlte sich unwohl auf dem Boden und gut mit den Händen essen konnte er auch nicht. Er versuchte sich zu entschuldigen: »Für Angloinder ist dies zu einheimisch.«
In einem kleinen abgelegenen Dorf inmitten von Feldern standen Frauen und Kinder Schlange, um mich sanft in den Arm zu zwicken; sie hatten noch nie eine so hellhäutige Frau gesehen.
Der Wahlkampf wurde unter Indira Gandhi als Vorsitzender der Kongresspartei und neuer Premierministerin ausgetragen. Godfrey sagte später, die Parteiälteren hätten »das Mädchen« gefördert, weil sie – fälschlicherweise – meinten, Gandhi manipulieren zu können. Sie hatten nicht ihre erhebliche Erfahrung miteingerechnet, die sie unter Nehrus Anleitung in den Jahren als seine Gastgeberin und Vertraute gewonnen hatte.
Weil die Stimmabgabe über fünf Tage gestaffelt war, konnten wir die Wahlen im südlichsten Wahllokal Indiens im Städtchen Kanyakumari am Kap Komorin verfolgen, wo das Arabische Meer und der Golf von Bengalen zusammentreffen. Dann fuhren wir weiter nach Kerala ins Küstendorf Kovalam. Dort wohnten wir am Strand, in einem staatlichen Gästehaus mit fünf Schlafzimmern. Die einzigen anderen Gäste waren ein bärtiger Gelehrter und seine amerikanische Anhängerin. Auf einer spirituellen Mission schienen die beiden nicht zu sein, sie verließen ihr Zimmer nie.
Am Morgen vor unserer Ankunft war eines der kleinen Fischerboote nicht zurückgekehrt. Mehrere Boote fuhren hinaus, um nach dem verschwundenen Fischer zu suchen. Die Frauen versammelten sich um den Brunnen neben dem Gästehaus und redeten mit hellen Stimmen in schnellem Malayalam miteinander. Von unserem Zimmer aus konnten wir hören, wie das Seil in den Brunnen hinunterzischte, der Eimer weit unten auf das Wasser schlug und beim Hinaufziehen gegen die steinerne Brunneneinfassung krachte. Die Stimmen und das Platschen und Krachen im Brunnen dauerten die ganze Nacht an, so lange die Frauen wachten. Im Morgengrauen wurde die Leiche des ertrunkenen Fischers an Land gespült. Am nächsten Tag wählten die Dorfbewohner in einer mit Palmwedeln gedeckten Hütte, speziell für diesen Zweck erbaut. Analphabeten wählten anhand der Parteisymbole. Schlussendlich gewann Indira Gandhi. Und ich entdeckte, dass ich Indien gegenüber toleranter war als der ungeduldige Godfrey.
Aus dem Vorschlag, dass er als Verteidigungskorrespondent des Statesman nach Delhi zurückkehren solle, wurde nichts. Am Tag, als wir wieder in Beirut ankamen, rief mein Vater an – Grandma Fancher war gestorben. In Indien hatte ich einen schönen Seidenschal für sie gekauft.
Schemlan, Libanon, Frühjahr und Sommer 1966
Ich saß mit Godfrey auf einem Mäuerchen unter der letzten Haarnadelkurve zwischen dem oberen und dem unteren Teil von Schemlan. Vor uns erstreckten sich grüngraue Oliventerrassen, eingefasst von einem dunklen Stück Landebahn des Beiruter Flughafens und dem ewig wechselnden Blau des Mittelmeers. Direkt zu unseren Füßen lagen ein paar verwahrloste Oliventerrassen und ein Erdrutsch, der den rotbraunen Sandstein entblöste, den die Dorfbewohner hier einst abgebaut hatten. »Lass uns hier unser Haus bauen«, sagte Godfrey – ein ungewöhnlicher Antrag einer Lebensgemeinschaft oder Ehe.
Godfrey wollte in Schemlan ein Baugrundstück kaufen, seitdem ich ihm gesagt hatte, dass sich auf seinem Konto bei der British Bank of the Middle East eine beträchtliche Summe angesammelt hatte. Auf den beachtlichen Kontostand war ich gestoßen, als ich während ein paar Erledigungen einen Scheck für ihn eingelöst hatte. Godfrey hatte sich nie darum gekümmert, in seinem Scheckbuch Einzahlungen oder Abhebungen zu vermerken, und war überrascht. Der Besitzer des etwa viertausend Quadratmeter großen, keilförmigen Grundstücks verkaufte ihm das Land nur zu gern und zu einem günstigen Preis, und so beauftragte Godfrey seinen Notar, eine Baugenehmigung zu beantragen. Wir fingen an, Pläne für das Haus zu zeichnen, das als beit al-Hindi bekannt werden sollte, das Haus des Inders. Das erste Haus, das seit hundert Jahren im Dorf gebaut wurde, ein Haus mit drei Bögen, aus behauenem Stein, einem Ziegeldach, Fliesenböden und dem Holz einer Missionarsschule aus dem Nachbardorf Souk al-Gharb, 1868 erbaut, genau ein Jahrhundert zuvor.
Den Sommer über wohnten wir im Dorf, in einem kleinen Apartment im ersten Stock des Steinhauses unserer Freunde Rasha und Walid Khalidi. An den Wochenenden gingen wir mit Munir und Usama im Gebirge wandern, unter der Woche fuhren wir zur Arbeit runter nach Beirut.
Jerusalem und Bethlehem, Heiligabend 1966
Godfrey und ich bezogen unser Lieblingszimmer im American Colony Hotel, von der Eingangshalle aus direkt auf der anderen Seite des gepflasterten Innenhofs. Die Weihnachtsdekoration war sparsam, es waren nur wenige Gäste im Hotel. Ostjerusalem, damals von Jordanien regiert, war noch kein bedeutendes Touristenziel, eher ein kleines Nest. Wir spazierten ein paar Schritte zur anglikanischen St. George’s Cathedral an der Nablusstraße, vorbei an Häusern auf der Grünen Linie zwischen dem palästinensischen Ostsektor und dem israelischen Westsektor. Es war eine Zeit gereizter Koexistenz, hin und wieder unterbrochen von Gewaltausbrüchen zwischen Israel und Syrien. Für die Araber war Israel ein Niemandsland, eine tote Zone, abgeschottet durch den Stacheldraht und Müll an der Demarkationslinie, etwas, was Journalisten »Südwales« oder »Dixie« nannten, dessen Name in Büchern, die nach Libanon und in andere arabische Länder exportiert wurden, mit Filzstift überstrichen wurde.
Zu Abend aßen wir bei Usama und Samia. Die beiden wohnten auf dem Gelände des Auguste-Viktoria-Hospitals, und wir lernten bei ihnen Amin Majaj, den Bürgermeister Ostjerusalems, und seine Frau Betty kennen. Usama und Amin, ein Arzt, forschten zu Unterernährung palästinensischer Flüchtlingskinder.
Nach dem Essen fuhren wir hinaus zu den Hirtenfeldern bei Bait Sahur, in der Nähe von Bethlehem, um an evangelischen Festlichkeiten unter dem nebligen Himmelszelt teilzunehmen. Hier sollen die Hirten einst mit ihren Herden gelagert haben, als ihnen der Engel erschien und die Geburt Jesu im Stall von Bethlehem verkündete. Orthodoxe und Katholiken hatten je eine Kirche gebaut, und von beiden Stellen hieß es, sie seien die wahren Hirtenfelder. Statt für einen Gottesdienst entschieden wir uns für die freie Natur.
Am nächsten Morgen erkundeten wir ein paar der Höhlen in den Kalksteinklippen, die bei der Ausgrabungsstätte von Kumran zum Jordantal hin abfallen. Hier hatte man die Schriftrollen vom Toten Meer entdeckt. Vorerst war die Region ruhig.
Jerusalem, Ende Mai 1967
Ich flog nach Amman und nahm von dort ein Taxi nach Jerusalem. Auf der Schnellstraße hinunter ins Jordantal herrschte kaum Verkehr. Die Scheinwerfer der entgegenkommenden Autos waren blau angemalt. Die Region steuerte abermals auf einen Krieg mit Israel zu – den dritten seit seiner Gründung 1948.
Anfang des Jahres hatte es kleinere Zusammenstöße zwischen Syrien und Israel gegeben. Im Mai berichtete Moskau, Israel habe Truppen entlang der syrischen Waffenstillstandslinie gesammelt. Nasser stationierte daraufhin Soldaten im Sinai und wies am 19. Mai UN-Blauhelme aus Sinai und Gaza aus. Ägypten übernahm auch UN-Posten in Scharm el Scheich mit Blick über die Straße von Tiran, eine Meerenge und einziger Zugang vom Roten Meer zum Golf von Akaba. Als sich Israel nach dem Suezkrieg gegen Ägypten 1957 aus dem Sinai zurückzog, hatte es Ägypten gewarnt, dass die Schließung der Straße von Tiran ein Kriegsgrund sei. Am 22. Mai erklärte Nasser die Straße für geschlossen.
Ich traf mich mit Godfrey in unserem üblichen Zimmer im American Colony Hotel. Er war schon seit ein paar Tagen dort, um für den Statesman über die Lage zu berichten. Ich hatte Angst, dass er im Kriegsfall allein festsäße, und so reiste ich ihm nach. Wir aßen zu Abend und machten einen Spaziergang durch die dunklen leeren Straßen. Wir betraten die Altstadt durch das Damaskustor. In einer Bäckerei am oberen Ende der geschlossenen Ladenstraße Khan al-Zeit kauften wir ein paar warme Fladenbrote, knabberten sie und fütterten damit weiße Esel, die mit steinbefüllten Tragekörben allein von einer Baustelle kamen. Bei der Grabeskirche trafen wir auf Männer, mit feinem Zementstaub bedeckt, die die Esel beluden und sie mit einem Klaps auf die Flanke losschickten.
Als wir nach Beirut zurückkehrten, mischte ich eine Paste aus Wäscheblau und Wasser und bemalte damit Glühbirnen und Hadschis Scheinwerfer – unser Beitrag zur Verdunklung. König Hussein von Jordanien unterzeichnete mit Nasser ein gemeinsames Verteidigungsabkommen, und Irak machte Truppen gefechtsbereit.
Beirut, Libanon, 5. Juni 1967
Wir hörten BBC-Nachrichten, als Rasha Khalidi anrief; sie wollte fragen, ob wir schon wüssten, dass Israel frühmorgens ägyptische Flugplätze angegriffen und Berichten zufolge die ägyptische Luftwaffe noch am Boden zerstört habe. Auch die ägyptischen Flugabwehrraketen und Radaranlagen seien außer Gefecht gesetzt. Während Ägyptens Stimme der Araber fälschlicherweise den eigenen Sieg in einem Schicksalskrieg verkündete, rückten israelische Bodentruppen aus der Wüste Negev in den Sinai und nach Gaza vor. In Jerusalem brachen um halb zehn am Morgen zwischen jordanischen und israelischen Truppen Schießereien und Mörserbeschuss aus. Um viertel nach elf begannen jordanische Haubitzen die Bombardierung Westjerusalems, 1948 von Israel eingenommen.
Kurz nach ihrem Anruf kam Rasha, die mit ihrem Schwager Usama in Jerusalem telefoniert hatte, zu uns in die Wohnung. Sie wollte irreführender Propaganda, die von beiden Seiten und westlich dominierten Medien bereits verbreitet wurde, etwas entgegensetzen. Wir gründeten die »Afro-Asiatische Einigkeitsbewegung« und baten einen Drucker, Papier zu organisieren. Am selben Abend trafen israelische Kampfflugzeuge syrische Flugplätze und löschten damit Syriens Verteidigungsfähigkeiten aus.
Wir schrieben täglich Berichte, auf Grundlage von Telefoninterviews mit Palästinensern in Jerusalem, im Westjordanland und in Gaza, mit Jordaniern und Syrern. Das Material wurde jeden Tag in Umschlägen mit der Middle East Airlines nach Genf geflogen und an Diplomaten aus der arabischen und Dritten Welt verteilt sowie an Pressekanäle und Aktivisten. Als Adresse gaben wir das Postfach des ehemaligen libanesischen Ministerpräsidenten Saeb Salam an, der unsere Arbeit unterstützte. Später erhielten wir Dankesbriefe von arabischen Diplomaten aus Europa und anderswo.
Der Krieg endete im Westjordanland am 7. Juni, und die Jerusalemer Altstadt fiel Israel zu. Am 8. Juni kam es zum Rückzug im Sinai, der auch unter israelische Besatzung fiel. Der Kampf um Syriens Golanhöhen war am 10. Juni entschieden. Am 11. »säuberte« ein triumphierendes Israel die Gebiete.
Neben den Kampfhandlungen selbst gewann Israel auch die Herzen und Köpfe von Meinungsmachern, Politikern und der westlichen Öffentlichkeit. David Rubingers berühmtes Schwarzweißfoto für das Time Life Magazine – israelische Fallschirmjäger an der Klagemauer kurz nach deren Wiedereroberung – erschien auf Titelblättern in der ganzen Welt. Nur wenige Zeitungen brachten Geschichten darüber, wie Israel die Häuser mittelloser Palästinenser im Maghrebinerviertel neben der Klagemauer abriss, um dort einen großen Platz zum Beten zu schaffen. Obdachlos gewordene Palästinenser wurden in Busse gesetzt, zum Jordan gefahren und über eine zerbombte Brücke ins Königreich Jordanien ausgewiesen.
Unser Freund Israel Shahak sagte, selbst nichtreligiöse Israelis glaubten, der Krieg habe das Land befreit, das Gott den Juden gegeben habe.
Im britischen Sunday Telegraph schrieb Peregrine Worsthorne, ein harter Kritiker der Entkolonialisierung, unter dem Titel »Triumph der Zivilisierten«: »[…] letzte Woche bewies eine winzige westliche Gemeinschaft, umringt von einer ungemein größeren Zahl unterentwickelter Völker, dass sie heute den Arabern ihren Willen fast so mühelos aufzwingen kann wie die ersten Weißen den afro-asiatischen Eingeborenen zur imperialen Blütezeit.«