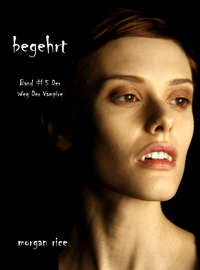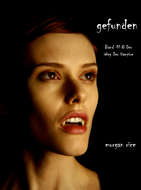Kitabı oku: «Begehrt », sayfa 2
KAPITEL ZWEI
Ihre Welt fühlte sich surreal an, als die Nonne Caitlin einen langen Korridor entlang durch die Abtei führte. Es war ein wunderschöner Ort, und es war deutlich, dass er aktiv bewohnt war, voll umherziehender Nonnen in weißen Roben, die sich, wie es schien, für den Morgengottesdienst fertig machten. Eine von ihnen schwang im Vorbeiziehen eine Karaffe und verbreitete so würzigen Weihrauch, während andere sanft Morgengebete sangen.
Nach einigen Minuten schweigenden Dahingehens fragte sich Caitlin langsam, wohin die Nonne sie führen würde. Endlich blieben sie vor einer einzelnen Tür stehen. Die Nonne öffnete sie, und dahinter erschien ein kleines, bescheidenes Zimmerchen mit Blick über Paris. Es erinnerte Caitlin an das Zimmer, in dem sie in dem Kloster in Siena gewohnt hatte.
„Auf dem Bett findest du Kleidung, in die du dich umziehen kannst“, sagte die Nonne. „Es gibt einen Brunnen zum Baden in unserem Innenhof“, sagte sie. Sie streckte den Zeigefinger aus: „Und das dort ist für dich.“
Caitlin blickte an ihrem Zeigefinger entlang und erblickte ein kleines Steinpodest in einer Ecke des Zimmers, auf dem ein silberner Kelch stand, der mit einer weißen Flüssigkeit gefüllt war. Die Nonne lächelte zurück.
„Du findest hier alles, was du für eine erfrischende Nachtruhe brauchst. Danach ist die Wahl dir überlassen.“
„Wahl?“, fragte Caitlin.
„Mir wurde gesagt, du bist bereits in Besitz eines Schlüssels. Du wirst die anderen drei finden müssen. Jedoch die Wahl, deine Mission zu erfüllen und deine Reise fortzusetzen, ist stets die Deine.
Das hier ist für dich.“
Sie überreichte Caitlin einen Zylinder aus Silber, der mit Juwelen besetzt war.
„Es ist ein Brief von deinem Vater. Nur für dich. Wir bewahren ihn schon seit Jahrhunderten auf. Er wurde noch nie geöffnet.“
Caitlin nahm ihn ehrfürchtig an sich und fühlte sein Gewicht in ihrer Hand.
„Ich hoffe sehr, dass du deine Mission fortsetzt“, sagte sie sanft. „Wir brauchen dich, Caitlin.“
Plötzlich wandte sich die Nonne ab, um zu gehen.
„Warte!“, rief Caitlin aus.
Sie hielt an.
„Ich bin in Paris, richtig? Im Jahr 1789?“
Die Frau lächelte zurück. „Das ist korrekt.“
„Aber warum? Warum bin ich hier? Warum jetzt? Warum an diesem Ort?“
„Ich fürchte, es liegt an dir, das herauszufinden. Ich bin nur eine einfache Dienerin.“
„Aber warum hat es mich zu dieser Kirche gezogen?“
„Du bist in der Abtei des Heiligen Petrus. In Montmartre“, sagte die Frau. „Sie befindet sich seit tausenden Jahren hier. Es ist ein äußerst heiliger Ort.“
„Warum?“, drängte Caitlin.
„An diesem Ort trafen alle zusammen, um ihre Gelübde zur Gründung der Gesellschaft Jesu abzulegen. Es ist der Ort, an dem das Christentum geboren wurde.“
Caitlin starrte die Nonne sprachlos an, die schließlich lächelte. „Willkommen.“
Und damit verbeugte sie sich leicht und ging davon, die Tür hinter sich schließend.
Caitlin blickte sich im Zimmer um. Sie war dankbar für die Gastfreundschaft, die frischen Kleider, die Gelegenheit, zu baden, das komfortable Bett, das sie in der Ecke stehen sah. Sie dachte nicht, dass sie noch einen weiteren Schritt gehen könnte. Tatsächlich war sie so müde, dass sie das Gefühl hatte, sie könnte ewig schlafen.
Mit dem juwelenbesetzten Behälter in der Hand schritt sie zur Ecke des Zimmers hinüber und setzte ihn ab. Die Schriftrolle konnte warten. Aber ihr Hunger konnte es nicht.
Sie hob den übervollen Kelch und begutachtete ihn. Sie konnte bereits spüren, was er enthielt: weißes Blut.
Sie setzte ihn an die Lippen und trank. Es war süßer als rotes Blut und es fiel ihr leichter, es zu trinken—und es zog rascher durch ihre Adern. In wenigen Augenblicken fühlte sie sich wie neugeboren, und stärker als je zuvor. Sie hätte ewig trinken können.
Caitlin setzte schließlich den leeren Kelch ab und nahm den silbernen Behälter mit sich ins Bett. Sie legte sich hin und bemerkte, wie sehr ihr die Beine schmerzten. Es fühlte sich so gut an, einfach nur dazuliegen.
Sie lehnte sich zurück und legte ihren Kopf auf das schlichte kleine Kissen, und schloss die Augen für eine Sekunde. Sie nahm sich fest vor, sie in einem Augenblick wieder zu öffnen und den Brief ihres Vaters zu lesen.
Doch in dem Moment, als sie die Augen schloss, überkam sie eine unglaubliche Erschöpfung. Sie konnte sie nicht wieder öffnen, so sehr sie es versuchte. In wenigen Sekunden war sie fest eingeschlafen.
*
Caitlin stand inmitten des Kolosseum in Rom, in volle Kampfmontur gerüstet, ein Schwert in der Hand. Sie war bereit, jedem entgegenzutreten, der sie angreifen würde—verspürte einen wahren Drang, zu kämpfen. Doch als sie in alle Richtungen herumwirbelte, erkannte sie, dass das Stadium leer war. Sie blickte hoch zu den Sitzreihen und sah, dass der gesamte Ort menschenleer war.
Caitlin blinzelte, und als sie die Augen öffnete, war sie nicht länger im Kolosseum, sondern im Vatikan, in der Sixtinischen Kapelle. Sie hielt immer noch ihr Schwert, doch war nun in Roben gekleidet.
Sie blickte sich im Raum um und sah hunderte Vampire, ordentlich aufgereiht, in weiße Roben gekleidet, mit leuchtend blauen Augen. Sie standen geduldig an der Wand, stumm, völlig aufmerksam.
Caitlin ließ ihr Schwert in der leeren Kammer fallen, und es landete mit einem Klirren. Langsam schritt sie auf den Oberpriester zu, streckte den Arm aus und nahm einen riesigen silbernen Kelch von ihm entgegen, der mit weißem Blut gefüllt war. Sie trank, und der Trank floss über und rann über ihre Wangen.
Plötzlich war Caitlin allein in der Wüste. Sie lief barfuß über den ausgetrockneten Boden, die Sonne brannte auf sie herunter, und sie hielt einen gigantischen Schlüssel in ihrer Hand. Doch der Schlüssel war so groß—unnatürlich groß—und sein Gewicht zog sie zu Boden.
Sie wanderte und wanderte, schnappte in der Hitze nach Luft, bis sie endlich an einen riesigen Berg gelangte. Am Gipfel des Berges sah sie einen Mann stehen, der lächelnd zu ihr hinunterblickte.
Sie wusste, es war ihr Vater.
Caitlin verfiel in einen Laufschritt, rannte so schnell sie konnte, versuchte, auf den Berg hinauf zu gelangen, ihm näher und näher zu kommen. Währenddessen stieg die Sonne höher und heißer am Himmel hoch, auf sie niederbrennend, scheinbar von direkt hinter ihrem Vater kommend. Es war, als wäre er die Sonne, und sie würde direkt in sie hineinlaufen.
Ihr Aufstieg wurde immer heißer, höher, und sie schnappte nach Luft, als sie näher kam. Er stand mit ausgebreiteten Armen da, darauf wartend, sie zu umarmen.
Doch der Hügel wurde steiler, und sie war einfach zu müde. Sie konnte nicht weiter. Sie brach auf der Stelle zusammen.
Caitlin blinzelte, und als sie ihre Augen öffnete, sah sie ihren Vater über sich stehen und sich mit einem warmen Lächeln auf dem Gesicht zu ihr hinunter beugen.
„Caitlin“, sagte er. „Meine Tochter. Ich bin so stolz auf dich.“
Sie versuchte, die Hand auszustrecken, ihn festzuhalten, doch der Schlüssel lag nun auf ihr und er war zu schwer, drückte sie zu Boden.
Sie blickte zu ihm hoch, versuchte zu sprechen, doch ihre Lippen waren aufgesprungen und ihre Kehle zu ausgetrocknet.
„Caitlin?“
„Caitlin?“
Caitlin öffnete erschrocken die Augen, desorientiert.
Sie blickte hoch und sah einen Mann an ihrem Bett sitzen, der lächelnd auf sie hinunterblickte.
Er strich ihr sanft das Haar aus dem Gesicht.
War dies immer noch ein Traum? Sie spürte kühlen Schweiß auf der Stirn, fühlte seine Berührung auf ihrem Handgelenk, und sie betete, dass es nicht so war.
Denn da vor ihr, sie anlächelnd, war die Liebe ihres Lebens.
Caleb.
KAPITEL DREI
Sam öffnete erschrocken die Augen. Er starrte auf den Himmel hoch, den Stamm einer enormen Eiche entlang. Er zwinkerte mehrmals und fragte sich, wo er war.
Er spürte etwas Weiches an seinem Rücken, und es fühlte sich sehr bequem an; er stellte fest, dass er auf einem Flecken Moos am Waldboden lag. Er blickte wieder hoch und sah dutzende Bäume hoch über sich, die sich im Wind wiegten. Er hörte ein gurgelndes Geräusch und blickte zu einem Bach hinüber, der nur wenige Schritte von seinem Kopf hinweg vorbeirieselte.
Sam stand auf und blickte sich in alle Richtungen um, seine Umgebung betrachtend. Er stand tief im Wald, allein, mit nur dem Licht, das durch die Äste hindurchschien. Er sah sich an und stellte fest, dass er vollständig bekleidet war, in der gleichen Kampfmontur, die er auch im Kolosseum getragen hatte. Es war still hier, einzig der Bach, die Vögel und einige entfernte Tiere waren zu hören.
Sam stellte erleichtert fest, dass die Zeitreise funktioniert hatte. Er war eindeutig an einem anderen Ort und Zeitpunkt—obwohl er keine Ahnung hatte, wo und wann das war.
Langsam überprüfte Sam seinen Körper und stellte fest, dass er keine gröberen Verletzungen erlitten hatte und immer noch in einem Stück war. Er spürte schrecklichen Hunger an seinem Magen zerren, doch damit konnte er leben. Zuerst musste er herausfinden, wo er war.
Er klopfte sich ab, um zu sehen, ob er irgendwelche Waffen bei sich hatte.
Unglücklicherweise hatte keine von ihnen die Reise mitgemacht. Er war wieder auf sich gestellt, auf seine bloßen Hände angewiesen.
Er fragte sich, ob er immer noch über Vampirkräfte verfügte. Er konnte immer noch eine unnatürliche Stärke durch seine Adern fließen fühlen und hatte den Eindruck, dass dem so war. Doch dann wiederum konnte er nicht sicher sein, bis die Zeit gekommen war.
Und die Zeit kam schneller, als er dachte.
Sam hörte einen Zweig knacken und drehte sich herum, um einen großen Bären zu sehen, der sich langsam und aggressiv über ihm auftürmte. Er erstarrte. Der Bär funkelte ihn an, hob die Hacken und knurrte.
Eine Sekunde später setzte er sich in Bewegung und stürmte direkt auf ihn zu.
Sam blieb keine Zeit, davonzulaufen, und nirgends, wohin er hätte laufen können. Er hatte keine Wahl, stellte er fest, als sich diesem Tier zu stellen.
Doch seltsamerweise, anstatt sich von Angst überwältigt zu fühlen, spürte Sam, wie eine Rage durch ihn floss. Er war auf das Tier wütend. Er hasste es, angegriffen zu werden, besonders bevor er überhaupt noch Gelegenheit gehabt hatte, sich zu orientieren. Und so griff Sam ohne nachzudenken ebenfalls an, bereit, dem Bären im Kampf gegenüberzutreten, genauso wie einem Menschen.
Sam und der Bär trafen auf halbem Weg aufeinander. Der Bär warf sich ihm entgegen, und Sam warf sich im Gegenzug auf ihn. Sam spürte die Kraft durch seine Adern fließen, spürte, wie sie ihm sagte, er sei unverwundbar.
Als er mitten in der Luft auf den Bären prallte, erkannte er, dass er recht hatte. Er packte den Bären an den Schultern und schleuderte ihn zur Seite. Der Bär flog rückwärts durch den Wald, mehrere Meter weit, und krachte in einen Baum.
Sam stand da und brüllte dem Bären entgegen, ein wildes Brüllen, lauter als das des Tieres. Er spürte, wie dabei die Muskeln und Adern in ihm anschwollen.
Der Bär kam langsam und wackelig wieder auf die Beine, und sah Sam mit etwas wie Schock an. Er humpelte nun, und nach einigen zögerlichen Schritten senkte er plötzlich den Kopf, drehte sich um und rannte davon.
Doch Sam würde ihn nicht so leicht davonkommen lassen. Er war nun wütend, und es fühlte sich an, als würde nichts in der Welt seine Wut besänftigen können. Und er war hungrig. Der Bär würde bezahlen.
Sam verfiel in einen Laufschritt und stellte erfreut fest, dass er schneller war als das Tier. In wenigen Momenten hatte er es eingeholt und mit einem einzelnen Satz landete er auf seinem Rücken. Er holte aus und versenkte seine Fangzähne tief in seinem Hals.
Der Bär heulte vor Schmerz, versuchte, ihn abzuwerfen, doch Sam hielt sich fest. Er versenkte seine Zähne tiefer, und in wenigen Momenten spürte er, wie der Bär unter ihm in die Knie ging. Endlich hörte er auf, sich zu bewegen.
Sam lag auf ihm, trank, fühlte, wie seine Lebenskraft durch seine Adern floss.
Schließlich lehnte Sam sich zurück und leckte sich die Lippen, die vor Blut tropften. Er hatte sich noch nie so erfrischt gefühlt. Es war genau die Mahlzeit, die er gebraucht hatte.
Sam kam gerade wieder auf die Beine, als er einen weiteren Zweig knacken hörte.
Er blickte sich um, und da auf der Waldlichtung stand ein junges Mädchen, vielleicht 17, in dünne, reinweiße Stoffe gehüllt. Sie stand da, hielt einen Korb und starrte ihn schockiert an. Ihre Haut war durchscheinend weiß, und ihr langes, braunes Haar umrahmte ihre großen blauen Augen. Sie war wunderschön.
Sie starrte ebenso gebannt Sam an.
Er erkannte, dass sie vor ihm Angst haben musste, Angst davor, dass er sie angreifen würde; er erkannte, dass er einen furchteinflößenden Anblick bieten musste, auf dem Rücken eines Bären, den Mund voll Blut. Er wollte sie nicht erschrecken.
Also sprang er von dem Tier herunter und kam einige Schritte auf sie zu.
Zu seinem Erstaunen zuckte sie nicht einmal zusammen oder versuchte, zurückzuweichen. Stattdessen starrte sie ihn einfach weiter an, furchtlos.
„Keine Sorge“, sagte er. „Ich werde dir nichts tun.“
Sie lächelte. Das überraschte ihn. Sie war nicht nur wunderschön, sondern auch wahrhaft furchtlos. Wie konnte das sein?
„Natürlich wirst du das nicht“, sagte sie. „Du bist einer von uns.“
Nun war Sam an der Reihe, geschockt zu sein. In dem Moment, als sie es sagte, wusste er, dass es wahr war. Er hatte etwas gespürt, als er sie erblickte, und nun wusste er es. Sie war von seiner Art. Ein Vampir. Deswegen hatte sie keine Angst.
„Netter Abschuss“, sagte sie und deutete auf den Bären. „Ein wenig unordentlich, würde ich sagen. Warum nicht lieber ein Reh?“
Sam lächelte. Sie war nicht nur hübsch—sondern auch lustig.
„Vielleicht beim nächsten Mal“, erwiderte er.
Sie lächelte.
„Würde es dir etwas ausmachen, mir zu verraten, welches Jahr wir haben?“, fragte er. „Oder zumindest, welches Jahrhundert?“
Sie lächelte nur und schüttelte den Kopf.
„Ich denke, das lasse ich dich selbst herausfinden. Wenn ich es dir sage, verdirbt das doch nur den Spaß, oder?“
Sie gefiel Sam. Sie hatte Feuer. Und er fühlte sich in ihrer Gegenwart wohl, als würde er sie schon ewig kennen.
Sie trat einen Schritt vor und streckte die Hand aus. Sam nahm sie und genoss, wie weich sich ihre durchscheinende Haut anfühlte.
„Ich bin Sam“, sagte er, schüttelte die Hand und hielt sie etwas zu lange fest.
Sie lächelte breiter.
„Das weiß ich“, sagte sie.
Sam war verblüfft. Wie war es nur möglich, dass sie das wusste? War er ihr schon einmal begegnet? Er konnte sich nicht entsinnen.
„Ich wurde zu dir geschickt“, fügte sie hinzu.
Plötzlich wandte sie sich um und begann, einen Waldpfad entlang zu wandern.
Sam eilte ihr nach, vermutend, dass sie wollte, dass er ihr folgte. Nicht darauf achtend, wohin er trat, stolperte er peinlicherweise über einen Ast; er konnte sie dabei kichern hören.
„Also?“, bohrte er nach. „Wirst du mir nicht verraten, wie du heißt?“
Sie kicherte wieder.
„Nun, ich habe einen offiziellen Namen, doch den verwende ich selten“, sagte sie.
Dann wandte sie sich zu ihm und wartete, bis er sie eingeholt hatte.
„Wenn du es wissen musst, alle nennen mich Polly.“
KAPITEL VIER
Caleb hielt das riesige mittelalterliche Tor auf, und Caitlin trat aus der Abtei hinaus und tat ihre ersten Schritte in das frühe Morgenlicht hinaus. Mit Caleb an ihrer Seite blickte sie ins Morgengrauen hinaus. Hoch hier oben auf dem Hügel von Montmartre konnte sie ganz Paris vor sich ausgebreitet sehen. Es war eine wunderschöne, weitläufige Stadt, eine Mischung aus klassischer Architektur und schlichten Häusern, aus Kopfsteinpflaster-Straßen und unbefestigten Wegen, aus Bäumen und Urbanität. Am Himmel mischten sich Millionen sanfter Farbtöne und brachten den Anblick der Stadt zum Leben. Es war zauberhaft.
Noch zauberhafter war die Hand, die sie in ihrer spürte. Sie blickte zu Caleb hinüber, der an ihrer Seite stand, den Ausblick mit ihr genoss, und sie konnte kaum glauben, dass es echt war. Sie konnte kaum glauben, dass es wirklich er war, dass sie wirklich hier waren. Zusammen. Dass er wusste, wer sie war. Dass er sich an sie erinnerte. Dass er sie gefunden hatte.
Sie fragte sich erneut, ob sie wirklich aus dem Traum erwacht war oder doch immer noch schlief.
Doch als sie dastand und seine Hand fester drückte, wusste sie, dass sie wirklich wach war. Sie hatte sich noch nie so überglücklich gefühlt. Sie war schon so lange gelaufen, war durch die Zeit gereist, all diese Jahrhunderte, so weit, nur um bei ihm zu sein. Nur um sich zu versichern, dass er wieder lebte. Als er sie in Italien nicht erkannt hatte, hatte sie das auf die Grundfesten erschüttert.
Doch nun, da er hier war, und am Leben, und sich an sie erinnerte—und nun, da er ihr allein gehörte, ledig, ohne Sera im Bilde—schwoll ihr Herz mit neuen Emotionen an, und mit neuer Hoffnung. Sie hatte sich in ihren wildesten Träumen nicht vorstellen können, dass alles am Ende so perfekt sein konnte, dass es tatsächlich wirklich funktionieren konnte. Sie war so überwältigt, dass sie gar nicht wusste, wo sie anfangen oder was sie sagen sollte.
Bevor sie etwas sagen konnte, fing er an.
„Paris“, sagte er und drehte sich breit lächelnd zu ihr herum. „Es gibt wahrlich schlechtere Orte, an denen wir gemeinsam sein könnten.“
Sie lächelte zurück.
„Mein ganzes Leben lang habe ich es schon sehen wollen“, antwortete sie.
Mit jemandem, den ich liebe, wollte sie hinzufügen, doch hielt sich zurück. Es fühlte sich so lange an, seit sie an Calebs Seite gewesen war, dass sie tatsächlich wieder nervös wurde. Auf manche Art fühlte es sich an, als wäre sie schon ewig mit ihm zusammen—länger als ewig—doch auf andere Art fühlte es sich an, als würde sie ihm zum ersten Mal begegnen.
Er streckte ihr die offene Hand entgegen.
„Würdest du es dir mit mir ansehen?“, fragte er.
Sie legte ihre Hand in seine.
„Der Weg hinunter ist lang“, sagte sie und blickte den steilen Hügel hinunter, der sich meilenweit hinunterzog und sich in Paris hineinschwenkte.
„Ich habe mir etwas mit mehr Aussicht vorgestellt“, antwortete er. „Fliegen.“
Sie rollte ihre Schulterblätter nach hinten und versuchte, festzustellen, ob ihre Flügel betriebsbereit waren. Sie fühlte sich so erfrischt, so erholt von dem Trunk weißen Bluts—doch sie war sich immer noch nicht sicher, ob sie fliegen konnte. Und sie fühlte sich nicht dazu bereit, einen Berg hinunter zu springen in der Hoffnung, dass ihre Flügel greifen würden.
„Ich glaube, ich bin noch nicht soweit“, sagte sie.
Er sah sie an und verstand.
„Flieg mit mir“, sagte er, dann fügte er lächelnd hinzu: „Wie in alten Zeiten.“
Sie lächelte, umarmte ihn von hinten und hielt sich an seinem Rücken und Schultern fest. Sein muskulöser Körper fühlte sich in ihren Armen so gut an.
Er sprang plötzlich in die Luft, so schnell, dass sie kaum Zeit hatte, sich gut festzuhalten.
Bevor sie wusste, wie ihr geschah, flogen sie; sie klammerte sich an seinen Rücken, blickte hinunter, lehnte ihren Kopf gegen sein Schulterblatt. Sie spürte das vertraute Kribbeln in ihrem Magen, als sie sich nach unten stürzten, tief hinunter, nahe an der Stadt, in den Sonnenaufgang hinein. Es war atemberaubend.
Doch nichts davon war so atemberaubend wie die Tatsache, dass sie wieder in seinen Armen war, ihn festhielt, mit ihm zusammen war. Sie war kaum erst eine Stunde mit ihm zusammen, und jetzt schon betete sie, dass sie nie wieder getrennt sein würden.
*
Das Paris, über das sie hinwegflogen, das Paris von 1789, war auf viele Arten ähnlich den Bildern von Paris, die sie im 21. Jahrhundert gesehen hatte. Sie erkannte so viele der Gebäude wieder, die Kirchen, die Türme, die Denkmäler. Obwohl es hunderte Jahre alt war, sah es fast wie genau die gleiche Stadt aus wie im 21. Jahrhundert. Genau wie Venedig oder Florenz hatte sich nur wenig in den paar hundert Jahren verändert.
Doch auf andere Weise war es sehr anders. Es war nicht annähernd so ausgebaut. Obwohl einige Straßen mit Kopfstein gepflastert waren, waren viele unbefestigt. Es war nicht annähernd so dicht bebaut, und inzwischen der meisten Gebäude standen immer noch kleine Baumgruppen, fast wie eine Stadt, die in einen hereinkriechenden Wald hineingebaut war. Anstatt von Autos gab es Pferde, Kutschen, Menschen, die im Staub zu Fuß gingen oder Karren schoben. Alles war langsamer, entspannter.
Caleb sank tiefer, bis sie nur knapp über den Dächern der Gebäude dahinflogen. Als sie am letzten von ihnen vorbei waren, tat sich plötzlich der Himmel auf, und vor ihnen breitete sich die Seine aus, der Fluss, der sich seinen Weg mitten durch die Stadt bahnte. Sie schimmerte gelb im Licht des frühen Morgens, und es raubte ihr den Atem.
Caleb sank tiefer, flog über sie hinweg, und sie bestaunte die Schönheit der Stadt, wie romantisch sie war. Sie flogen über die kleine Insel Ile de la Cite hinweg, und sie erkannte Notre Dame unter ihr, ihr hoher Kirchturm über alles andere hinweg ragend.
Caleb sank noch tiefer, direkt über das Wasser, und die kühle Luft am Fluss kühlte sie an diesem heißen Julimorgen ab. Caitlin blickte auf und sah Paris zu beiden Seiten des Flusses, während sie über und unter den zahlreichen gewölbten Fußbrücken flogen, die eine Seite des Flusses mit der anderen verbanden. Dann stieg Caleb mit ihnen höher und zu einer Seite des Flussufers, setzte sie sanft hinter einem großen Baum ab, verborgen vor jeglichen Passanten.
Sie blickte sich um und sah, dass er sie zu einer ausladenden Park- und Gartenanlage gebracht hatte, die sich meilenweit entlang des Flusses auszudehnen schien.
„Die Tuilerien“, sagte Caleb. „Genau der gleiche Garten wie im 21. Jahrhundert. Nichts hat sich verändert. Es ist immer noch der romantischste Ort in ganz Paris.“
Mit einem Lächeln fasste er ihre Hand. Sie begannen, gemeinsam zu spazieren, einen Pfad entlang, der sich durch den Garten schlängelte. Sie hatte sich noch nie so glücklich gefühlt.
So viele Fragen brannten ihr auf der Zunge, so viele Dinge, die sie ihm unbedingt sagen wollte, dass sie gar nicht wusste, wo sie anfangen sollte. Doch sie musste irgendwo anfangen, also dachte sie sich, sie würde einfach mit dem beginnen, was ihr als erstes einfiel.
„Danke“, sagte sie, „für Rom. Für das Kolosseum. Dafür, dass du mich gerettet hast“, sagte sie. „Wenn du nicht genau in dem Moment aufgetaucht wärst, weiß ich nicht, was passiert wäre.“
Sie sah ihn an, plötzlich unsicher. „Erinnerst du dich?“, fragte sie besorgt.
Er blickte sie an und nickte, und sie konnte sehen, dass er es tat. Sie war erleichtert. Zumindest waren sie endlich wieder am gleichen Punkt. Ihre Erinnerungen waren wieder da. Das allein bedeutete ihr die Welt.
„Doch ich habe dich nicht gerettet“, sagte er. „Du hast dich ganz gut ohne mich geschlagen. Im Gegenteil, du hast mich gerettet. Allein mit dir zusammen zu sein—ich weiß nicht, was ich ohne dich tun würde“, sagte er.
Als er ihre Hand drückte, fühlte sie, wie sich langsam ihre ganze Welt wieder in ihr geradebog.
Während sie durch die Garten schlenderten, betrachtete sie bewundernd all die verschiedenen Blumenarten, die Brunnen, die Statuen…es war einer der romantischsten Orte, an denen sie je gewesen war.
„Und es tut mir leid“, fügte sie hinzu.
Er blickte sie an, und sie fürchtete sich, es auszusprechen.
„Um deinen Sohn.“
Sein Gesicht verfinsterte sich, und als er sich abwandte, sah sie wahre Trauer über sein Gesicht blitzen.
Dämlich, dachte sie. Warum musst du immer die Stimmung ruinieren? Warum hast du nicht auf einen anderen Zeitpunkt warten können?
Caleb schluckte und nickte, zu überwältigt von Trauer, um überhaupt zu sprechen.
„Und es tut mir leid um Sera“, fügte Caitlin hinzu. „Ich hatte nie die Absicht, zwischen euch beide zu treten.“
„Es braucht dir nicht leid tun“, sagte er. „Es hat mit dir nichts zu tun. Das ist eine Sache zwischen ihr und mir. Wir waren nie dazu bestimmt, zusammenzusein. Es war von Anfang an ein Fehler.“
„Nun, und zum Abschluss wollte ich dir sagen, dass es mir leid tut, was in New York passiert ist“, fügte sie hinzu und verspürte die Erleichterung darüber, es sich von der Brust zu reden. „Ich hätte nie zugestochen, wenn ich gewusst hätte, dass du das warst. Ich schwöre, ich dachte, du wärst jemand anders, der deine Gestalt angenommen hatte. In einer Million Jahren hätte ich nicht gedacht, dass du das warst.“
Sie fühlte, wie ihr beim Gedanken daran Tränen in die Augen stiegen.
Er blieb stehen und sah sie an, und hielt sie an den Schultern fest.
„Nichts davon ist jetzt von Bedeutung“, sagte er voll Ernst. „Du bist zurückgekommen, um mich zu retten. Und ich weiß, dass es dich viel gekostet hat. Es hätte gut sein können, dass es nicht funktioniert. Und du hast dein Leben für mich riskiert. Und hast unser Kind für mich aufgegeben“, sagte er, vor Trauer noch einmal kurz den Blick senkend. „Ich liebe dich mehr, als ich sagen kann“, sagte er, immer noch zu Boden blickend.
Er blickte sie mit feuchten Augen an.
In dem Moment küssten sie sich. Sie fühlte, wie sie in seinen Armen dahinschmolz, spürte, wie ihre ganze Welt sich entspannte, während sie sich eine gefühlte Ewigkeit lang küssten. Es war der schönste Moment, den sie je mit ihm verbracht hatte, und auf manche Weise schien es ihr, als würde sie ihn zum ersten Mal kennenlernen.
Endlich trennten sie sich langsam und blickten einander tief in die Augen.
Dann wandten sie beide verschämt den Blick ab, nahmen einander an der Hand und setzten ihren Spaziergang durch den Garten fort, am Fluss entlang. Sie sah, wie wunderschön und romantisch Paris war, und in dem Moment wurde ihr bewusst, dass all ihre Träume gerade wahr wurden. Das hier war alles, was sie sich vom Leben je gewünscht hatte. Mit jemandem zusammen zu sein, der sie liebte—sie wirklich liebte. In einer so schönen Stadt zu sein, an einem so romantischen Ort. Sich zu fühlen, als hätte sie ein Leben vor sich.
Caitlin fühlte den juwelenbesetzten Behälter in ihrer Tasche und mochte ihn gar nicht. Sie wollte ihn nicht öffnen. Sie liebte ihren Vater sehr, doch sie wollte keinen Brief von ihm lesen. Sie wusste in dem Moment, dass sie ihre Mission nicht länger fortsetzen wollte. Sie wollte nicht riskieren, wieder in die Vergangenheit reisen zu müssen, oder noch irgendwelche Schlüssel finden zu müssen. Sie wollte einfach nur hier sein, in dieser Zeit, an diesem Ort, mit Caleb. In Frieden. Sie wollte nicht, dass sich irgendetwas änderte. Sie war fest entschlossen, alles Notwendige zu tun, um ihre wertvolle Zeit zusammen zu bewahren, damit sie auch wirklich zusammen bleiben konnten. Und ein Teil von ihr spürte, dass dies bedeuten würde, die Mission aufzugeben.
Sie wandte sich an ihn. Es machte sie nervös, es ihm zu sagen, doch sie hatte das Gefühl, dass sie es tun musste.
„Caleb“, sagte sie, „ich will nicht weiter suchen. Mir ist klar, dass ich eine besondere Mission habe, dass ich anderen helfen muss, dass ich das Schild finden muss. Und das hört sich vielleicht selbstsüchtig an, und es tut mir leid, wenn das so ist. Aber ich will einfach nur mit dir zusammen sein. Das ist mir jetzt am allerwichtigsten. In dieser Zeit und an diesem Ort zu bleiben. Ich habe das Gefühl, dass, wenn wir weitersuchen, wir in einer anderen Zeit, an einem anderen Ort landen werden. Und dass wir beim nächsten Mal vielleicht nicht zusammensein werden…“ Caitlin unterbrach sich und bemerkte, dass sie weinte.
Sie holte in der Stille tief Luft. Sie fragte sich, was er von ihr dachte, und hoffte, dass er es nicht missbilligte.
„Kannst du das verstehen?“, fragte sie zögerlich.
Er starrte auf den Horizont hinaus, blickte besorgt drein, dann wandte er sich endlich zu ihr. Ihre eigene Sorge stieg.
„Ich will den Brief meines Vaters nicht lesen oder noch irgendwelche Hinweise finden. Ich will nur, dass wir beide zusammen sind. Ich will, dass die Dinge genau so bleiben, wie sie jetzt gerade sind. Ich will nicht, dass sie sich ändern. Ich hoffe, du hasst mich nicht dafür.“
„Ich würde dich niemals hassen“, sagte er sanft.
„Aber du findest es nicht gut?“, setzte sie nach. „Du denkst, dass ich die Mission fortsetzen sollte?“
Er wandte den Blick ab, aber sagte nichts.
„Was ist los?“, fragte sie. „Machst du dir Sorgen um die anderen?“
„Ich denke, das sollte ich wohl“, sagte er. „Und das tue ich auch. Aber auch ich habe selbstsüchtige Gründe. Ich schätze…im Hinterkopf hatte ich gehofft, dass, wenn wir das Schild finden, es irgendwie helfen könnte, meinen Sohn zu mir zurück zu bringen. Jade.“
Caitlin verspürte ein schreckliches Schuldgefühl, als ihr bewusst wurde, dass er das Aufgeben der Mission damit gleichsetzte, seinen Sohn für immer aufzugeben.
„Aber so ist es doch gar nicht“, sagte sie. „Wir wissen nicht, ob es ihn zurückbringen würde, wenn wir das Schild finden, falls es überhaupt existiert. Aber was wir wissen, ist, dass wir zusammensein können, wenn wir nicht suchen. Hier geht es um uns. Das ist es, was mir am wichtigsten ist.“ Sie hielt inne. „Ist das auch dir am wichtigsten?“
Er blickte auf den Horizont hinaus und nickte. Aber er sah sie nicht an.
„Oder liebst du mich nur, weil ich dir helfen kann, das Schild zu finden?“, fragte sie.
Sie war erschrocken über sich selbst, dass sie tatsächlich den Mut gehabt hatte, diese Frage auszusprechen. Es war eine Frage, die in ihren Gedanken gebrannt hatte, seit sie ihn getroffen hatte. Liebte er sie nur für das, wohin sie ihn führen konnte? Oder liebte er sie um ihretwillen? Nun hatte sie die Frage endlich gestellt.
Ihr Herz pochte, während sie auf Antwort wartete.
Endlich drehte er sich herum und sah ihr tief in die Augen. Er hob die Hand und streichelte ihr langsam mit dem Handrücken die Wange.
„Ich liebe dich um deinetwillen“, sagte er. „Und das war schon immer so. Und wenn mit dir zusammenzusein bedeutet, die Suche nach dem Schild aufzugeben, dann werde ich genau das tun. Ich will auch hier mit dir zusammen sein. Ich will suchen, ja. Aber du bist mir jetzt viel wichtiger.“
Caitlin lächelte und spürte in ihrem Herzen etwas, das sie schon ewig nicht mehr gespürt hatte. Ein Sinn von Frieden, Stabilität. Nichts konnte ihnen jetzt mehr im Weg stehen.
Er strich ihr das Haar aus dem Gesicht und lächelte.
„Es ist komisch“, sagte er. „Ich habe schon einmal hier gelebt. Vor Jahrhunderten. Nicht in Paris, aber in diesem Land. In einer kleinen Burg. Ich weiß nicht, ob sie noch existiert. Aber wir können suchen.“