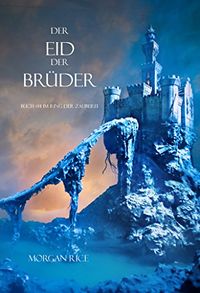Kitabı oku: «Der Eid Der Brüder », sayfa 3
Godfrey schlug einen nieder, und hielt einen weiteren fest, doch er verfiel in Panik, als der kleinste davonlief und im Begriff war, um die Ecke zu biegen. Er beobachtete aus dem Augenwinkel wie Ario ruhig vortrat, einen Stein aufhob, ihn in der Hand wog und dann warf.
Ein perfekter Wurf traf den Finianer an der Schläfe, als er gerade um die Ecke biegen wollte, und ließ ihn zu Boden gehen. Ario rannte zu ihm hinüber, zog ihm seinen Mantel aus und zog ihn an – offensichtlich hatte er Godfreys Plan verstanden.
Godfrey, der immer noch mit dem anderen Finianer kämpfte, konnte ihm schließlich seinen Ellbogen ins Gesicht rammen und ihn KO schlagen. Merek würgte seinen lange genug, sodass er das Bewusstsein verlor und Godfrey beobachtete, wie sich Merek auf den letzten Finianer rollte und ihm einen Dolch an die Kehle drückte.
Godfrey wollte Merek gerade zurufen, aufzuhören, als eine Stimme ihm zuvorkam.
„Nein!“, befahl eine barsche Stimme.
Godfrey blickte auf und sah, dass Ario über Merek stand und ihn missmutig ansah.
„Töte ihn nicht!“, befahl Ario.
Merek sah ihn finster an.
„Tote Männer reden nicht“, sagte Merek. „Wenn ich ihn gehen lasse, sterben wir alle.“
„Egal!“, sagte Ario. „Er hat dir nichts getan. Er wird nicht getötet.“
Trotzig stand Merke auf und sah Ario an.
„Du bist halb so groß wie ich, Junge“, zischte Merek. „Und ich habe einen Dolch. Fordere mich nicht heraus.“
„Vielleicht bin ich halb so groß wie du“, antwortete Ario ruhig. „Doch ich bin doppelt so schnell. Greif mich an und ich werde dir den Dolch abnehmen und dir den Hals aufschlitzen, bevor du fertig ausgeholt hast.“
Godfrey war erstaunt über den verbalen Schlagabtausch besonders, weil Ario so ruhig war. Es war surreal. Er blinzelte nicht, bewegte keinen Muskel und sprach, als hätte er die ruhigste Konversation auf Erden. Und das machte seine Worte noch überzeugender.
Merek musste derselben Meinung gewesen sein, denn er bewegte sich nicht. Godfrey wusste, dass er sie unterbrechen musste, und zwar schnell.
„Das ist nicht der Feind.“, sagte Godfrey, und ergriff Mereks Handgelenk mit dem Dolch. „Der Feind ist da draußen. Wenn wir gegeneinander kämpfen, haben wir keine Chance.“
Glücklicherweise senkte Merek seine Hand und steckte den Dolch weg.
„Beeilt euch jetzt. Entkleidet sie und legt ihre Kleider an. Wir sind jetzt Finianer.“
Sie zogen die Finianer aus und warfen sich ihre leuchtend roten Umhänge mit den Kapuzen um.
„Das ist lächerlich“, sagte Akorth.
Godfrey sah ihn an und sah, dass sein Bauch zu dick und er zu groß war; der Umhang war zu kurz für ihn und reichte ihm gerade mal bis zu den Waden.
Merek kicherte.
„Hättest vielleicht ein Bier weniger trinken sollen“, sagte er.
„Ich zieh das nicht an!“, sagte Akorth.
„Das ist keine Modenschau“, sagte Godfrey. „Willst du dich lieber erwischen lassen?“
Akorth fügte sich mürrisch.
Godfrey stand da und betrachtete seine Gruppe. Alle trugen sie die roten Mäntel, doch sie waren in einer fremden Stadt, umgeben von Feinden. Ihre Chancen waren bestenfalls gering.
„Was jetzt?“, fragte Akorth.
Godfrey drehte sich um und blickte in Richtung der Hauptstraße. Er wusste, dass die Zeit reif war.
„Lasst uns gehen und uns ein wenig in Volusia umsehen.“
KAPITEL FÜNF
Thor stand am Bug eines kleinen Segelschiffs. Reece, Selese, Elden, Indra, Matus und O’Connor saßen hinter ihm. Keiner von ihnen ruderte, denn ein mysteriöser Wind und die Strömung machten alle Bemühungen vergeblich. Er würde sie schon irgendwo hintreiben, und kein noch so angestrengtes Rudern oder Segeln änderte etwas daran. Thor blickte zurück über seine Schulter, und betrachtete die massiven schwarzen Klippen des Landes der Toten, von denen sie sich immer weiter entfernten, und fühlte sich erleichtert. Es war an der Zeit, nach vorn zu blicken, Guwayne zu finden, und ein neues Kapitel in seinem Leben aufzuschlagen.
Thor blickte hinter sich und bemerkte, dass Selese neben Reece im Boot saß und seine Hand hielt. Der Anblick war befremdlich. Thor war hoch erfreut, sie zurück im Land der Lebenden zu haben und froh, seinen besten Freund so glücklich zu sehen. Doch er musste zugeben, dass es ein unheimliches Gefühl war, sie zu sehen. Da saß Selese, die tot gewesen war, und nun wieder am Leben war. Er fühlte sich, als hätten sie irgendwie die natürliche Ordnung verändert. Als er sie genauer ansah, bemerkte er, dass sie durchscheinend, ätherisch war, und auch wenn sie wirklich in Fleisch und Blut hier war, konnte er sich nicht dazu bringen, sie als etwas anderes als eine Tote zu betrachten. Er fragte sich, ob sie wirklich für immer zurückgekehrt war, oder wie lange sie bei Reece bleiben würde, bis sie zurückkehrte.
Doch Reece sah es offensichtlich anders. Er war bis über beide Ohren in sie verliebt und seit langem nicht mehr so glücklich gewesen. Thor konnte ihn verstehen: Wer würde nicht zu gerne die Dinge, die schief gelaufen waren, richtigstellen, Fehler der Vergangenheit wieder gutmachen und jemanden wiedersehen, von dem man gedacht hatte, dass man ihn nie wiedersehen würde? Reece hielt ihre Hand fest, blickte in ihre Augen und sie streichelte sein Gesicht, während er sie küsste.
Thor bemerkte, dass die anderen verloren aussahen, als ob sie in den Tiefen der Hölle gewesen waren, an einem Ort, den sie nur schwer wieder vergessen konnten. Wie unsichtbare Spinnweben lastete es schwer auf ihnen, und auch Thor spürte es, und musste immer wieder die Erinnerungen abschütteln. Sie waren umgeben von einer Aura des Schwermuts und betrauerten alle den Verlust von Conven. Besonders Thor zermarterte sich das Gehirn, ob er nicht irgendetwas hätte tun können, um ihn von seiner Entscheidung abzubringen. Thor blickte hinaus aufs Meer ließ den Blick über das endlose Meer und den grauen Horizont schweifen und fragte sich, wie Conven nur diese Entscheidung hatte treffen können. Er verstand seine tiefe Trauer um seinen Bruder doch Thor hätte nie denselben Schritt getan. Thor trauerte um Conven, der immer bei ihm gewesen war, seit seinen ersten Tagen in der Legion. Thor erinnerte sich daran, wie er ihn im Gefängnis besucht hat, ihn mit einer zweiten Chance zurück ins Leben geholt hatte, all seine Versuche, ihn aufzumuntern und ihn ins hier und jetzt zurückzuholen.
Doch Thor erkannte, dass es ihm, egal was er getan hatte, nie ganz gelungen war, Conven zurückzubringen. Ein Teil von Conven war immer bei seinem Bruder. Thor erinnerte sich an den Blick auf Convens Gesicht als er zurückgeblieben war. Es war kein Ausdruck des Bedauerns, es war echte Freude. Thor spürte, dass er glücklich war. Und er wusste, dass er es nicht zu sehr bedauern sollte. Conven hatte seine Entscheidung getroffen, und das war mehr, als die meisten Menschen auf dieser Welt je bekamen. Und schließlich wusste Thor, dass sie sich wiedersehen würden. Vielleicht würde Conven derjenige sein, der ihn begrüßte, wenn er starb. Der Tod stand ihnen allen bevor. Vielleicht nicht heute oder morgen. Doch eines Tages.
Thor versuchte, die düsteren Gedanken abzuschütteln; er blickte aufs Meer hinaus und zwang sich, sich auf das Meer zu konzentrieren. Er blickte in alle Richtungen und suchte nach einem Zeichen von Guwayne. Er wusste, dass er hier, auf dem offenen Meer, wahrscheinlich vergeblich suchte, doch Thor fühlte sich angespornt, voll von neuem Optimismus. Er wusste jetzt zumindest, dass Guwayne am Leben war, und das war alles was er gebraucht hatte. Nichts würde ihn davon abhalten, ihn zu finden.
„Was denkst du, wo die Strömung uns hinträgt?“, fragte O’Connor, während er die Finger in die Wellen hielt.
Auch Thor bückte sich und hielt eine Hand ins warme Wasser; die Strömung war so schnell, als ob das Meer sie nicht schnell genug ans Ziel bringen konnte.
„So lange es weit weg von hier ist, ist mir alles recht“, sagte Elden und blickte dabei über seine Schulter zurück zu den Klippen.
Thor hörte ein Kreischen hoch oben, und war hoch erfreut, seine alte Freundin Estopheles zu sehen, die hoch oben über ihm kreiste. Sie tauchte in weiten Kreisen herab, dann erhob sie sich wieder in die Lüfte. Thor hatte das Gefühl, dass sie sie führte, und sie dazu ermuntern wollte, ihr zu folgen.
„Estopheles, liebe Freundin“, flüsterte Thor gen Himmel. „Sei unsere Augen. Führe uns zu Guwayne.“
Als ob sie ihm antwortete, schrie Estopheles wieder und spreizte ihre Flügel. Sie drehte ab und flog dem Horizont entgegen, in dieselbe Richtung in die die Strömung sie trug, und Thor war sich sicher, dass sie dem Ziel näher kamen.
Als Thor ein leises Klirren neben sich hörte, blickte er hinab und sah das Schwert des Todes an seinem Gürtel hängen. Es erschreckte ihn, es dort zu sehen. Es ließ ihre Reise ins Land der Toten realer denn je erscheinen. Thor legte die Hand auf den Elfenbein-Griff in den Schädel und Knochen eingeschnitzt waren, und als er seinen Griff fester darum schloss, spürte er seine Energie. In die Klinge waren kleine schwarze Diamanten eingelegt, und als er sie hochhielt um sie genauer zu betrachten, glitzerten sie im Licht.
Als er das Schwert hielt, fühlte es sich richtig an, als hätte es schon immer ihm gehört. Er hatte dieses Gefühl zuletzt gehabt, als er das Schwert des Schicksals in seinen Händen gehalten hatte. Diese Waffe bedeutete ihm mehr, als er auszudrücken vermochte; schließlich war es ihm gelungen dieser Welt zu entkommen und mit ihm diese Waffe, und er hatte das Gefühl, dass sie beide die Überlebenden eines furchtbaren Krieges waren. Sie hatten ihn gemeinsam durchgestanden. Das Land der Toten zu betreten und es wieder zu verlassen, hatte sich angefühlt, als wären sie durch ein gigantisches Spinnennetz gegangen, und hätten es dabei zerrissen. Sie waren frei, doch er hatte das Gefühl, dass das Netz noch an ihm klebte. Zumindest hatte er dort die Waffe bekommen.
Thor dachte darüber nach, wie sie das Land der Toten verlassen hatten, über den Preis, den sie bezahlt hatten indem sie unbeabsichtigt die Dämonen auf die Welt losgelassen hatten. Er hatte ein seltsames Gefühl im Bauch, spürte, dass er eine finstere Macht auf die Welt losgelassen hatte, eine die man nicht so leicht wieder einfangen konnte. Er hatte das Gefühl, dass er etwas freigelassen hatte, das eines Tages wie ein Bumerang zum ihm zurückkommen würde. Vielleicht sogar früher als er dachte. Bereit hielt Thor den Griff fest in der Hand. Was auch immer es war, er würde sich ihm furchtlos im Kampf stellen und töten, was auch immer sich ihm in den Weg stellte.
Doch was er wirklich fürchtete, waren die Dinge, die er nicht sehen konnte, das unsichtbare Chaos, das die Dämonen womöglich anrichten würden. Was er am meisten fürchtete, waren die Geister, die im Stillen kämpften.
Thor hörte schritte, spürte, wie das kleine Boot schaukelte, drehte sich um und sah Matus, der zu ihm kam. Matus stand traurig neben ihm und blickte zum Horizont hinaus. Es war ein trüber, düsterer Tag, und als sie aufs Meer hinausblickten, war es schwer zu sagen, ob es Morgen oder Nachmittag war, der Himmel in einheitlich düsterem Grau als ob die ganze Welt trauerte.
Thor dachte daran, wie schnell Matus ihm ans Herz gewachsen und ein enger Freund geworden war. Besonders jetzt, wo Reece auf Selese fixiert war, spürte Thor dass er einen Freund zumindest den teilweisen verloren und einen neuen gewonnen hatte. Thor erinnerte sich daran, wie Matus ihn mehr als einmal dort unten gerettet hatte, und fühlte eine tiefe Verbundenheit mit ihm, als wäre er schon immer einer seiner Brüder gewesen.
„Dieses Boot“, sagte Matus leise, „war nicht für das offene Meer gemacht. Ein guter Sturm und wir sind alle tot. Es ist nicht mehr als ein Beiboot von Gwendolyns Schiff, nicht dafür gebaut, über das Meer zu segeln. Wir müssen ein größeres Boot finden.“
„Und Land“, mischte sich O’Connor ein, der ebenfalls neben Thor getreten war. „und Vorräte.“
„Und eine Karte“, fügte Elden hinzu.
„Was ist eigentlich unser Ziel?“, fragte Indra. „Wo gehen wir hin? Hast du irgendeine Idee, wo dein Sohn sein könnte?“
Thor betrachtete den Horizont wie schon zehntausend Mal zuvor, und dachte über die Anmerkungen nach. Er wusste, dass sie Recht hatten, und hatte dasselbe gedacht. Vor ihnen lag das weite Meer, und sie waren auf einem kleinen Boot ohne Vorräte. Sie waren am Leben, und er war dankbar dafür, doch ihre Situation war heikel.
Thor schüttelte langsam den Kopf. Während er gedankenversunken dastand, sah er etwas am Horizont. Als sie näher segelten, wurde es deutlicher, und er war sich sicher, dass seine Augen ihm keinen Streich spielten. Sein Herz raste vor Aufregung.
Die Sonne brach durch die Wolken, und ein einzelner Sonnenstrahl traf eine kleine Insel. Es war eine kleine Landmasse mitten im Meer, vollkommen isoliert.
Thor blinzelte und fragte sich, ob es real war.
„Was ist das?“ Matus stellte die Frage, die ihnen allen auf den Lippen lag.
Als sie näher kamen, sah Thor den Nebel, der die Insel umgab und im Licht glitzerte, und spürte die magische Energie dieses Ortes. Er blickte auf und sah, dass es ein karger Ort war, Klippen, die sich steil aus dem Meer erhoben, fast hundert Meter; eine unerbittliche Insel, von rauer See umgeben, die sich an den Felsen brach, die sie umgaben, und sich aus dem Meer erhoben wie uralte Seemonster. Thor spürte mit jeder Faser seines Seins, dass dies der Ort war, an den sie gehen mussten.
„Das ist ein steiler Aufstieg“, sagte O’Connor. „Wenn wir es überhaupt bis nach Oben schaffen.“
„Und wir wissen nicht, was uns auf dem Gipfel erwartet“, fügte Elden hinzu. „Könnte feindlich sein. Unsere Waffen sind alle verschwunden, ausgenommen dein Schwert. Wir können es uns nicht erlauben, hier zu kämpfen.“
Doch Thor betrachtete die Insel, und er staunte, denn er spürte eine starke Macht hier. Er blickte hoch hinauf und sah, dass Estopheles die Insel umkreiste, und war sich noch sicherer, dass dies der Ort war.
„Wir müssen jeden Stein auf der Suche nach Guwayne umdrehen“, sagte Thor. „Kein Ort ist zu abgelegen. Diese Insel ist unser erster Halt“, sagte er. Er schloss seine Hand fester um den Griff des Schwertes. „Feindlich oder nicht.“
KAPITEL SECHS
Alistair fand sich in einer seltsamen Landschaft wieder, die ihr unbekannt war. Es war eine Wüste, und als sie den Boden betrachtete, verfärbte er sich von Schwarz zu Rot, trocknete aus und riss unter ihren Füssen. Als sie aufblickte, sah sie in der Ferne Gwendolyn vor einer bunt zusammengewürfelten Armee stehen, ein paar Dutzend Mann, Männer der Silver, die Alistair erkannte, mit blutigen Gesichtern und gebrochenen Rüstungen. In Gwendolyns Armen lag ein kleines Baby, und Alistair spürte, dass es ihr Neffe Guwayne war.
„Gwendolyn“, rief Alistair, erleichtert sie zu sehen. „Meine Schwester!“
Doch während Alistair sie beobachtete hörte sie plötzlich ein schreckliches Geräusch, der Klang einer Million flatternder Flügel, die lauter wurden und laut kreischten. Der Horizont wurde schwarz als sich der Himmel mit Raben füllte, die in ihre Richtung flogen.
Alistair sah schreckensstarr zu, wie die Raben als Riesiger Schwarm Gwendolyn erreichten, eine schwarze Wand, und sich herunterstürzten und Guwayne aus ihren Armen rissen. Kreischend trugen sie ihn gen Himmel.
„Nein!“, schrie Gwendolyn und streckte die Arme zum Himmel während sie ihr an den Haaren zerrten.
Alistair sah hilflos zu und ihr blieb nichts übrig als zuzusehen, wie sie das schreiende Baby davon trugen. Der Wüstenboden riss weiter, und tiefe spalten bildeten sich, in die Gwendolyns Männer, einer nach dem anderen, hineinstürzten.
Nur Gwendolyn blieb übrig und stand da und starrte sie mit einem gequälten Blick an, von dem Alistair sich wünschte, ihn nie gesehen zu haben.
Alistair blinzelte und fand sich auf einem großen Schiff mitten auf dem Ozean wieder. Wellen schlugen an den Bug. Sie sah sich um und bemerkte, dass sie der einzige Mensch an Bord war. Als sie voraus blickte, sah sie ein weiteres Schiff vor ihr. Erec stand am Heck und sah sie an, gemeinsam mit hunderten von Kriegern von den Südlichen Inseln. Es bekümmerte sie, ihn auf einem anderen Schiff zu sehen, das sich von ihr entfernte.
„Erec!“, rief sie.
Er starrte sie an und streckte die Hand nach ihr aus.
„Alistair!“, rief er, „komm zurück zu mir!“
Alistair musste geschockt mitansehen wie sich die Schiffe weiter voneinander entfernten – Erecs Schiff wurde von der Strömung davongetrieben. Sein Schiff begann, sich langsam im Wasser zu drehen und wurde immer schneller. Erec streckte die Hand nach ihr aus, doch sie konnte nur zusehen, wie sein Schiff immer weiter von einem Strudel in die Tiefe gerissen wurde, bis es schließlich ganz verschwand.
„EREC!“, schrie Alistair.
Ein anderer Schrei beantwortete ihren, und Alistair senkte den Blick um zu sehen, dass sie ein Baby in den Armen hielt – Erecs Kind. Es war ein Junge, und sein Kreischen erhob sich gen Himmel, übertönte das Heulen des Windes und des Regens und die Schreie der Männer.
Alistair erwachte schreiend. Sie richtete sich auf und sah sich um. Sie fragte sich, wo sie war und was geschehen war. Schwer atmend, versuchte sie sich zu sammeln und sie brauchte ein paar Minuten um zu erkennen, dass alles nur ein Traum gewesen war.
Sie stand auf und betrachtete die knarrenden Planken an Deck und erkannte, dass sie noch immer auf dem Schiff war. Die Erinnerungen stürzten auf sie ein: Ihre Abreise von den Südlichen Inseln, ihre Mission, Gwendolyn zu befreien.
„Mylady?“, hörte sie eine sanfte Stimme.
Alistair sah sich um und sah Erec neben sich stehen, der sie besorgt ansah. Sie war froh, ihn zu sehen.
„Wieder ein Alptraum?“, fragte er.
Sie nickte und senkte verlegen den Blick.
„Träume sind auf See viel lebhafter“, sagte eine andere Stimme.
Alistair drehte sich um und sah Strom, Erecs Bruder, ganz in der Nähe stehen. Sie sah sich weiter um und sah hunderte von Bewohnern der Südlichen Inseln an Bord des Schiffs und erinnerte sich an alles. Sie erinnerte sich an ihre Abreise, daran, dass sie die trauernde Dauphine zurückgelassen hatten, der sie gemeinsam mit ihrer Mutter die Verantwortung über die Inseln übertragen hatten. Seitdem sie die Nachricht erhalten hatten, hatten sie alle das Gefühl gehabt, keine andere Wahl zu haben, als ins Empire zu segeln und Gwendolyn und die anderen aus dem Ring zu suchen, gezwungen von ihrer Pflicht, sie zu retten. Sie wussten, dass es ein fast unmögliches Unterfangen war, doch es war ihnen egal. Es war ihre Pflicht.
Alistair rieb sich die Augen und versuchte, ihre Alpträume aus ihren Gedanken zu vertreiben. Sie wusste nicht, wie viele Tage sie schon auf dem endlosen Meer waren und als sie den Horizont betrachtete, konnte sie außer dichtem Nebel nichts erkennen.
„Der Nebel ist uns seit den Südlichen Inseln gefolgt“, sagte Erec, der sie beobachtet hatte.
„Lass uns hoffen, dass es kein Omen ist“, fügte Strom hinzu.
Alistair strich sich sanft über den Bauch, und versicherte sich, dass es ihrem Baby gut ging. Ihr Traum war so real gewesen. Sie tat es schnell und heimlich, denn sie wollte nicht, dass Erec es wusste. Sie hatte es ihm noch nicht gesagt. Ein Teil von ihr wollte es ihm sagen – doch ein anderer wollte auf den perfekten Augenblick warten, wenn es sich richtig anfühlte.
Sie nahm Erecs Hand, erleichtert, ihn am Leben zu sehen.
„Ich bin froh, dass es dir gutgeht.“, sagte sie.
Sie lächelte ihn an und er zog sie zu sich heran und küsste sie.
„Und warum sollte es mir nicht gutgehen?“, sagte er. „Deine Träume sind nur Geister der Nacht. Für jeden Alptraum gibt es auch einen Mann, der in Sicherheit ist. Ich bin so sicher hier, bei dir, meinem loyalen Bruder und meinen Männern, wie ich es mir nur erhoffen kann.“
„Zumindest bis wir das Empire erreicht habe“, fügte Strom mit einem Lächeln hinzu. „Dann sind wir so sicher, wie wir es mit einer kleinen Flotte gegen zehntausende von Schiffen sein können.“
Strom lächelte, während er sprach. Er schien sich auf den bevorstehenden Kampf zu freuen.
Erec zuckte ernst mit den Schultern.
„Mit den Göttern hinter unserem Anliegen“, sagte er, „können wir nicht verlieren. Wie auch immer die Chancen stehen.“
Alistair löste sich von ihm und blickte finster drein.
„Ich habe gesehen wie du und dein Schiff auf den Grund des Meeres hinabgesaugt wurden. Ich habe dich an Bord gesehen“, sagte sie. Sie wollte den Teil mit ihrem Baby hinzufügen, doch hielt sich zurück.
„Träume sind nicht immer das, was sie zu sein scheinen“, sagte er. Doch tief in seinen Augen, sah sie seine Besorgnis aufblitzen. Er wusste, dass sie Dinge sehen konnte, und respektierte ihre Visionen.
Alistair holte tief Luft, blickte ins Wasser hinab und wusste, dass er Recht hatte. Sie waren schließlich alle hier. Doch der Traum war so greifbar gewesen.
Alistair stand an der Reling und musste sich gegen den Drang wehren, ihre Hand auf ihren Bauch zu legen, ihn zu spüren, sich zu versichern, dass das Baby in ihr wuchs. Doch mit Erec und Strom an ihrer Seite wollte sie sich nicht verraten.
Ein leises tiefes Horn hallte alle paar Minuten durch die Luft, und warnte die anderen Schiffe seiner Flotte über ihre Anwesenheit im Nebel.
„Das Horn könnte uns verraten“, sagte Strom zu Erec.
„Wem?“, fragte Erec.
„Wir wissen nicht, was hinter dem Nebel lauert“, sagte Strom.
Erec schüttelte den Kopf.
„Vielleicht“, antwortete er. „Dach die größere Gefahr ist im Augenblick nicht der Feind, sondern wir selbst. Wenn wir mit unseren eigenen Schiffen kollidieren, können wir die ganze Flotte versenken. Wir brauchen die Hörner bis sich der Nebel verzogen hat. Unsere Flotte kann so kommunizieren – und genauso wichtige wie eine Kollision zu verhindern – nicht zu weit voneinander abdriften.“
Im Nebel echote das Horn eines der anderen Schiffe aus Erecs Flotte, und bestätigte seine Position.
Alistair blickte in den Nebel und grübelte. Sie wusste, dass sie eine weite Reise vor sich hatten, dass sie auf der anderen Seite der Welt waren, und fragte sich, ob es ihnen jemals gelingen konnte Gwendolyn und ihren Bruder rechtzeitig zu erreichen. Sie fragte sich, wie lange der Falke dafür gebraucht hatte, die Nachricht zu ihnen zu bringen, und ob sie überhaupt noch am Leben waren. Sie fragte sich, was aus ihrem geliebten Ring geworden war. Welch schreckliche Art zu sterben, dachte sie, an einem fremden Ufer, weit weg von der Heimat.
„Das Empire ist auf der anderen Seite der Welt“, sagte Alistair zu Erec. „Es wird eine lange Reise werden. Warum bleibst du an Deck? Warum gehst du nicht unter Deck und schläfst ein wenig. Du hast seit Tagen kein Auge zugetan“, sagte sie, als sie die dunklen Ringe unter seinen Augen bemerkte.
„Ein Kommandant schläft nicht.“, sagte er. „Und davon abgesehen, wir sind fast am Ziel.“
„Am Ziel?“, fragte sie verwirrt.
Erec nickte und starrte in den Nebel.
Sie folgte seinem Blick, sagte jedoch nichts.
„Boulder Isle“, sagte er. „Unser erster Halt.“
„Doch warum?“, fragte sie. „Warum halten wir, bevor wir das Empire erreicht haben?“
„Wir brauchen eine größere Flotte“, mischte sich Strom ein, und beantwortete die Frage für ihn. „Wir können das Empire nicht mit einem paar Dutzend Schiffen angreifen.“
„Und du wirst diese Flotte auf Boulder Isle finden?“, fragte Alistair.
Erec nickte.
„Vielleicht“, sagte er. „Bouldermen, die Bewohner von Boulder, haben Schiffe und Männer, mehr als wir haben. Sie hassen das Empire. Und sie haben in der Vergangenheit meinem Vater gedient.“
„Doch warum sollten sie dir helfen?“, fragte sie. „Wer sind diese Leute?“
„Söldner“, erklärte Strom. „Raue Männer von einer rauen Insel umgeben von rauer See. Sie kämpfen für den, der am meisten bietet.“
„Piraten“, sagte sie missbilligend.
„Nicht wirklich“, antwortete Strom. „Piraten wollen Beute. Bouldermen leben für das Töten.“
Alistair sah Erec an und konnte an seinem Gesicht ablesen, dass es wahr war.
„Ist es edel, mit Piraten für eine gute Sache zu kämpfen?“, fragte sie. „Söldnern?“
„Es ist edel einen Krieg zu gewinnen“, antwortete Erec. „Und für eine gerechte Sache wie die unsere zu kämpfen. Die Mittel mögen nicht immer so edel sein, wie wir es vielleicht gerne hätten.“
„Es ist nicht edel zu sterben“, fügte Strom hinzu. „Und das Urteil was den Edelmut angeht wir von den Siegern gefällt, nicht von den Verlierern.“
Alistair blickte finster drein und Erec wandte sich ihr zu.
„Nicht jeder ist so nobel wie du, Mylady.“, sagte er. „Oder ich. So funktioniert die Welt nun einmal nicht. So gewinnt man keine Kriege.“
„Und kannst du diesen Männern vertrauen?“, fragte sie schließlich.
Erec seufzte und blickte zum Horizont, Hände in die Hüften gestemmt und starrte ins Nichts, als ob er sich dasselbe fragte.
„Unser Vater hat ihnen vertraut“, sagte er schließlich. „Und sein Vater vor ihm. Sie haben sie nie im Stich gelassen.“
„Und soll das heißen, dass sie uns jetzt auch nicht im Stich lassen?“, fragte sie.
Erec betrachtete den Horizont, und plötzlich lichtete sich der Nebel und die Sonne brach durch die Wolken. Die Aussicht veränderte sich dramatisch plötzlich konnten sie mehr als nur Nebel sehen und Alistairs Herz machte einen Sprung, als sie in der Ferne Land sahen. Dort am Horizont lag eine Insel aus hohen Klippen, die sich gen Himmel erhoben. Es schien keinen Ort zum Landen zu geben, keinen Strand, keinen Hafeneingang. Bis Alistair weiter nach oben blickte und einen Bogen sah, ein Tor, das in den Berg gehauen war, an dem sich die Wellen brachen. Es war ein riesiger imposanter Eingang, bewacht von einem eisernen Fallgitter, eine Wand aus massivem Fels, mit einem Tor in der Mitte. So etwas hatte sie noch nie gesehen.
Erec starrte den Horizont an, studierte das Tor, das vom Sonnenlicht beleuchtet wurde wie der Eingang zu einer anderen Welt.
„Vertrauen, Mylady“, antwortete er schließlich, „ist eine Ausgeburt der Notwendigkeit, nicht des Willens. Und es ist eine sehr gefährliche Sache.“