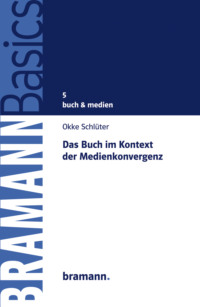Kitabı oku: «Das Buch im Kontext der Medienkonvergenz», sayfa 2
1.4
Entstehungsprozess Buch
Für ein besseres Verständnis dessen, was ein Buch ausmacht, ist auch der gesamte Entstehungsprozess hilfreich. Das allgemeine Lesepublikum weiß in der Regel nur, dass Autoren es schwierig haben, einen Verlag zu finden. Ansonsten werden Bücher für sie erst sichtbar, wenn sie im stationären Handel erhältlich sind. Dass man sie – wie sonst nur Arzneimittel – meist bis 18.00 Uhr bestellen und am nächsten Werktag zwischen 9.00 und 10.00 Uhr abholen kann, wird als selbstverständlich betrachtet.
Damit ein Buch letztendlich den Erwartungen gerecht werden kann, durchläuft es zahlreiche Prozessschritte. Diese werden z.T. von Mitarbeitern des Verlags erledigt, es sind aber auch viele Externe als Dienstleister beteiligt.
Idee, Urheber und Entscheidung Grundsätzlich kann ein Buch aus Verlagssicht von außen initiiert werden oder von innen. Tritt jemand von außen an den Verlag heran, sind dies entweder
• der oder die Autor(en) als Urheber,
• ein Agent als sein Vertreter oder
• ein Rechteinhaber (meist ein anderer Verlag oder Agent), der eine Lizenz eines existierenden Buches anbietet.
Die Idee kann aber ebenso im Verlag selbst aufkommen, meist durch den Austausch mit Händlern, Lesern oder anderen Kooperationspartnern. Eine Buchidee kann ebenso aus der Auswertung von Daten (#Data Analytics) hervorgehen, wenn etwa die Kommunikation in Sozialen Medien, die Produktsuche im Webshop oder andere Marktdaten analysiert werden. Manchmal wird sogar eine Marktforschung in Auftrag gegeben.
DATA ANALYTICS Unter dem Begriff Data Analytics werden Analysen subsumiert, mit denen in meist großen Datenmengen (#Big Data) Korrelationen und Muster sichtbar gemacht werden. Während für die Wissenschaft diese Zusammenhänge an sich von Interesse sind, möchten Unternehmen damit ihre Geschäftstätigkeit optimieren oder weiterentwickeln.
Zur internen Prüfung wird in der Regel ein Exposé o. Ä. zur Produktidee und eine grobe Kalkulation erstellt. Im Rahmen regelmäßig stattfindender Besprechungen im Verlag werden die Titelideen von Vertretern der verschiedenen Abteilungen und der Geschäftsleitung diskutiert und entschieden. Wird eine positive Entscheidung getroffen, müssen noch vertragliche Regelungen getroffen werden. Dies betrifft vor allem die Urheber, also Autoren, Illustratoren, Fotografen o. Ä. oder bei einer eingekauften Lizenz die jeweiligen Rechteinhaber. Zudem wird Titelschutz in Anspruch genommen, d.h. ein Titel angemeldet, der dann eine Zeit lang für den jeweiligen Verlag reserviert ist. In der Regel wird mit der Entscheidung für einen Titel auch ein Erscheinungstermin anvisiert.
In dieser ersten Phase sind fast alle Abteilungen involviert, weil deren jeweilige Expertise erforderlich ist: Marketing und Vertrieb können die Marktchancen gut einschätzen, das Lektorat kann die Inhalte gut beurteilen und kennt die Wettbewerbsangebote. Die Herstellung wird bei der Vorkalkulation konsultiert, weil sie die benötigten Lieferanten und deren Preise kennt. Die Vertragsabteilung weiß, welche Aspekte geregelt und dokumentiert werden müssen. Die Programm- und Geschäftsleitung sind involviert, weil sie letztendlich die Entscheidung treffen und auch die Verantwortung tragen.
Entwicklung der Inhalte (Teamspiel in verteilten Rollen) Die Zusammenarbeit in der Phase, in der die Inhalte über Monate oder Jahre hinweg entstehen, kann sehr unterschiedlich organisiert sein. Das Lektorat ist daran interessiert, meist nach einem Probekapitel, in regelmäßigen Abständen Teile des Manuskripts zu erhalten. Diese Teile können dann schon auf Verlagsseite redigiert werden, während der oder die Autoren weiterschreiben. In einigen Verlagen wird dies Redaktionsarbeit genannt, wenn Mitarbeiter selbst an den Inhalten mitschreiben. Die Urheber (s.o.) sind fast immer freiberuflich oder nebenberuflich tätig. Lektoren sind dagegen häufig im Verlag angestellt, sofern nicht ein sog. Außenlektorat in Auftrag gegeben wird. Die BRAMANNBasics bieten mit Band 7 einen speziellen Titel für das Thema ›Content-Management‹: Michael Schickerling: Lektorat, Programmplanung und Projektmanagement.
Herstellung vs. Produktion Nach Abschluss des Lektorates, teilweise auch zeitversetzt parallel dazu, erhält die Herstellungsabteilung das Manuskript. Hier sind zunächst zwei Begriffe zu klären: Das Manuskript ist entgegen der Wortbedeutung nicht handgeschrieben, sondern in aller Regel mit einem Textverarbeitungsprogramm erstellt. Die Herstellung bereitet die Inhalte für die Produktion vor, in dem sie sich um den Satz kümmert. Dies meint wiederum, dass Text und grafisches Material für den Satzspiegel (das Layout) des festgelegten Formats eingerichtet werden. Dieser Vorgang, in der Fachsprache als der Satz bezeichnet, kann innerhalb des Verlages oder durch einen spezialisierten Dienstleister vorgenommen werden. Ebenso kann der zuständige Hersteller im Verlag angestellt oder freiberuflich tätig sein. Letztere werden dann aus der Sicht des Verlages als Außenhersteller bezeichnet. Die Produktion – der Druck, die Aufnahme als Hörbuch oder die Erstellung eines E-Books – wird dann in aller Regel außerhalb des Verlages von Dienstleistern durchgeführt.
Marktkommunikation (Marketing, Werbung & PR) Der Begriff Marktkommunikation umfasst die gesamte Kommunikation mit dem Markt bzw. seinen Akteuren. Dahinter vermuten die meisten vor allem die Werbemaßnahmen, die selbstverständlich auch dazu gehören. Dazu kommen aber eine Reihe weiterer Maßnahmen wie die Informationen für Buchhändler, Pressemitteilungen und eine Vielzahl kleinerer Maßnahmen, wie Gewinnspiele oder die Pflege von Social-Media-Kanälen. In der Summe bereiten sie den Markt auf die Erscheinung und den Verkauf des betreffenden Titels vor. Organisatorisch sind diese Tätigkeiten meist in einer Marketing- und einer PR-Abteilung angesiedelt. Diese arbeiten wiederum mit einer Vielzahl von Dienstleistern und Kooperationspartnern zusammen, seien dies Werbeagenturen, Blogger, Presse- oder Rundfunkmedien. Die benötigte Grafik, z.B. für Werbemittel, kann entweder im Verlag erstellt oder ebenfalls extern vergeben werden.
Vertrieb und Distribution (kaufmännisch & logistisch) Die Vertriebsaktivitäten lassen sich in eine kaufmännische und eine logistische Ebene unterteilen. Während der kaufmännische Vertrieb den Verkauf des Buches betrifft, sorgt die Logistik dafür, dass das Buch möglichst schnell und auf dem bevorzugten Weg zum Kunden gelangt. Während Verlage den kaufmännischen Vertrieb selbst steuern, werden Dienstleister mit der Logistik beauftragt.
Beim kaufmännischen Vertrieb unterscheidet man einen Innendienst, der im Verlag arbeitet, vom Außendienst, der vor allem Händler besucht und die neuen Produkte (Novitäten) präsentiert. Diese Personen können entweder im Verlag angestellt sein, dann werden sie als Außendienst bzw. Außendienstmitarbeiter bezeichnet. Es können aber auch selbstständige Handelsvertreter beauftragt werden, die dann meist im Auftrag mehrerer Verlage die Buchhandlungen besuchen und auf Provisionsbasis bezahlt werden. Die Novitäten werden ihnen zweimal im Jahr von Verlagsmitarbeitern während sog. Vertreterkonferenzen vorgestellt. Während Außendienst oder Handelsvertreter aktiv auf die Handelskunden des Verlages zugehen, bearbeitet der Innendienst vor allem eingehende Anfragen und Bestellungen von Buchhandlungen.
Die Logistik ist vor allem bei gedruckten Büchern aufwändig und wird fast immer auf Provisionsbasis von spezialisierten Dienstleistern übernommen. Während ein E-Book oder eine App nur in einem Shop zum Download bereitgestellt werden muss, werden Bücher meist in der Menge (Auflage) vorproduziert, die man in den ersten 12 bis 18 Monaten zu verkaufen beabsichtigt. Von der Druckerei werden nur einige Exemplare zur Archivierung und als Belegexemplare für Beteiligte an den Verlag geliefert, der überwiegende Teil wird zu einer sog. Verlagsauslieferung transportiert, wo die Bücher im Auftrag des Verlages in Hochregallagern aufbewahrt werden. Von dort werden sie an Großhändler, die sog. Barsortimente, oder direkt an Buchhandlungen geliefert. Die Rechnungsstellung (Faktur) übernimmt dabei ebenfalls die Verlagsauslieferung, die mit einem bestimmten Prozentsatz dieses fakturierten Umsatzes honoriert wird. Außerdem fällt eine gewichtsabhängige monatliche Mietgebühr an.
Nachkaufphase: Nutzung und Kommunikation über das Buch (c2b & c2c) Nachdem die Kunden das betreffende Buch bei einem Händler oder direkt beim Verlag erworben haben, beginnt eine weitere wichtige Phase. Das Buch wird ganz oder teilweise gelesen, manchmal auch gar nicht. Diesen Prozess kann der Verlag nur nachvollziehen, wenn das Buch als E-Book online bzw. als Streamingangebot gelesen wird. Ansonsten erfährt der Verlag erst etwas dazu, wenn die Leser sich öffentlich über das Buch austauschen. Dies geschieht in Communities, auf Blogs oder in Sozialen Medien. Manche Leser melden sich auch direkt beim Verlag. In jedem Fall enthält diese Kommunikation wichtige Rückmeldungen für den Verlag, gleichgültig, ob diese positiv oder negativ sind. Sie stellen Meinungen im Markt dar und ermöglichen daher eine Form der Marktforschung.
Damit schließt sich dann der Kreis des sog. Produktmanagements in Buchverlagen: Die Rückmeldungen zu den erschienenen Büchern fließen in die Entscheidungen über künftige Buchprojekte des Verlages ein, wodurch ein Kreislauf entsteht.
Der Entstehungsprozess eines Buches wurde hier am Beispiel eines einzelnen neuen Buches in den Grundzügen beschrieben. In der Realität entstehen in einem Verlag freilich viele neue Bücher parallel. Damit dies ohne unnötige Zeitverluste bzw. Kosten und in der notwendigen Qualität geschehen kann, haben Verlage entsprechende Prozesse definiert. Diese ermöglichen eine möglichst optimale Erledigung der genannten Schritte. Die Prozesse können jedoch im Detail von Verlag zu Verlag sehr unterschiedlich sein, was durch Eigenarten der Produkte oder einfach durch Gewohnheiten im Verlag bedingt ist. Definierte Prozesse sind wichtig für die Wirtschaftlichkeit eines Verlages und werden deshalb nach Möglichkeit immer weiter optimiert. Ein Prozess ist aber nur innerhalb bestimmter Rahmenbedingungen und dadurch nur eine bestimmte Zeit lang ›optimal‹. Man muss Prozesse daher von Zeit zu Zeit überprüfen und hinterfragen. Für neuartige Produkte müssen gegebenenfalls neuartige Prozesse definiert werden. Prozesse spielen insbesondere im Zuge der digitalen Transformation und der #Medienkonvergenz eine wichtige Rolle, weswegen von ihnen im vorliegenden Band immer wieder die Rede sein wird.
PROZESSS »Ein Prozess ist die Abfolge von zusammenhängenden Arbeitsschritten, die mit einem bestimmten Input eine bestimmte Leistung erbringen.« (Posluschny 2012)
Prozesse sind in Unternehmen von großer Bedeutung, wenn sich bestimmte Abläufe oft wiederholen und ggf. von verschiedenen Mitarbeitern immer mit der gleichen Qualität erledigt werden sollen.
1.5
Bedeutung des Buches in der Gesellschaft
Bei den Funktionen eines Buches ist bereits deutlich geworden, dass dem Buch in der Gesellschaft eine besondere Funktion zukommt. Dies gilt insbesondere für Deutschland, in ähnlicher oder abgewandelter Form aber auch für viele andere Wissensgesellschaften mit schriftbasierter Tradition. Die Einordnung als Wirtschafts- und Kulturgut (siehe Kap. 1.3) beschreibt genauer, warum Bücher nicht nur marktgängige Produkte und Handelsware darstellen, sondern einen kulturellen Auftrag haben. Dies erklärt auch, warum die UNESCO sich dem Buch mit einer eigenen Definition zuwendet.
Der Gesetzgeber bringt seine Wertschätzung des Buches durch den ermäßigten Mehrwertsteuersatz von 7 % gegenüber 19 % für reine Konsumgüter zum Ausdruck. Dieses Privileg genießt nur eine explizit festgelegte Gruppe an Gütern, die ansonsten überwiegend aus Lebensmitteln besteht. Ebenso spiegelt das in Deutschland geltende Buchpreisbindungsgesetz (BuchPrG) eine besondere Wertschätzung gegenüber dem Buchhandel wieder. Durch einen einheitlichen Verkaufspreis zu Endabnehmerpreisen wird vor allem die Vielfalt an Buchhandlungen geschützt, da sich die großen Buchhandlungen so keine Vorteile durch eine Preis-Mengen-Strategie verschaffen können. Eine solche Strategie würde darauf abzielen, mit niedrigen Preisen bei ausreichender Produktqualität möglichst hohe Marktanteile zu erobern. Besonders Einzelhandelsketten wenden diese Strategie häufig an, z. B. im Bereich der Unterhaltungselektronik. Neben dem ermäßigten Mehrwertsteuersatz und der Preisbindung ist hier grundsätzlich auch das Urheberrecht zu nennen, das schöpferische Leistungen, also die Inhalte von Büchern und ihre Verwertung regelt bzw. schützt. Als Gesetz bringt es die Wertschätzung der Gesellschaft gegenüber der Leistung von Autoren und Illustratoren zum Ausdruck und stellt sicher, dass diese für ihre Leistungen angemessen vergütet werden.
Alle drei genannten Gesetze bringen die Auffassung der Gesellschaft zum Ausdruck, dass Bücher als Kulturgüter einen besonderen Wert darstellen und deswegen Schutz genießen.
Diese Auffassung ist jedoch nicht unumstritten. Etwa seit der Jahrtausendwende werden, befeuert von der Digitalisierung, Copyright und Urheberrecht kontrovers diskutiert. Meilensteine dabei waren die Gründung der Tauschbörse The Pirate Bay im Jahr 2003 und deren Verbot bzw. die gerichtliche Verurteilung ihrer Gründer im Jahr 2009. In der Folge wurden ab 2006 in einigen Ländern, darunter auch in Deutschland, politische Parteien gegründet, die die Abschaffung des Urheberrechts zu einem zentralen Anliegen machten (Piratenpartei). Auch wenn diese Parteien nirgendwo einen maßgeblichen politischen Einfluss erreichen konnten, so ist die Bewegung symptomatisch für Zweifel an der Legitimität von Urheberrechten. Damit werden indirekt auch die für den Buchmarkt geltenden Regelungen in Frage gestellt. Die Gesellschaft ist hier aufgerufen, vor dem Hintergrund der Digitalisierung ihre Haltung zu geistigem Eigentum und dessen Schutz zu überdenken und zu einer mehrheitsfähigen Auffassung zu gelangen.

Logo der Plattform The Pirate Bay. (https://thepiratebay.org/)
Parallel zu diesen Debatten weisen aktuelle Erhebungen darauf hin, dass sich der Buchmarkt verändert. So ist der Anteil der Personen in Deutschland, die pro Woche mindestens einmal ein Buch lesen, von 49 % im Jahr 2012 auf 42 % im Jahr 2017 zurückgegangen. Der Börsenverein des deutschen Buchhandels hat gemeinsam mit der GfK ermittelt, dass die Zahl der Buchkäufer von 2012 bis 2016 um 6,1 Millionen gesunken ist. Dieser Rückgang ist konkret auf das Kaufverhalten der 20- bis 49-Jährigen zurückzuführen.
Es ist noch nicht abschließend geklärt, wodurch diese Veränderungen genau verursacht werden. Sicher konkurrieren digitale Angebote um das tägliche Zeitbudget der Mediennutzer, wobei dieses Zeitbudget an sich seine Wachstumsgrenze erreicht hat. Um es prägnant zu formulieren: Wer auf Netflix eine Serie schaut, kann in dieser Zeit kein Buch lesen. Andererseits kann man das Leseverhalten einer Gesellschaft nicht nur an Buchkäufen festmachen. Seit Plattformen wie Wattpad sich – wiederum unter jüngeren Lesern – großer Beliebtheit erfreuen, findet Lesen auch unentgeltlich und mit Instrumenten klassischer Marktforschung nicht messbar statt.
Für die Frage der Bedeutung von Büchern kann festgehalten werden: Traditionell genießen Bücher einen besonderen Schutz und Sonderrechte gegenüber anderen Wirtschaftsgütern. Dieser Status ist aktuell starken Veränderungen und gesellschaftlichen Debatten ausgesetzt, für die Zukunft muss er neu definiert werden.
Es ist deutlich geworden, wie sich die Medienlandschaft insgesamt verändert. Die Digitalisierung ist in vielerlei Hinsicht Auslöser und Einflussfaktor für Veränderungsprozesse. Da der vorliegende Band das Buch im Medienkontext zum Thema hat, kommt er nicht umhin, das Buch in einem weiter gefassten Zusammenhang zu betrachten und seinen Wechselwirkungen nachzugehen. Gegenüber dem gedruckten Buch eröffnet das ›Prinzip Buch‹ speziell im Kontext der Medienkonvergenz eine Reihe zusätzlicher Wechselwirkungen. Um dies sichtbar zu machen, soll im folgenden Kapitel zunächst genauer definiert werden, was sich hinter dem Begriff Medienkonvergenz verbirgt.
Verwendete und weiterführende Literatur sowie Linkhinweise
Börsenverein des Deutschen Buchhandels (Hg.): Buch und Buchhandel in Zahlen 2019. Frankfurt a.M.: MVB 2019.
Breyer-Mayländer, Thomas (Hg.): Vom Zeitungsverlag zum Medienhaus: Geschäftsmodelle in Zeiten der Medienkonvergenz. Wiesbaden: Springer Gabler 2015.
Casimir, Torsten: Wann ist ein Buch ein Buch?. Börsenblatt, 2011. URL: https://www.boersenblatt.net/artikel-prinzip_buch.454079.html. [Zugriff: 03.05.2019]
Goodwin, Kim: Perfecting Your Personas. 2008. URL: https://www.cooper.com/journal/2001/08/perfecting_your_personas [Zugriff: 03.05.2019]
Häusel, Hans-Georg/Henzler, Harald: Buyer Personas – Wie man seine Zielgruppen erkennt und begeistert. Freiburg: Haufe Gruppe 2018.
Mayer, Franziska: Zur Konstitution von ›Bedeutung‹ bei der Buchgestaltung. Aspekte einer Semiotik des Buchs. In: Text – Material – Medium. Zur Relevanz editorischer Dokumentationen für die literatur-wissenschaftliche Interpretation. Hrsg. von Wolfgang Lukas, Rüdiger Nutt-Kofoth und Madleen Podewski. Berlin, Boston: de Gruyter (Beihefte zu editio; 37), S. 197–215.
Posluschny, Peter: Prozessmanagement: Kundenorientierung, Modellierung, Optimierung. (UTB Betriebswirtschaftslehre 8501). Konstanz: UVK 2012.
UNESCO: Verfassung der Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO). URL: https://www.unesco.de/mediathek/dokumente/verfassung-der-organisation-fuer-bildung-wissenschaft-und-kultur [Zugriff: 03.05.2019]
Vogel, Anke: Der Buchmarkt als Kommunikationsraum: eine kritische Analyse aus medienwissenschaftlicher Perspektive. Wiesbaden: VS Verlag 2011.
Aufgaben zu Kapitel 1
1. Warum spricht man vom ›Prinzip Buch‹?
2. Warum braucht man sieben Personas, um typische Nutzungssituationen von Büchern zu beschreiben?
3. Kann man Bücher als sekundäre Medien bezeichnen?
4. Welche Auswirkung hätte eine Abschaffung des Urheberrechts auf den deutschen Buchmarkt?
2
Konvergenzerscheinungen im Medienkontext des Buches
Unter Konvergenz wird wegen des lateinischen Ursprungs des Begriffs (lat. convergere = sich annähern, zusammenlaufen) stets ein Prozess des Zusammenwachsens oder der Verzahnung verstanden. Im Mediensektor kommt der Konvergenz im Zuge der Digitalisierung eine weitreichende Bedeutung zu, da sie eine Reihe zusätzlicher Wechselwirkungen möglich gemacht hat. Um die Medienkonvergenz in der Buchbranche genauer zu beschreiben, ist im ersten Schritt eine Mediendefinition wichtig, um anschließend die Konvergenz von der Digitalisierung abzugrenzen und sie letztlich selbst zu definieren.
2.1
Arbeitsdefinition des Medienbegriffs
Da das Buch unzweifelhaft den Medien zuzurechnen ist und weil im vorliegenden Band seine Bezüge zum Medienkontext und der Medienbranche dargestellt werden sollen, ist eine Definition des Begriffs Medium eine wichtige Grundlage. Selbstverständlich existieren bereits eine Reihe von Definitionen aus ganz verschiedenen Disziplinen. Man steht dabei allerdings vor ähnlichen Herausforderungen wie bei der Definition dessen, was ein Buch ausmacht. Die Vielfalt der Ausprägungen in der Realität hat dazu geführt, dass die Definitionen derart gedehnt wurden, dass sie zwar alles einschließen, sich aber für konkrete Anwendungen nicht eignen. Die Feststellung ›Nichts ist kein Medium‹ bringt das gut zum Ausdruck – doch so zutreffend der Satz auch ist, so wenig hilft er für die Auseinandersetzung mit konkreten Fragestellungen. Allen Definitionen liegt letztlich die Bedeutung des lateinischen ›medius‹ zugrunde: ›in der Mitte befindlich‹, ›dazwischen liegend‹, da Medien immer zwischen zwei Kommunikationsinstanzen stehen.
In diesem Band wird deshalb auf eine vergleichsweise einfache Definition zurückgegriffen, mit der sich aber der Medienkontext des Buches gut beschreiben lässt. Vorab aber soll kurz beschrieben werden, welche Anforderung eine solche Definition erfüllen muss: Bücher und weitere buchähnliche Angebote sollen verallgemeinert bzw. modellhaft beschrieben werden können. Nur so kann man verschiedene Angebotstypen sichtbar machen und entsprechende Gruppen bilden.
Am besten geeignet ist ein funktionaler Medienbegriff; Hickethier (2010: 20f.) unterscheidet folgende Medienfunktionen:
1 Medien der Beobachtung
2 Medien der Speicherung und Bearbeitung
3 Medien der Übertragung
4 Medien der Kommunikation
Während die erste Kategorie Wahrnehmungshilfen, wie Brille und Fernrohr, Megafon und Hörrohr, meint und hier vernachlässigt werden kann, leuchtet die zweite Medienfunktion für den vorliegenden Band unmittelbar ein. Zu den wichtigsten Aufgaben von Büchern gehört es, Informationen zu speichern und diese, falls nötig, zu bearbeiten. Die Übertragungsfunktion ist dagegen besonders bei Online-Medien relevant, da das Internet neben der Speicherfunktion eine solche Verbindungs- und Übertragungsfunktion leistet. In der vierten Kategorie nach Hickethier handelt es sich um eine Funktion, die die drei vorangegangenen kombiniert.
Für die Beschreibung von Büchern und buchähnlichen Angeboten ist nun charakteristisch, dass sie eine äußere technische Form haben, anhand derer man sie leicht klassifizieren kann. Ihre Inhalte sind:
• auf Papier (oder einen anderen Bedruckstoff) gedruckt oder geschrieben,
• als Audioaufnahme verfügbar,
• digital als Datei erhältlich (Datenträger, Download oder Streaming).
Da die jeweilige technische Umsetzungsform von Buchinhalten primär die Aufgabe hat, Informationen zur Verfügung zu stellen, werden die genannten Formen im vorliegenden Band mit dem Medium gleichgesetzt. Damit könnte man alle Produkte in eine dieser vier Kategorien einordnen. Für den Blickwinkel der Medienkonvergenz wäre das allerdings unzureichend, da unter Konvergenzaspekten sehr unterschiedliche Produkte in ein und derselben Kategorie landen würden. Enthält eine Sprachlernsoftware Ausspracheübungen, so stellt dies ebenso eine Audioaufnahme dar, wie ein Hörbuch zu einem Roman. Die Ausspracheübungen sind aber nur ein Bestandteil der Sprachlernsoftware, während das Hörbuch ein eigenes Produkt darstellt.
Es hat sich deswegen als zweckmäßig erwiesen, auf einer weiteren Ebene zu kennzeichnen, in welcher Form die Inhalte in den Medien enthalten sind. Dies sind im Wesentlichen Text, Bild (Foto oder Illustration), Audio, Video, animierte Grafik oder virtuelle Inhalte (VR). Diese zusätzliche Ebene wird im Folgenden als Medienformat bezeichnet. Ein E-Book, das Text, Audiodateien und Video enthält, ist demzufolge als Medium eine digitale Datei, die die genannten Medienformate enthält.
Der Begriff Medium wird in verschiedenen Zusammenhängen sehr unterschiedlich interpretiert, was hier explizit erwähnt sein will. Manche Wissenschaftler verwenden deshalb für das Medium im hier erläuterten Sinn den Begriff Trägermedium. Diese Bezeichnung ist sehr anschaulich, weshalb sie hier zum besseren Verständnis erwähnt wird – sie passt im Kontext der Medienkonvergenz aber nicht immer.
Da die Mediendefinition hier zum Ziel hat, verfügbare und vorstellbare Angebote der Buchbranche beschreiben zu können, ist eine weitere Ergänzung notwendig. Zunehmend beinhalten Verlagsprodukte auch Dienstleistungen, etwa Beratungs- oder Schulungsangebote. Deshalb ist es erforderlich, Dienstleistungen hier ebenfalls als Medium zu betrachten (was medienwissenschaftlich durchaus unüblich ist). Sie übertragen ebenso Informationen, auch wenn diese darin nicht gespeichert werden können. Im Gegensatz zu einem gedruckten Buch handelt es sich allerdings um ein Primärmedium (auch als ›Menschmedium‹ bezeichnet), ähnlich einem Boten im Mittelalter oder einer Schauspielerin.
Auf die Definitionen von Medium und Medienformat wird im Folgenden verschiedentlich zurückgegriffen werden. Im nächsten Schritt soll nun, wie angekündigt, zunächst die Medienkonvergenz von der Digitalisierung abgegrenzt werden, um danach eine Definition für die Medienkonvergenz selbst herauszuarbeiten.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.