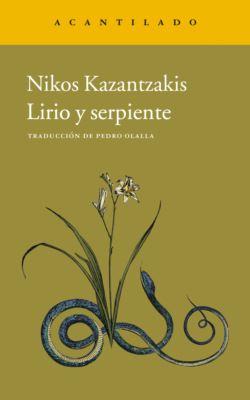Kitabı oku: «Die ausgegrabene Demokratie»


PEDRO OLALLA
Die ausgegrabene
Demokratie
Ein politischer Spaziergang
durch Athen
Aus dem Spanischen von
Matthias Strobel

»… ῾Eλλάς ἅπασα μετέωρος ἦν«
»… das ganze übrige Hellas war in Spannung.«
Thukydides
Der Peloponnesische Krieg, 2.81
ANMERKUNG DES AUTORS
Dieses Buch entstand zwischen 2010 und 2014, als Griechenland zusammenbrach. Alle hier versammelten Ideen sind geprägt von den damaligen Ereignissen, von der Auseinandersetzung mit dem antiken und dem heutigen Athen, von der täglichen Erfahrung von Missbrauch, Lüge, Passivität, Ohnmacht und Ungerechtigkeit. Was den historischen, archäologischen und philologischen Inhalt betrifft, so haben keine Fakten ihren Weg in dieses Werk gefunden, die nicht mit Quellen belegt sind oder auf vertrauenswürdiger Forschung beruhen. Allein die persönlichen Meinungen schweben schwerelos – auch sie in Spannung – über dem Gewissen des Autors.
NYMPHENHÜGEL
VOM FELSIGEN GIPFEL AUS
DURCH MELITE, ZUR PNYX
VON DER PNYX HINUNTER
AUF DEM FELSEN DES AREOPAGS
HINUNTER NACH THISEIO
DIE KLASSISCHE AGORA
AN DER KÖNIGSSTOA
AN DER STOA DES ZEUS ELEUTHERIOS
BEI DEN SCHUTZGÖTTINNEN DER IONIER
VOR DEM DENKMAL DER EPONYMEN HEROEN
AN DEN ÜBERRESTEN DES »BOULEUTERION« UND DES »METROON«
DIE »THOLOS«
ÜBER DIE GESCHWORENENGERICHTE
UNTER BÄUMEN
SÜDLICH DER AGORA
AN DER GRENZE DER AGORA
IM ALTEN STADTVIERTEL DER MARMORSCHLEIFER
ZUR AGORA HINAUS
IM KERAMAIKOSVIERTEL
ZUR AKADEMIE
ZURÜCK ZUM STADTVIERTEL KERAMEIKOS
IM AKROPOLISMUSEUM
ZUR RÖMISCHEN AGORA
AUF DEN STRASSEN VON MONASTIRAKI
AN DER HADRIANSBIBLIOTHEK
KREUZUNG ERMOU- UND AIOLOU-STRASSE
AUF DEN STRASSEN HINAUF ZUM PARLAMENT
AUF DEM SYNTAGMAPLATZ
BIBLIOGRAFIE
NYMPHENHÜGEL
Da oben, hinter dem tiefsten Blau, liegt der geheimnisvolle feinstoffliche Äther. Darunter die durchsichtige, quirlige Luft. Und dann, je weiter man den Blick senkt, verschwimmt das Blau zu einer goldenen Klarheit, die sich auf die zarte Linie der Gipfel legt. Es ist das tò attikón fos, das legendäre Licht Attikas, das die Farbe der Haut entflammt, das Weiß der Berge und das Grün der Pinien und Zypressen. Noch weiter unten, in der Ferne, taucht die Küste des Peloponnes auf, der Umriss der Insel Ägina – mit der blauen Pyramide des Oros –, Angistri und die Meerenge von Metope, der Golf von Saronikos, der Hügel des antiken Munychia, Salamis, die Berge Parnitha und Egaleo; und weiter rechts der Pendeli, der Lykabettus, die Akropolis, der Hymettos, der Musenhügel. Unterhalb dieses natürlichen Horizonts erstreckt sich die Stadt: eine riesige Stadt, die wie eine Flutwelle von der Küste herauf bis zu den Bergen schwappt und sich an den Klippen des Nymphenhügels bricht; eine wahrlich weiße Stadt, in deren Rissen sich die Errungenschaften der Vergangenheit und die Ängste der Gegenwart offenbaren; eine merkwürdige Stadt, die vor Jahrtausenden Ideale aufzeigte, die auch heute noch revolutionär sind.
Zweifellos ist da unten, in der Stadt, Griechenland; und auch in dem Meer dahinter, das Inspiration war für die ersten geschriebenen Worte über das Meer; und auch in dem dürren Boden, auf dem ich stehe, der noch immer Scherben seiner zerbrochenen Erinnerung freigibt. Doch vor allem ist Griechenland als Vermächtnis, Auftrag und Wille in dieser geschichteten, schwerelosen Luft wie eine Heimat des Geistes.
»῾Eλλάς ἅπασα μετέωρος ἦν« (Hellàs hápasa metéōros ên),2 schrieb Thukydides: »… ganz Griechenland war in Spannung.« Metéoros meint das, was in der Luft liegt, hängt, schwebt; auch das, was ungewiss ist, seiner Erfüllung harrt. In Spannung also war dem Geschichtsschreiber nach ganz Griechenland, als Sparta auf Athen vorrückte, über diese bläulichen Hügel, die man da hinten sieht, mit kühnen, arglosen, zum Krieg entschlossenen jungen Männern in beiden Lagern. Auch heute noch ist Griechenland, das gleichermaßen Land ist wie ethische Herausforderung, in Spannung, in der Schwebe. Geplagt von Ungewissheit, der Erfüllung harrend. Und wie seit jeher: bedroht.
Zunächst gilt es, sich darüber bewusst zu werden, dass die Haltungen und Errungenschaften, die wir heute als ein wertvolles Erbe der Griechen betrachten, in Wahrheit Gesten des Widerstands waren: der Rebellion einzelner Menschen – Griechen dem Blut oder der Gesinnung nach – gegen die Gesellschaft, in der sie lebten. Selbst in den Zeiten, die wir heute als besonders glanzvoll erachten, lagen Wunsch und Wirklichkeit weit auseinander. Beide waren Griechenland, nur dass wir, die wir an sein Vermächtnis denken, sie miteinander vermengen. Richtig ist jedoch, dass damals wie heute diejenigen die Menschheit vorangebracht haben, die gegen Ungerechtigkeit und Ignoranz ankämpften und dabei von denjenigen in die Knie gezwungen wurden, die sich aus Bequemlichkeit oder Ignoranz damit abfanden.
VOM FELSIGEN GIPFEL AUS
Vor hier oben betrachtet wirkt die Stadt fast wie ein Element der Landschaft: ein natürliches Element, wie das Meer oder die Berge, taub für die Leidenschaften der Menschen. Aber was brodelt dann da? Was geht vor sich in diesem menschlichen Gewimmel, das von hier aus so fern und flüchtig erscheint, als würden Götter von einem Fries herab gleichgültig darauf schauen?
Es ist nur schwer auf den Punkt zu bringen. Seit Anfang 2010, um einen nicht allzu fernen Ausgangspunkt zu wählen, ist Griechenland das Opfer einer ungestraften Erpressung und Plünderung im Namen einer umstrittenen »Schuld«. Alle, die wir hier leben, sind zu Schuldnern geworden: Begünstigte sind hiesige und ausländische Eliten. Nichts davon ist neu; es ist schon häufig vorgekommen, in Lateinamerika, in Schwarzafrika, im Maghreb, in Südostasien, in allen Ländern der sogenannten Dritten Welt. Auch in Griechenland ist es nicht neu. Seit sich das Land vom Osmanischen Reich hat lösen können, war es bei den europäischen Großmächten verschuldet und musste schon viermal den Staatsbankrott erklären, den aktuellen, noch übertünchten Bankrott nicht mitgerechnet. Aber das ist eine andere Geschichte. Neu ist allerdings, dass sich heute all dies zum ersten Mal im Rahmen der Europäischen Union abspielt, in einem gemeinsamen Währungsraum, der sich der staatlichen Kontrolle entzieht, also auch der des Volkes.
Aus historischer Perspektive könnte man sagen, dass diejenigen, die in der Welt die finanzielle Macht besitzen, nun auch noch die politische Macht an sich reißen, indem sie Schulden schaffen und auf deren Rückzahlung bestehen; dass sie es ungestraft tun, unter tätiger Mithilfe vieler Regierender und begünstigt durch die Passivität der Regierten und den Mangel an organisiertem Widerstand; dass sich dank technokratischer Marionettenregierungen die De-facto-Macht zu einer De-iure-Macht wandelt; dass umstrittene Wirtschaftstheorien interessegeleitet zu politischen Dogmen erhoben wurden; dass die Maßnahmen derjenigen, die diese »Krise« managen, nicht darauf abzielen, sie zu bewältigen, sondern den größtmöglichen Nutzen für sich selbst daraus zu ziehen; dass der Reichtum sich in immer weniger Händen konzentriert; und dass alle Opfer, die dem griechischen Volk abverlangt werden, nicht dazu dienen, ein perverses System zu bekämpfen, sondern es aufrechtzuerhalten.
Das Ergebnis kann man nur als Plünderung bezeichnen: Eine privatrechtlich organisierte, von Technokraten der Finanz- und Wirtschaftswelt geleitete anonyme Gesellschaft3 setzt unerbittlich das größte Privatisierungsprogramm der Welt um;4 der öffentliche Dienst – bereits sehenden Auges durch politische Vetternwirtschaft und eine verantwortungslose Verwaltung erst aufgebläht und dann zerstört – wird nun von privaten Unternehmen betrieben, die das große Geschäft wittern; die Demokratie hat Tausende Demonstrationen erlebt, die mit Tränengas und großem Polizeiaufgebot erstickt wurden, einen von den Gläubigern aufoktroyierten Ministerpräsidenten,5 Wahlen, bei denen ein ängstliches Festklammern an den bestehenden Verhältnissen triumphiert hat; repräsentiert wird diese Demokratie von Abgeordneten, die sich nicht unter die Menschen trauen, sie muss Tag für Tag ein Parlament ertragen, in dem die »internationalen Verpflichtungen« die Richtschnur darstellen, wider alle Rechte und Bedürfnisse der Bürger und in klarem Bruch mit den Prinzipien der Verfassung; Hunderttausende gut und kostspielig ausgebildete junge Menschen, die am Beginn ihres Berufslebens stehen, gehen auf der Suche nach Jobs ins Ausland, während es auf dem inländischen Arbeitsmarkt – aufgrund von Lohnkürzungen und gewollter Zunahme von Arbeitslosigkeit und prekären Verhältnissen – nur so wimmelt von Menschen, die zu allem bereit sind, auch zu unbezahlter Arbeit, in der falschen Hoffnung, ihren Arbeitsplatz noch eine Weile behalten zu können. Der Verlust sozialer Errungenschaften spiegelt sich wider in normal gewordenen Bildern von Entlassenen ohne Anrecht auf Arbeitslosengeld, von Rentnern, die im Müll wühlen, von Krankenhäusern ohne Mullbinden, Apotheken ohne Medikamente, Familien ohne Strom und ohne Heizöl, langen Schlangen vor Suppenküchen, Menschen, die sich im Tausch für Lebensmittel als Proselyten rechtsradikaler Gruppierungen missbrauchen lassen, Polizeigewalt und hasserfüllten Angriffen auf Immigranten. Es ist wirklich nur schwer auf den Punkt zu bringen. Doch genügt letztlich neben all dem Erwähnten eine Zahl, um sich der ganzen Tragödie bewusst zu werden: In den vergangenen vier Jahren haben sich über dreitausendfünfhundert Menschen das Leben genommen. Und die Dunkelziffer dürfte noch höher liegen, denn viele Familien verheimlichen die Verzweiflungstaten, aus Glaubensgründen, aus Schmerz, aus Scham. Seit dem Beginn der »Krise« hat jeden Tag ein Mensch Selbstmord begangen. Und es waren nicht nur der Apotheker Dimitris Christoulas, der sich vor dem Parlament an eine Zypresse stellte und eine Kugel in den Kopf schoss, oder der Lehrer Savvas Metikidis, der in einem Abschiedsbrief Anklage erhob gegen den politischen Missbrauch und sich dann erhängte: Es waren Hunderte und Aberhunderte, Menschen mit Vor- und Nachnamen, Menschen, die Sinn und Hoffnung verloren hatten. Allein dies sollte genügen, um sich ein Bild davon zu machen, was dort unten geschieht, um das abscheuliche, verurteilungswürdige Fiasko zu verdeutlichen.
»Ich erkenne, und – tief im Herzen verspüre ich Trauer – sehen muss ich, wie jetzt Ioniens ältestes Land niedersinkt.«6 Mit diesen Klageworten stimmt Solon im sechsten Jahrhundert vor Christus seine Elegie auf das geschundene Athen an. Dort oben, auf dem heiligen Felsen, waren die steinernen Tempel noch nicht errichtet mit ihren Verzierungen, auf denen Löwen Stiere verschlingen, und auch noch nicht errichtet waren die Statuen der jungen Männer mit ihrem ewig heiteren Lächeln. Dafür war es noch zu früh. Vielleicht war Solons Dichtung das erste Kunstwerk überhaupt, auf das Athen stolz sein konnte. In seinen Versen schuf er neue poetische Sujets: Den epischen Mühen der antiken Helden gegenüber stellte er die täglichen Bemühungen des Menschen um ein Leben in Harmonie; der Freude und dem Leid des Einzelnen den innigen Wunsch nach Gleichheit und Glück in Gemeinschaft. Das Thema seiner Dichtung war die Rettung der Stadt.
Und nichts Geringeres – die Rettung der Stadt – trugen ihm nach einhelligem Beschluss die Athener auf, indem sie ihn zum Schlichter der großen Konflikte ernannten, die damals Arme und Reiche gegeneinander aufbrachten, zum Herrn über die öffentlichen Angelegenheiten, mit dem Auftrag, das Vaterland neu zu organisieren. Solon hätte sich zu einem Tyrannen aufschwingen können, und viele Athener hätten ihn dabei unterstützt. Korinth hatte Periander, Megara Theagenes, Sikyon Kleisthenes … Aber dem Dichter schwebte ein neuer Weg vor, um den Bürgerkrieg abzuwenden: Er wollte die Teilhabe aller am Gemeinwesen verbessern.
Überzeugt davon, dass die Stadt nie genesen würde, wenn man das Übel nicht an der Wurzel ausriss, verordnete Solon die Seisachtheia, einen »Schuldenerlass«: Die Schulden, die einen Großteil der Bevölkerung zu Sklaven machten, sollten nichtig sein und künftig verboten jegliche Vereinbarung, bei der für ein Darlehen mit der persönlichen Freiheit zu bürgen war. Um in einem bedrohten Gemeinwesen die Reichen mit den Armen zu versöhnen, fasste Solon einen mutigen Beschluss: Er opferte die Ansprüche der Gläubiger, um das Überleben der Schuldner zu ermöglichen, und legte so den Grundstein für ein neues System, bei dem der Mensch mehr zählte als Reichtum.
Und so ließ er aus den Feldern die hölzernen und steinernen Markierungen reißen, die sichtbaren Zeichen jenes Sklaventums, und begrenzte die Höhe von Erbschaften und die Größe von Landbesitz; doch er war klug genug, die Ansprüche der Armen nicht bis zur letzten Konsequenz durchzusetzen, und verzichtete auf eine Umverteilung. Stattdessen gab er den Entrechteten etwas, was sie noch nie zuvor besessen hatten, etwas von wesentlich größerem Wert: Er machte sie zu rechtmäßigen Mitgliedern der neuen Volksversammlung und der neuen Geschworenengerichte, das heißt, er beteiligte sie direkt an den Aufgaben der Regierung und der Ausübung des Rechts.
Unter Solon wurde durch ökonomische Ungleichheit und der damit einhergehenden sozialen Ungerechtigkeit ein Prozess in Gang gesetzt, der schließlich zur Demokratie führte. Der Dichter versuchte, das System so zu gestalten, dass die Reichen nicht mehr die Armen ausnutzen konnten, dass die Verbindung zwischen Reichtum und Macht gekappt und stattdessen die zwischen Macht und Individuum geknüpft wurde; die ökonomische Ungleichheit versuchte er dadurch zu lindern, dass er politische Gleichheit förderte; und vor allem versuchte er zu erreichen, dass die Freiheit nicht mehr eine Unterkategorie von Besitz war. Damit legte er den Grundstein für etwas, das zu einer ewigen Herausforderung werden sollte: das Streben nach sozialer Gerechtigkeit, den ethisch motivierten Kampf gegen die von niederen Instinkten, roher Gewalt, ja vom Schicksal und der Natur selbst erzeugte Ungleichheit; ein großmütiger Einsatz des Menschen für den Menschen, der seinen Schwächen und Stärken gleichermaßen Rechnung trägt.
Die Seisachtheia, die mutige Entscheidung also, die auf Schulden beruhende Sklaverei abzuschaffen, war zweifellos eine jener Taten, die der Idee der Menschenwürde, Zivilgesellschaft und Demokratie den Weg ebneten. Heute, zweitausendsechshundert Jahre später, ist die auf Schulden beruhende Knechtschaft noch immer nicht abgeschafft, im Gegenteil: Es gibt immer noch Mächte in der Welt, politische wie wirtschaftliche, die es geradezu darauf anzulegen scheinen, die Menschheit mit Hilfe von Schulden de facto in sklavischer Abhängigkeit zu halten.
»Warum denn sollte ich, weswegen ich das Volk
zusammenbrachte, davon lassen vor dem Ziel?
Bezeugen soll es bei dem Richterspruch der Zeit
die größte Mutter, die der Götter des Olymp,
die beste schwarze Erde, der ich einst entfernt
den Grenzstein, überall in ihren Leib gerammt;
war sie vorher versklavt: jetzt aber ist sie frei.
Auch hab ich viele nach Athen zurückgeführt,
vom Gott erbaute Vaterstadt; verkauft mit Recht
der eine, ohne Recht der andre; Schuldenlast
die einen trieb, der Heimat Sprache hatten sie
nicht mehr gekannt, sie irrten überall umher.
Die andern litten Schmach und Knechtschaft hier,
die Launen der Despoten fürchtend. Sie hab ich
gemacht zu Freien. Nur mit des Gesetzes Kraft
– Gewalt und Recht: ich brachte sie zur Harmonie –
vollbracht’ ich dies, und mein Versprechen wurde wahr.
Für Gute wie für Schlechte schrieb Gesetze ich
in gleicher Weise, fügte jedem gleiches Recht.
Ein andrer, hätte er wie ich die Macht erlangt,
ein schlechtgesinnter Mann, der nur auf Beute aus,
er hätte nie das Volk bezähmt; denn hätte ich
gewollt, worum sich meine Gegner einst bemüht,
oder die Pläne derer, die mit diesen feind,
die Stadt, sie hätte dann Verluste ohne Zahl,
deshalb beschafft’ ich mir von allen Seiten Schutz
und wandte mich wie in der Hundeschar der Wolf.«7
DURCH MELITE, ZUR PNYX
Wenn man auf dem kahlen Plateau des Nymphenhügels von Stein zu Stein hüpft, bekommt man ein gutes Gefühl dafür, dass der Berg ein einziger Felsen ist, ein riesiger, kompakter, von Wasser und Zeit geschliffener Stein mit Spalten, die ein geheimnisvolles Schnittmuster zu bilden scheinen. Einst standen hier die Häuser des Stadtviertels Melite, und darin wohnten Themistokles, Miltiades, Kimon … So seltsam ist diese karge Gegend, dass einem scheinen will, sie wären noch immer hier.
Ein verlassenes Wachhäuschen erinnert heute noch an den Ort, an dem einst das Eingangstor stand. Ein Stück weiter den Weg entlang, vorbei an Pinien, Johannesbrot- und Olivenbäumen, eröffnet sich plötzlich, direkt und unverhofft der schönste Blick auf die Akropolis überhaupt: wie von innen her leuchtend, über einem Wald, der sie kraftvoll in den Himmel zu stemmen scheint. Hier ist der Ort, den die antiken Griechen schlicht »die Felsen« nannten, ein hohes Plateau, das vermutlich schon in den Anfängen Athens für Versammlungen genutzt wurde. Heute ist es fast immer menschenleer, eine merkwürdige Oase aus Luft und Stein, fast so etwas wie ein Krater auf der höchsten Erhebung der Stadt. Hier trat die Volksversammlung zusammen, die Gesamtheit aller Bürger mit Sitz und Stimme. Wenn es einen konkreten Ort gibt, an dem die Demokratie geboren wurde, dann ist es dieser, das Felsenplateau der Pnyx.
Oben, an dem der Stadt zugewandten Hang, ist ein langes Stück sauber aus dem Felsen geschnitten. Erfolgt ist dieser Schnitt Ende des vierten Jahrhunderts vor Christus, als die Arbeiten an diesem Ort der Begegnung in den letzten Zügen lagen. Zum Abschluss wurde aus dem Stein eine Rednertribüne gemeißelt, und diese Tribüne gibt es heute noch, eine von Menschenhand geschaffene Modulation des Geländes. Dahinter, ebenfalls auf dem Felsen, stand ein Altar zu Ehren von Zeus Agoraios, dem Beschützer der öffentlichen Redner. Die Cavea, auf der die Bürger Platz nahmen, reichte damals bis zu den Zypressen dort unten. Heute wachsen Bäume auf den riesigen Quadersteinen der Stützmauer, die seinerzeit errichtet wurde, um dem Halbrund ein Gefälle hierher zu verleihen, hin zur Tribüne. Es handelte sich um die Erweiterung einer früheren Cavea aus der Zeit der Dreißig Tyrannen, und auch dieses Halbrund hatte der Stadt den Rücken zugekehrt. Davor aber, in den Tagen des Themistokles und des Perikles, setzte sich das Volk wie heute direkt auf den Hang, mit Blick auf Athen. Die Tribüne war ein simpler Stein, etwas weiter unten gelegen, umgeben von einigen Holzbänken für die Prytanen. Alle anderen brachten wahrscheinlich ein Kissen oder einen Hocker mit oder machten es sich auf dem Boden bequem, auf diesem Felsen, der wie jetzt auch die Wärme speicherte. Der Redner hatte seine Mitbürger direkt vor Augen und sah, wenn er den Blick hob, nur die Bäume und den Himmel. Die Bürger hingegen sahen ihre Häuser, ihre Felder, zur Linken den Parnitha, zur Rechten den Hymettos, in der Mitte den Pendeli, den Lykabettus, den Areopag und die Akropolis. Und im Hintergrund säuselten der Wind und die Zikaden. All dies ist heute noch hier, als wären nur die Menschen verschwunden. Nikias hat es auf den Punkt gebracht: »… und ihr Athener werdet die große Macht eurer Stadt, mag sie auch jetzt erschüttert sein, wieder aufrichten; denn Männer machen eine Stadt, nicht Mauern und nicht Schiffe ohne Männer.«8
Dieser erste Versuch, einen Ort zu schaffen, an dem Gerechtigkeit möglich war und die Menschen ihr Schicksal selbst bestimmen konnten, war geprägt davon, dass die Bürger selbst die Stadt waren, ergo der Staat. Es gab keine Trennung zwischen Staat und Bürgern. Mit seiner mutigen Maßnahme, bei Entscheidungen alle Bürger zu beteiligen, machte Solon den Staat zu einer Organisation, deren Aufgabe darin bestand, das Gemeinwohl und die Rechte des Einzelnen gegen die Willkür und die Privatinteressen mächtiger Familien und ihre Herrschaftsinstrumente zu verteidigen. Mit anderen Worten: Der Staat war von Anfang an konzipiert als ein WIR gegen SIE.
Jene damals hier oben versammelten Athener erfanden etwas Neues: den Bürger. Bis dahin war der Mensch noch nie Bürger gewesen. Es gab nur hierarchisch organisierte Kulturen, bei denen die Macht sich in den Händen eines Gott-Königs konzentrierte oder auf eine Kaste verteilt war, aber es gab keine Kultur des Bürgertums. Das Bürgertum entstand an diesem Ort, bei jenen Menschen, die sich zum ersten Mal gegenseitig anerkannten als Teilhabende einer »unbegrenzten Macht«, einer ἀόριστος ἀρχή (aóristos arché),9 die der politischen Essenz der Gesellschaft selbst entströmt, die stets wirksam ist in der Gesamtheit ihrer Mitglieder und die jeden zu einem legitimen Ausübenden macht, der in der Volksversammlung und den Gerichten mitwirkt.10 Dieser bewusste Pakt ist die Geburtsstunde der Demokratie. Die konventionelle Geschichtsschreibung jedoch wird nicht müde zu behaupten, dass es die Siege über die Perser und der anschließende ökonomische und moralische Aufschwung gewesen seien, die der Demokratie den Weg geebnet hätten. Wie einfältig! Dabei wissen wir doch alle, dass es in der Welt unzählige Siege gegeben hat, die Euphorie und materiellen Wohlstand nach sich zogen, aber mitnichten etwas Vergleichbares in die Welt brachten. Die Demokratie entsprang der Seele der Griechen, die seit Homer und Hesiod begriffen hatten, dass das Leben eines jeden Menschen einzigartig ist und mehr wert als jeglicher Schatz und jeglicher Ehrgeiz. Es entsprang ihrem Wunsch, das zu verteidigen, was dem Menschen zutiefst eigen ist, dem unermüdlichen Streben nach dem Universellen, der festen Überzeugung, dass Gerechtigkeitssinn und Wille Teil der menschlichen Natur sind. Die Demokratie entsprang der tastenden Suche nach etwas, das es vorher nicht gegeben hatte, dem mühsamen Prozess der Bewusstwerdung, der Versöhnung und des Verzichts; sie hat nichts zu tun mit den Siegen über die Perser, sie geht ihnen voraus. Die Demokratie war eine enorme Errungenschaft: Noch nie hatte die Meinung eines einfachen Menschen so viel politisches Gewicht wie damals bei der Versammlung auf diesem Platz. Diese Erfahrung – bei allen Mängeln, die man aufzeigen könnte – schenkte der Gesellschaft das Gefühl von Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit und Verantwortung, schenkte ihr Teilhabe an der Definition und Verteidigung des Gemeinwohls, wie es sie bis dahin nicht gegeben hatte und in nachfolgenden Epochen auch nicht wieder geben sollte. In diesem Sinne, als reine Form, erscheint die Demokratie von diesem Hügel aus betrachtet wie eine zweite Akropolis, als eine Idee, die die Zeit nicht fürchtet.
Es hat seinen Grund, warum die Schöpfungen und Ideale jener athenischen Gesellschaft eine bleibende Wirkung auf die Nachwelt hatten und nicht die Schöpfungen und Projekte anderer Gesellschaften, einschließlich griechischer wie der spartanischen. Letztlich ist die Geschichte der Athenischen Demokratie nichts anderes als die allmähliche Übertragung der Macht auf die Bürger. Vielleicht lohnt es, sich in dieser nie zur Ruhe kommenden Stadt auf die Spur dessen zu begeben, was einmal zu dieser großartigen Errungenschaft geführt hat; auf die Spur zu dem, was ihr Vermächtnis und ihr Auftrag ist; es jetzt zu tun, als etwas, das keinen Aufschub duldet, jetzt, da in unseren mangelhaften Demokratien die Kluft zwischen Entscheidern und Bürgern immer größer wird.