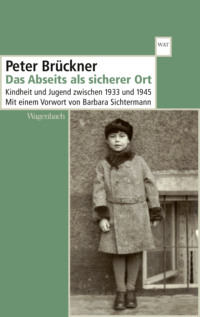Kitabı oku: «Das Abseits als sicherer Ort», sayfa 3
Die Konfirmation
Wollte ich meine Erinnerungen so darstellen, wie sie sich mir spontan aufdrängen, so wäre der Leser wahrscheinlich über lange Strecken enttäuscht. Habe ich denn eben über Lebensverhältnisse im NS-Staat berichtet? Immer sind es unsere Theorien, die der Macht – des NS-Staats, des Staats überhaupt, des Kapitals – eine Totalität des Zugriffs einräumen, die die Macht wohl anstrebt, aber eben nur in unseren Theorien erreicht. Immer bleibt deshalb eine Kindheit im Faschismus eine Kindheit. Und selbst dort, wo die These vom totalitären Zugriff – oder von der »reellen Subsumtion« – an der Daseinsweise von Menschen empirisch belegt werden könnte, gerät meist in Vergessenheit, daß auch Kinder und junge Leute sich entscheiden; so daß, wie die Ähnlichkeit unter eineiigen Zwillingen, auch die Kongruenz von herrschender Ideologie, Klassenlage und Innerlichkeit im modernen Staat irgendwann von den Individuen selbst gewollt, angenommen, ja vielleicht sogar gesucht worden ist. Andererseits bleibt, wer die Übereinstimmung (oder Subsumtion) nicht will, keineswegs ungeschoren. Er muß sein »Nein« gegenüber der faktischen Normalität ja realisieren und nicht nur »denken«, sonst denkt er es nicht sehr lang. Er braucht Kritik im Handgemenge, das heißt ein gemeinsames Gelände mit der Macht. Das Abseits, von dem ich so oft spreche: der Ort also, wo wir vor der Faschisierung sicher sind, ist nur anfangs ein Geschenk; wir erhalten es uns in der Regel doch nur als Realitätstüchtige. Realität ist aber zu großen Anteilen die Realität der Macht. Ohne ein Minimum an Anpassung, ohne einen Rest an Bereitschaft zum Handel (»bargaining«) fände man nicht einmal Nischen, um sich zurückzuziehen, und verlöre bald die Chance, eigene Produktivkräfte zu entwickeln – wie aber soll Dissidenz, wie Flucht, wie Widerstand ohne entfaltete Produktivität auf Dauer zu stellen sein? Auf seine Weise versteht auch der Vierzehnjährige schon, worauf es in der Diktatur ankommt: weder Opfer des Systems (des Kriegs, des Staats, der Ideologie, der Polizei) noch sein Handlungsgehilfe zu werden. Zwischen beiden Extremen oszilliert seine jugendliche Lebenspraxis. So lange, bis er von Umständen und Lebensbedingungen dazu genötigt wird, diese Praxis zu revidieren: er kann sich eines Tages nur retten, indem er Widerstand leistet. Im NS-Staat bedeutete dies wiederum: realitätstüchtig zu sein, sich im Gelände der Macht geschickt und wach zu bewegen.6
In diesem Zusammenhang bildet meine Beziehung zur Jugendorganisation des NS-Staats, zur NSDAP und zu anderen Institutionen natürlich eine Achse des Identitätsproblems und der Dissidenz. Ich will aber eher chronologisch als systematisch vorgehen und weder auf Reflexionen noch auf Handlungsvollzüge späterer Jahre vorgreifen; daher ein frühes Beispiel für lebensgeschichtliche Dialektik, das von entglittenen Lernprozessen nicht frei ist. Man betritt das »gemeinsame Gelände« in kritischer Absicht, aber man verläuft sich in ihm.
Wie war denn meine Situation 1936? Im Internat kann die Kontrolle über die Schüler in mancher Hinsicht optimale Werte annehmen. So war es fast ausgeschlossen, das Haus auch außerhalb der an Wochentagen spärlich bemessenen Stadtfreizeit zu verlassen. Und fast unmöglich, den Unterricht in der Schule zu schwänzen. (Die Schule wurde von etwa 600 Jungen besucht, die meisten Externe.) Doch auch der Beitritt zur Jugendorganisation, Jungvolk oder HJ, war praktisch unvermeidbar.7 Es gab aber im Internat keine eigene Gruppe, home made – unsere Dienstorte und -stellen lagen in der Stadt.
Der Beitritt in meinem Falle: – der Wiedereintritt – war nicht nur praktisch unumgänglich, weil vom Internat und den Mitschülern kontrolliert. Ich empfand ihn durchaus auch als starke Versuchung. Und dies eben nicht aus den Gründen, von denen man heute häufig liest: weil der Vierzehnjährige auf die Sensationen des Lagerfeuers, der Lieder, der Nachtwachen, Kriegsspiele und Zeltplätze hofft, auf Unternehmungen, die, wie er weiß, den Alltag des Dienstes nicht ausmachen; oder weil ihn die Peergroup magisch anzieht; oder einfach weil die Teilnahme am Dienst sich in Schule und Internat von selbst versteht. Sondern weil er zu solchen Zwecken das Internat verlassen darf – nicht nur darf, sondern muß; ein »muß«, vor dem sich der Zwang der Hausordnung als bloßes Papier erweist. Weil der Zwang des Dienstes den des Hausmeisters und der Hauslehrer bricht; weil zwischen dem »Dienst« und dem Zeitpunkt der Rückkehr ins Internat eine wie immer schmale Marge an Zeit entsteht, die sich der herrschaftlichen Kontrolle entzieht. Die Versuchung, sich in Jungvolk und HJ zu organisieren, lag also in der antiautoritären, ja rebellischen Chance, die sie dem Heranwachsenden bot. Ihre objektive Basis war die Rivalität der Institutionen Schule und HJ.
Die antibürgerliche Rebellion der HJ hatte im Jahre 1936 jedoch schon gar keine Substanz mehr, sie war nur noch pseudo. Ein Vierzehnjähriger bemerkt das nicht oder nicht deutlich: »pseudo« ist manches in ihm selbst. Identitätsfindungen, pubertäre Krisen enthalten immer ein Stück Spektakel, Effekte, denen die Ursache fehlt. So war es eben doch so, daß mich bei aller Abneigung ein Stück Faschismus auch anzog – aus welchen guten oder trüben Gründen auch immer.
Erst in den Jahren nach 1937 ging ich durch einen lebensgeschichtlichen Kristallisationsprozeß, der dieses Moment des Schwankens eines Tages tilgte – ein Prozeß, der mir selbst, und gewiß mit Recht, als glückliche Kontinuität des »ich, ich selbst …« erschien, weit weg vom NS-Staat, von Politik. Daß er mich noch vor Ende der Schulzeit in enge Beziehungen zu Antifaschisten, zu kommunistischen und liberalen Intellektuellen gebracht und sich wie mit einem Male politisiert hat, lag zwar in der Geschehenslogik dieser Kristallisation, aber keineswegs in jenen inneren Bildern, die ich mir damals von zukünftigen Ereignissen machte.
Es gab einen Wendepunkt, Ostern 1937, der die »alte« Periode – 1934 bis Ende 1936 – in einigen ihrer Widersprüche zusammengefaßt und zu neuen Entwicklungen übergeleitet hat: meine Konfirmation. Die »Einsegnung« war damals im evangelischen Sachsen durchaus üblich, einer der kirchlichen Riten, die der NS-Staat den Bürgern ließ. Ende 1936 gab es daher für meine Altersstufe den »Konfirmanden-Unterricht«, der von einem Geistlichen erteilt wurde. Als ich mich anmelden wollte, stellte sich heraus, daß ich gar nicht getauft war. Ich wußte das nicht oder hatte es längst vergessen.
Mein Vater war der Auffassung gewesen, sein Sohn solle eines Tages selbst entscheiden, wie er sich zu Gott und Kirche verhalten wolle, ohne ein im Zustand vollständiger Unmündigkeit verhängtes Präjudiz. (Dies war ein Akt der Emanzipation von seiner Seite: in der väterlichen Familie hatte es viele Generationen lang unter den Söhnen immer mindestens einen Pfarrer gegeben. Es existierte ein Erbanspruch auf evangelische Theologie; ich werde an anderer Stelle darüber berichten.)
Es ist nicht leicht, deutlich zu machen, wie sehr ich im Internat ein Außenseiter und manchmal ein outcast war, aber nur wenn man das weiß, wird der »Wendepunkt Konfirmation« verständlich. – Nach den anarchischen Perioden der letzten Dresdener Jahre konnte mein Verhältnis zu Regel und Ordnung des Internats nur die Form des erbitterten Kriegs annehmen, und der Wechsel vom gelernten Alleinsein, ja der Lust an der Einsamkeit, in eine große Schülergemeinschaft enger räumlicher Konzentration ließ mich reagieren wie ein in die Enge getriebenes Tier. (Die vorhin erörterten Beziehungen zum Mädchenwohnheim hatten auch die Funktion des buen retiro; das hat allerdings meine Lage auf »meiner« Seite des großen Gebäudekomplexes nicht gemildert.) Und wenn sich meine Position schließlich verbesserte, so zunächst jedenfalls nicht infolge entwickelter sozialer Kontakte, sondern durch etwas, was man meine Unbeugsamkeit nennen mag, oder die Unfähigkeit, mich anzupassen – so oder so, es machte auf Schüler und Hauslehrer mit der Zeit Eindruck. Dann die Entfaltung einer gewissen polemischen Intelligenz, die auch Ältere lehrte, mir lieber aus dem Wege zu gehen; einige Jäger wurden scheu. Und erst als letztes eine Freundschaft mit Älteren, die Schutz gewährte (aber das kam erst später).
Gut, es stellte sich also heraus, daß ich nicht getauft war, daher auch nicht zum Konfirmanden-Unterricht zugelassen werden konnte. Es mag unlogisch erscheinen, daß ich diesen Ausschluß nicht hinnehmen wollte. Wäre es nicht ein »Abseits« gewesen, ein Moment, sich zu unterscheiden? Hätte es mir nicht sogar zusätzlichen Unterricht und die Teilnahme an Zeremonien erspart? Doch es war ein Moment der Differenz, das nicht eigentlich das »meine« war, kein Aspekt des »erbitterten Kriegs«, ein zufälliges, nicht angeeignetes, sinnarmes Moment der Nicht-Übereinstimmung. Nahmen denn alle evangelischen Schüler meines Alters an der Konfirmation teil? Nein, einige nicht. Aber warum? Entweder waren ihre Eltern Angehörige einer der vielen Sekten, die es in Sachsen immer gegeben hat: wunderliche Heilige, mit meist geduckten, stillen Kindern, mit denen ich nichts gemeinsam hatte, oder es waren die Söhne dezidierter Faschisten, deren aufgeblasene Kirchenfeindlichkeit nur die andere Seite ihrer »Weltanschauung« war. Da lag mir alles an Distanz und nichts an objektiver Nähe. Überdies hatte ich begonnen, Träumen und Stimmungen nachzugehen, die wir »religiöse« nennen. Am Religionsunterricht war ich sogar sehr interessiert, so selten er mir damals auch das gab, was ich erwartete.
Kurz: ich ließ mich in Dresden taufen und wurde Ostern 1937 in derselben Kirche konfirmiert. Nun war die Konfirmation aber, anders als die Taufprozedur, ein öffentlicher, kein privater Akt. Diese kirchliche Öffentlichkeit hat bekanntlich ihre spezifische Verkehrsform. Man erschien reinlich und gut gekleidet – es gab dafür ein besonderes Kleidungsstück, den »Konfirmanden-Anzug«. Ihn neu zu erwerben, lag außerhalb der finanziellen Möglichkeiten meines Vaters; er mußte irgendwo geliehen werden – aber wo? Dann gab es für die Feier eine peinliche Choreografie, die im Unterricht eingeübt worden war.
Und nur über der Taufe hatte ein schwacher Glanz des Magischen geschwebt, eine Erinnerung an jene unio mystica, von der ich später in den Predigten des Meister Eckehart las; die Konfirmation dagegen roch. Sie roch nach Unterwerfung, nach faktischer Normalität. Sie trieb den Geist aus wie ein unerwünschter preußischer Katechet.
So machte ich Gebrauch von einer Möglichkeit, die es immerhin gab, obwohl in meinem Erfahrungsumfeld kaum jemals genutzt: die Teilnahme am kirchlichen Zeremoniell in Jungvolk-Uniform. Für mich war dies die Fortsetzung des »Kriegs« gegen die Normalität. Ich wurde auf paradoxe Weise im Abseits konfirmiert, nämlich unter dem Hakenkreuz, und an gewissen Stellen des Rituals, wo man sich eigentlich verbeugen sollte, schlug ich die Hacken zusammen wie ein Soldat – eine Abwandlung der Zeremonie, die nirgends vorgesehen war, aber die Logik faschistischer Formen für sich gehabt hat. Es war, bei Licht betrachtet, Lebenspfusch. Mein Vater war nicht gerade glücklich. Gewiß: Pfarrer, Öffentlichkeit und Ritual mußten es sich bieten lassen, daß einer den Bruch mit ihren Traditionen ausdrückte, während er sich ihren Riten unterzog; Traditionen, die leer genug waren, so daß es ihnen recht geschah. Ich hatte aber die Form gewählt, in der Faschisten mit Traditionen brechen. Ich wählte ihre Uniform als Mittel meines Protests, doch es war ihre Verkehrsform, die sich zum Inhalt meines Protests gemacht hatte.
Ich war am Ende selbst nicht glücklich damit. Es war nicht Scham, was ich empfand, eher ein Verlust von Identität. Das ist ein Niveau, auf dem es sich mit der Lüge schlecht lebt, und ich lebte gern. Ein Vierzehn- oder Fünfzehnjähriger, der hinterher Kaffee und Kuchen genießt »und nicht mehr daran denkt«, denkt sehr wohl lange daran. Was ist denn Mut? Was ich da bewiesen hatte, war keiner. Ich empfand, was ich erst sehr viel später auch ausdrücken konnte: Mut ist die Gesinnung der Freiheit, und das Ergebnis von Freiheit überwältigt den Mutigen, weil es ihn überrascht – es ist nämlich Glück. Ich war aber unglücklich. Jedenfalls wurde die Konfirmation für mich in der Tat das, was sie ihrem kirchlichen Sinne nach einst für den Gläubigen markiert hat: ein Wendepunkt.
HJ-Zeltlager im Hunsrück
In den ersten Sommerferien der Internatszeit ging ich auf große Fahrt, das heißt ich nahm am Zeltlager des Jungvolks (HJ) teil, mit Angst und mit kühnen Erwartungen.
Fürs erste war die »große Fahrt« wohl glaubhaft: Mit der Eisenbahn als bewimpeltem Schiff fuhren wir länger als einen Tag nach Birkenfeld im Hunsrück, also in die Pfalz, für einen sächsischen Jungen sehr weit weg. Danach ein Zeltlager im dörflichen Gelände.
Am zweiten oder dritten Tag schon stand ich am hölzernen Schlagbaum, der das Lager abschloß, in gehöriger Entfernung von der Wache, und sah sehnsüchtig nach den Waldstücken »im Tal«. Es war aber kein Tal da, unser Lagerplatz befand sich auf einer leicht gewölbten Ebene, es sollte nach meinen Erwartungen eins sein:
»Jenseits des Tales standen unsere Zelte,
vor’m roten Abendhimmel quoll der Rauch«,
war eines meiner Lieblingslieder, vor allem zweistimmig gesungen, doch auch in meiner literarisch geprägten Phantasiewelt war »Tal« eine Chiffre für das trunkene Verhältnis zur Natur. Das Draußen, von dem der lyrische Sog ausging, war betretbar entweder als Exerzierplatz oder als Ort für laute Spiele, und beidem konnte man sich kaum entziehen. So blieb mir von den Erwartungen der »großen Fahrt« wenig – der Abend am Lagerfeuer und die Nacht. Aber nur der Wachdienst durfte das Zelt für ein oder zwei Stunden verlassen, wenn der Himmel voller Sterne war oder sich im Osten schon erhellte.
Der Dienst bestand zu großen Teilen darin, praktische Bedingungen des Lagerlebens zu garantieren (also für Essen, Trinken, Sauberkeit zu sorgen), dazwischen oder danach: »Schulung«, Spiele, ein Wettkampf; manchmal ein Ausmarsch ins Gelände. Wir hatten auch Freizeit, aber man verbrachte sie im Lager. Erst am sechsten oder siebenten Tag durften wir alle ins Dorf, sahen in Bauerngärten und -häuser, kauften uns was. Bei dieser Gelegenheit verdarben sich einige von uns den Magen, wahrscheinlich am Speiseeis – ich leider nicht. Es gab zwar Fieber und Durchfälle, aber auch den vorgeschriebenen Besuch beim Arzt, der die Erkrankten aus dem Lager entließ: sie wurden nicht nur vom Dienst freigestellt, sondern bei Bauern »privat« untergebracht.
An diesem sechsten oder siebenten Tag hätte ich das Steinhaus dem Zelt schon vorgezogen, die Lust an bewimpelter Fahrt war verraucht. Ich wäre gern allein gewesen. Und in der Stadt hatte ich mich viel besser zurechtgefunden als zwischen Sträuchern und Zelten. Was tun? Sich krank melden? Ich war nicht krank. Einen guten Tag zögerte ich, weil ich meinte, der »Führer vom Dienst« (der für Krankmeldungen zuständig war) würde mir meine schlechten Absichten ansehen können, aber dann faßte ich mir ein Herz. Zu meiner Erleichterung handelte der zunächst telefonisch verständigte Arzt kurz und knapp. Ohne Umstände – und ohne Untersuchung – empfahl er meine Verlegung in ein Bauernhaus. Da saßen wir nun, zu zweit oder zu dritt, und redeten mit den Bauernkindern, die uns neugierig besuchten. Mit Befriedigung hörte ich von einem Führer, der gelegentlich nach den Kranken sah, was wir versäumten: unsere Kameraden erwarben anscheinend ein Sport- oder Leistungsabzeichen – Sprung, Wurf, Wettlauf, Bodenturnen, Übungen im Gelände, sie lernten, wie man mit Kompaß und Landkarte umgeht. In unserem »Abseits« gab es Abenteuer-Bücher aus der Schulbibliothek, und unter den Besuchern ein Mädchen, in das ich mich heftig verliebte. Ich weiß ihren Namen und ihren Geburtstag noch, ja, ich erinnere mich sogar an das Haus, in dem sie wohnte: als acht oder zehn Tage später die »große Fahrt« glücklich vorbei war und die »Kranken« sich pünktlich am Bahnhof einzufinden hatten, lief ich dort rasch noch einmal vorbei; sie sah aus dem Fenster.8
An einem Zeltlager der HJ habe ich nie wieder teilgenommen, sooft ich in den Ferien auch unterwegs war. Die Disziplinarordnung der Hitlerjugend enthielt einen lästigen Paragraphen: »Fahrten ohne Uniform, auch als Einzelwanderer, sind unzulässig«9, und mit Uniform war die Einzelwanderung erst verpönt, dann verboten.
Anfangs wußte ich davon nichts, welcher Junge liest eine Disziplinarordnung? Später kümmerte ich mich nicht darum, weil es keine organisierten Kontrollen gab, und als 1938 ein »Streifendienst« dafür eingerichtet wurde, fand ich einen Ausweg.10
Weihnachten 1937
Ein Mittelgebirge, das »Erzgebirge«, bildet die Ostgrenze Sachsens zur Tschechoslowakei; für ein Dresdener Stadtkind: Wälder, Pilze, holzgefertigtes Spielzeug und Volkslieder im Dialekt. Im Winter nahm man seinen Rodelschlitten mit. Wo die Ebene unweit von Chemnitz (heute »Karl-Marx-Stadt«) ins Gebirge übergeht, lebte ein Onkel meines Vaters, ein evangelischer Landpfarrer. Das Pfarrhaus roch, wie in vielen deutschen Lebenserinnerungen, nach Fröhlichkeit, Holz, Äpfeln und Tabak. Ich hatte als Kind dort abenteuerliche Ferien verbracht, aber das war lange her – zwei, drei Jahre.
Inzwischen war die Grenze zur Tschechei »politisiert«. Im Schullandheim wurde ich mit der Geschichte der deutschstämmigen Minderheiten des Nachbarlandes gelangweilt. »Wehe dem Volk, dessen Grenzländer nicht mehr so dicht besiedelt sind, daß ein dichter Wall von Menschenleibern dem Bevölkerungsdruck eines wachsenden Nachbarstaats standhalten kann!«, hieß es in unserem Geographiebuch. Bei den Friseuren im Dorf konnte man Zigaretten stückweise kaufen, darunter die tschechische Vlasta, für anderthalb Pfennige.
1937 wurden mein Vater und ich eingeladen, die Weihnachtstage »im Kreise der Familie« jenes Onkels zu verbringen. In dieser Phrase verflochten sich Mitgefühl und Kritik. Für die Gewohnheiten des geistlichen Mittelstands war jede Auflösung der Familie, die anders als durch den Tod entstand, Anlaß zur Sorge, das heißt: sie mißfiel. Den NS-Staat verdächtigte man der Familienfeindlichkeit, weil er Kinder gegen ihre Eltern einnahm und familiäre Beziehungen, begründet auf Sitte und göttliches Gebot, politisierte. Bewegte sich eine Mutter, die aus politischen Gründen Land, Mann und Kind verließ, nicht im selben Dunstkreis? Mitgefühl, ja, aber als »absprechende Liebe«.
Auf dem tief verschneiten Weg, in der Heiligen Nacht von Laternen in den Händen der Kirchgänger erhellt, teilte ich meinem Vater meine »absprechende Liebe« zur Verwandtschaft mit: ein gut antinazistisch gesinnter Landpfarrer, dessen großer Stolz noch immer das im Ersten Weltkrieg erworbene Eiserne Kreuz war! Die Bibel als Visitenkarte des »Kriegervereins«! Er litt an den Spätfolgen einer vor Tannenberg erworbenen schweren Verwundung (hatte also unter Hindenburg gekämpft), und, obwohl über den NS-Staat entsetzt, hätte er sich den Granatsplitter, der ihn traf, am liebsten in Gold gefaßt.
Mein Vater mußte nach den Feiertagen zu seinem Job zurück. Ich blieb noch ein, zwei Tage und las. Dann fuhr ich (mit väterlichem Einverständnis) nach Dresden. Das Land, nach dem ich hungerte, war die Stadt; das Abenteuer: dort allein zu sein.
Nicht ohne Zutun des Nationalsozialismus war Dresden für mich eine offene Stadt geworden. Wir sehen die Auflösung alter mitmenschlicher Beziehungen gern unter dem Aspekt des Leidens daran, als machte jeder Verlust arm. Daß meine Mutter nach England zurückgekehrt war, blieb ein Verlust. Aber sie löschte damit die vielen, über sie vermittelten sozialen Beziehungen aus, die ein Kind allein nicht fortsetzen mag oder kann; die ja auch nie wirklich die seinen waren, wenn auch feste familiäre Gewohnheiten. Andere Kontakte zu Menschen, Stadtvierteln und Straßen hatten schon die Emigration des Halbbruders Frank nicht lange überdauert. Oder schwanden langsam, seitdem der Vater nicht mehr gegenwärtig war. (Von Hassan Pré, seinem tschechischen Freund, wußte ich nicht einmal mehr, wo er wohnte.)
Unweit vom großen Garten, den ich beklommen mied – wo war Ellen, wo war Frank? – lebte eine Cousine meines Vaters in wohlhabenden Verhältnissen; sie nicht besuchen zu müssen, war nun möglich und ein Geschenk der Zeit. Bei einer frühen Gelegenheit, meiner Taufe, hatte sie mich mit dem harten, verzopften Blick der NS-Frauenschaft angesehen, der sie nach 1933 beigetreten war. Nicht aus Gesinnung, wie es in der Familie hieß, sondern wegen der Karriere ihres Ehemannes, einem Stadtrechtsrat. (An ihm hatte ich zeitig meine Abneigung gegen Corpsstudenten erworben. Er sammelte Briefmarken – wie ich; dieses »wie ich«, von einem Elfjährigen gesagt, brachte ihn außer sich.)
Verändert vom Straßenverkehr und von Neubauten war das Gelände der Volksschulzeit. Gleichgültig lief ich an dem kasernenartigen Schulgebäude vorbei. Der Bäcker nebenan bedeutete nichts mehr. Dresden war über die alten Schauplätze der Kindheit hinweggewachsen. Ein Stadtviertel nach dem anderen wurde wieder fremd; schon halb angeeignete Straßen, Plätze, Parks hatte die Stadt in ihre Anonymität zurückgenommen. Aber es blieb das mit den Gegenden und Räumen Dresdens verwobene körperlose Netz aus erinnerter Abneigung, Sehnsucht und Trauer; nicht mehr von sozialen Gewohnheiten gestört, nur von der Stadt und der eigenen Innerlichkeit gehalten, ließ es, locker geknüpft, endlich Raum für Entdeckungen.
Der Fünfzehnjährige fand zwischen Fremdheit und Wiedererkennen die städtische Objektivität; zwischen dem »damals« und dem bloßen »jetzt« seine Gegenwart. Ein lustvoller Prozeß des Vermittelns, in dem die Identität beider entstand: der Heimatstadt und dessen, der sie sich aneignen darf, unbeaufsichtigt, von Eltern, Verwandten, sozialen Gewohnheiten entlastet.
So endete das Jahr 1937 groß. Dem »Wendepunkt Konfirmation« war eine neue Entschlossenheit gefolgt, Existenz nicht mehr nur in der Auflehnung zu sehen. Mein erster Silvesterabend allein war der kulturellen Überlieferung Dresdens sogar getreuer, als es die früheren der Familie waren: erst geistliche Musik in einer der großen, zeitig überfüllten Kirchen, dann ein Buch. Ich bin sicher, daß es Goethe war, den ich zur Hand nahm, wenigstens für eine Weile.11 Für die gleichfalls traditionelle Party mit Gästen fehlte mir Sinn und Gelegenheit, doch die unruhige Erwartung der Mitternacht hatte ihre unterhaltsame Seite.
Danach, in den Straßen der Stadt, beim großen Feuerwerk und Neujahrsgeschrei, war die Jahreswende ein Rausch.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.