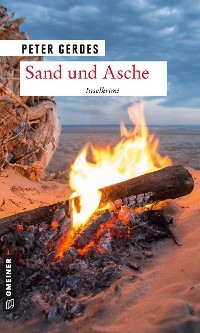Kitabı oku: «Sand und Asche», sayfa 3
6.
»Die Presse wollen Sie belügen?« Kriminaldirektor Manningas dunkle Augen fixierten Stahnke unter hochgewölbten Brauen hervor.
»Warum nicht? Die belügen uns schließlich auch dauernd.« Der Hauptkommissar zuckte die Achseln und erwiderte den Blick ohne ein Zwinkern. Er lächelte nicht einmal. Echt cool, Alter, dachte er selbstzufrieden. Und dann grinste er doch.
Manninga lehnte sich zurück, so dass sein Chefsessel in allen Verbänden krachte. Der Leiter der Polizeiinspektion Leer/Emden war ein erfahrener Mann hart an der Pensionsgrenze, breit und massig gebaut, mit großväterlichem Gebaren. Rein äußerlich war er Stahnke nicht unähnlich. Bloß etwas älter, grauer und dicker, überlegte der Hauptkommissar, dessen eigene weißblonde Stoppelfrisur eine natürliche Tarnung für altersgraue Haare bot.
Nun, Manningas Altersvorsprung war Fakt, daran würde sich auch nichts mehr ändern. Figürlich aber, das musste Stahnke sich eingestehen, hatte in den letzten Monaten eine unwillkommene Angleichung stattgefunden. Auch er neigte zur körperlichen Fülle, die zwar von seinen breiten Schultern halbwegs kaschiert, von der Waage aber gnadenlos ausposaunt wurde. Vergangenes Jahr hatte Stahnke es geschafft, durch viel Bewegung und wenig Wein und Bier ein bisschen abzuspecken; auch der mit seinem Hausumbau verbundene Stress hatte das Seine dazu beigetragen. Über den Winter aber war er wieder bequemer geworden. Das Fahrrad hatte Staub angesetzt – etwas, wozu die Flaschen in seinem Weinvorrat gar nicht erst gekommen waren. Das Resultat trug er jetzt oberhalb des Gürtels vor sich her.
»Wo Sie recht haben, haben Sie recht«, antwortete Manninga augenzwinkernd. »Aber wir reden hier nicht von der Blöd-Zeitung, sondern von der seriösen Tagespresse. Und natürlich von der Öffentlichkeit. Was glauben Sie, was wir da zu hören bekommen, wenn die Sache rauskommt! Und rauskommen wird sie früher oder später, das ist Ihnen ja hoffentlich klar.«
Stahnke schob die Unterlippe vor. »Irgendwann sicher, aber nicht so bald, wenn wir es geschickt anfangen«, sagte er. »Und dann wird die Reaktion davon abhängen, wie erfolgreich wir waren.«
»Tja.« Manninga nickte. »Das ist es eben. Können Sie mir für den Erfolg Ihrer Aktion garantieren?«
»Garantien gibt es keine in unserem Geschäft«, sagte Stahnke.
Schweigend schauten sie sich an.
Es klopfte. Ehe Manninga antworten konnte, wurde die Tür geöffnet.
Stahnke kannte Kay-Uwe Venema natürlich von Pressefotos. In natura wirkte er kleiner und schmächtiger. Graues Sakko, legeres weißes Hemd mit offenem Kragen, graue Hose; der Reeder-Tycoon präsentierte sich in unaufdringlicher Allzweck-Eleganz. Seinen schwarzen Schuhen sah man erst auf den zweiten Blick an, wie teuer sie waren. Schweineteuer. Der Hauptkommissar kannte die Marke. Er hatte sich nicht einmal getraut, Schuhe dieses Labels anzuprobieren.
»Herr Venema.« Manninga hatte sich aus seinem Sessel gestemmt und trat mit ausgestreckter Hand hinter seinem Schreibtisch hervor. Auch Stahnke erhob sich zur Begrüßung. Venemas Händedruck war fest, sein Blick direkt. Die schmale, beinahe zart zu nennende Nase erinnerte stark an die seiner Tochter. Ein femininer Zug, der jedoch durch ein energisches Kinn mehr als ausgeglichen wurde. Auch gegenüber den beiden körperlich größeren Amtsträgern zeigte Venema keine Spur von Unsicherheit.
Sie nahmen in Manningas Besucherecke Platz.
»Kaffee? Oder lieber …«
Venema machte eine knappe, abwehrende Handbewegung. »Was gibt es Neues?«, fragte er.
»Nichts.« Auch Manninga kam gut ohne langes Herumgerede aus. »Das gefundene Projektil wurde untersucht, es passt zu keiner Waffe, die bei uns registriert ist. Nach Fingerabdrücken wurde zwar gesucht, aber das ist bei einem öffentlichen Gebäude wie diesem praktisch aussichtslos. Die Angaben zur Gestalt des flüchtigen mutmaßlichen Schützen sind zu allgemein für ein Phantombild. Im Eingangs- und Außenbereich der BBS-Halle ist die betreffende Person niemandem aufgefallen. Insgesamt wurden an die einhundert Personen befragt. Entweder hat sich der Täter enorm gut in der Gewalt gehabt und ist wie ein normaler Passant davonspaziert, oder er hat die Halle über den Notausgang verlassen und sich dann über das Schulgelände und die angrenzenden Wiesen entfernt.«
Venema nahm Manningas Bericht mit einem leichten Nicken entgegen. Typisch für jemanden in seiner Position, sich dazu nicht an die ermittelnden Kriminalbeamten, sondern an deren Chef zu wenden, überlegte Stahnke. Ob ihm überhaupt bewusst war, dass Stahnke, der ja mehr zufällig mit am Tisch saß, seit seiner Rückkehr de facto der Leiter dieser Ermittlungen war?
»Dann haben Sie also überhaupt nichts in der Hand«, stellte Venema fest. Kein Vorwurf klang aus seinen Worten, aber Stahnke stellte sich vor, er sei beruflich von diesem Mann abhängig, und erschauderte.
»Immerhin haben wir das Projektil«, widersprach Manninga. »Außerdem gibt es, äh … Erkenntnisse zur mutmaßlichen Tatwaffe.« Ein Nicken in Stahnkes Richtung sollte wohl bedeuten, dass damit seine Vermutungen in Bezug auf einen schallgedämpften Revolver gemeint waren.
»Und das nützt Ihnen … was?« Venemas Stimme blieb unverbindlich, sein Blick aber gewann mehr und mehr die Schärfe eines Seziermessers. Der Alpha-Rüde kommt zum Vorschein, dachte Stahnke. Ohne zu knurren, denn er ist sich seiner Rolle sicher. So sicher, dass er sie nicht eigens zu betonen braucht. Ein höflicher Leitwolf, dem jeder die Fangzähne glaubt, auch ohne sie zu sehen.
»Vorläufig nichts«, schaltete sich Stahnke ein. »Sehr viel aber in dem Moment, wenn uns im Zuge der Ermittlungen die Tatwaffe zum Täter führt. Oder aber wenn wir über einen Tatverdächtigen auf die richtige Waffe stoßen. Dann wird das Projektil zum entscheidenden Beweismittel.«
Der sezierende Blick bohrte sich in Stahnkes Augen. Seine sind auch wasserblau, nur einen Tick dunkler als meine eigenen, stellte der Hauptkommissar fest, während er den Blick lächelnd erwiderte.
»Und was, glauben Sie, könnte Sie in dieser Richtung voranbringen?«, fragte Venema. Auch mit größtem Bemühen war seinem Tonfall keine Spur Ironie zu entnehmen.
»Das Motiv«, antwortete Stahnke.
»Welches Motiv?«
»Das«, erwiderte der Hauptkommissar, »ist genau das Problem. Weder wissen wir, wer ein Motiv gehabt haben könnte, Ihre Tochter umzubringen, noch, welches Motiv das sein könnte. Aber vielleicht können Sie uns in diesem Punkt ja voranbringen.«
Das Blicke-Duell hielt an. Weder bei Stahnke noch bei Venema zuckte auch nur eine Wimper.
»Meine Tochter ist eine junge Frau von ungewöhnlich ausgeprägter sozialer Kompetenz«, sagte der Reeder dann. »Ihr Gerechtigkeitssinn bestimmt ihr ganzes Verhalten, das stets auf Ausgleich gerichtet ist. Ob man sich damit Feinde machen kann, weiß ich nicht. Bekannt ist mir jedenfalls kein einziger. Dafür Freunde. Stephanies Freundeskreis ist nicht sehr groß, aber stabil. Ich kenne alle, die dazugehören. Alle mögen, um nicht zu sagen: lieben Stephanie. Ich wüsste wirklich nicht …«
»Was ist mit der Schule?«, hakte Stahnke ein.
Venema hob sein Kinn ein wenig an. »Keinerlei Konflikte, von denen ich wüsste«, sagte er. »Weder in ihrer Klasse noch in einem der vielen Kurse. Das trifft auf Mitschüler ebenso zu wie auf Lehrer.«
»Wie können Sie das so genau wissen?«
Venema hob kurz die Schultern: »Man informiert sich eben.«
»Offenbar nicht nur beim Elternsprechtag.« Ein Schuss ins Blaue, dessen war sich Stahnke bewusst.
»Ganz sicher nicht nur dort«, antwortete Venema nachdrücklich. »Stephanie ist meine einzige Tochter. Seit dem frühen Tod meiner Frau ist sie mein Ein und Alles. Ich kann es doch nicht riskieren …« Er brach ab und senkte erstmals seinen Blick.
Treffer, dachte der Hauptkommissar.
»Inwiefern Risiko?« Manninga nahm die Vorlage auf. »Gab es also doch einen Konflikt, eine Bedrohung Ihrer Tochter, von der Sie bisher noch nichts erzählt haben?«
»Missverständnis.« Venema hob beide Handflächen. »Ich spreche von dem Risiko, nach meiner Frau auch noch meine Tochter zu verlieren. Das ist das Risiko, das ich meine, ganz allgemein gesprochen. Stephanie ist ein außergewöhnlich hübsches Mädchen, das sehe ich wohl nicht nur als Vater so …« Sein beifallheischendes Lächeln in die kleine Runde wirkte routiniert und schien bloßer Konvention zu entspringen. »… und sie wird eines Tages ziemlich wohlhabend sein. Was sage ich, reich wird sie sein, wenn ich nicht noch irgendeinen riesigen Fehler mache.« Wieder dieses Lächeln. Venema schien die Möglichkeit, jemals einen katastrophalen Fehler zu machen, für sich selbst völlig auszuschließen.
»Ihre Stephanie ist sogar ein sehr schönes Mädchen«, bestätigte Stahnke. »Da muss sicher kein Vermögen in Aussicht stehen, um sie für Jungs interessant zu machen. Wie sieht es denn mit ehemaligen Verehrern aus, mit eifersüchtigen Abgeblitzten? Gibt es da vielleicht ein Hass-Potential?«
Energisch schüttelte Venema den Kopf. »Bisher nur Sandkastengeschichten. Und Freundschaften natürlich. Reiterhof, Segelclub, Ruderverein. Wenn Sie wollen, lasse ich Ihnen eine Liste mit Stephanies Kontakten erstellen. Meiner Ansicht nach führt das aber zu nichts.«
»Mit siebzehn noch so brav?« Das war wieder Manninga. »Ungewöhnlich, vor allem heutzutage. Meint sie denn, sie sei noch nicht so weit?«
Diesmal umspielte ein verschmitztes Lächeln Venemas Lippen. »Hab ich sie auch gefragt. Sie meinte, es seien wohl eher die Jungs in ihrem Alter, die noch nicht so weit sind.«
Die drei Männer lachten ein kollerndes Männerlachen. Schau an, dachte Stahnke, eine ehrliche Gefühlsäußerung. Und schon ist sie wieder vorbei.
»Wer ist denn das, der diese Kontaktliste in Ihrem Auftrag erstellen könnte?«, fragte Stahnke, als das Lachen verklungen war.
Venema fixierte ihn wieder scharf. »Meine Büroleiterin«, sagte er dann. Die Verzögerung war kaum messbar.
»Gut«, sagte Manninga. »Diese Liste brauchen wir unbedingt. Irgendwo müssen wir ja anfangen. Auch wenn unser Täter nicht in diesem Kreis zu finden ist – letztlich führt ja doch eins zum anderen. So funktioniert Polizeiarbeit eben, nicht wahr, Stahnke?«
Klingt nach Schlussansprache, dachte der Hauptkommissar. »Eine Chance haben wir natürlich noch, zu einem schnelleren Resultat zu kommen«, schnitt er Manninga das Wort ab. »Wenn man es denn eine Chance nennen will.«
»Was für eine Chance?« Venema, dessen Rücken während des gesamten Gesprächs die Lehne seines Ledersessels nicht berührt hatte, straffte sich noch mehr.
»Nun ja. Dass es der Täter noch einmal versucht, meine ich. Und dass wir ihn dabei überraschen und festnehmen können.«
»Sind Sie wahnsinnig?« Venema schien aus seinem Sessel emporzuschnellen. »Was haben Sie vor? Wollen Sie meine Tochter als Köder missbrauchen? Menschenskind!«
Diesmal hob Stahnke die flache Hand, um Venemas Eruption zu bremsen. »Davon kann überhaupt keine Rede sein«, sagte er. Dann lächelte er den Reeder schweigend an, um ihm die Gelegenheit zu geben, sich zu fangen. Das ging schnell.
»Nicht wir sind es, die etwas vorhaben«, sagte er dann, »sondern der Täter. Davon können, ja müssen wir mit Sicherheit ausgehen. Sobald er erfährt, dass sein Anschlag erfolglos geblieben ist. Und das wird er, und zwar ganz einfach, wenn er morgen früh die Zeitung aufschlägt. Was genau er dann tun wird, wann er es tun wird, das wissen wir nicht. Alle Vorteile sind auf seiner Seite, während wir unsere Kräfte aufteilen müssen, weil wir zugleich schützen und ermitteln müssen. Und das wer weiß wie lange.«
Er schwieg einen Moment, ließ seine Worte einsinken, bemerkte, dass Venema um eine Nuance erblasste. Dann öffnete er den Mund.
Der Reeder aber kam ihm zuvor. »Das machen wir anders«, sagte er. »Ich werde meine Tochter in Sicherheit bringen. Soll die Öffentlichkeit ruhig glauben, dass sie tot ist. Eine Familie, die sich grämen könnte, haben wir ansonsten sowieso keine; Stephanie und ich haben nur einander.«
»Sie wollen Sie für tot erklären lassen?«, fragte Manninga mit aufgerissenen Augen.
»Ich möchte, dass Sie das machen«, sagte Venema fest. »Ich sorge für ein sicheres Versteck. Und ich weiß auch schon, wo. Sie kümmern sich darum, dass der Mörder gefasst wird.« Der Reeder nickte. Für ihn schienen die Segel gesetzt, die Befehle gegeben zu sein.
Manninga schaute Stahnke fassungslos an.
Der breitete die Arme aus. »Wenn Herr Venema das wünscht, dann belügen wir eben mal die Presse«, sagte er und schämte sich seiner Scheinheiligkeit nicht einmal.
7.
Lüppo Buss hielt sich im Hintergrund, als Doktor Fredermann am Rezeptionstisch der Klinik stand und leise auf eine Frau einredete, die dort Dienst tat und deren schneeweiße Kluft das Diensthemd des Inselpolizisten an Blendkraft noch um eine Nuance übertraf. Was der Arzt sagte, war von hier nicht zu verstehen, aber das machte nichts. Der Oberkommissar wusste auch so, worum es ging. Und um das Überbringen schlechter Nachrichten riss er sich nie.
Der Eingangsbereich der Klinik Waterkant, mehr Saal als Foyer, war durch einen geschlängelten Weg mit Mosaikpflaster, ausgedehnte Blumenrabatten, zwei Paar gläserne Automatiktüren und großzügig bemessene Fußmattenflächen dazwischen vom Straßentrubel abgeschirmt. Alles hier drinnen schimmerte silbrig oder strahlte bunt, alles sah nicht nur neu aus, es roch auch neu. Und ein bisschen teuer. Dabei war dieser Laden, so hatte der Oberkommissar gehört, durchaus nicht nur betuchten Privatversicherten oder Selbstzahlern vorbehalten. Vielleicht lag es daran, dass entsprechende Überweisungen nicht von Krankenkassen, sondern von den zuständigen Rentenversicherungsträgern vorgenommen wurden. Erstaunlicherweise schien in deren Kassen doch noch Geld übrig zu sein.
Unweit des halbrunden Rezeptionstresens saßen zwei junge Frauen vor einem deckenhohen Blumenfenster und unterhielten sich lebhaft. Erst jetzt bemerkte Lüppo Buss, dass eine von ihnen in einem Rollstuhl saß. Ihre Größe war schwer zu schätzen, aber sie schien mehr als mittelgroß zu sein. Sie trug einen überdimensionierten Sommerpullover mit breiten Querstreifen in Schwarz und Weiß, der ihre Schmächtigkeit nur annähernd kaschierte. Ihre Hände waren langfingerig und zart, mit auffällig dicken Adern auf den Handrücken. Halblange, dunkle Haare bauschten sich über ihren Schultern, ihre Wimpern waren lang und dunkel, ihr dreieckiges, fein geschnittenes Gesicht war blass. Sie trug eine Brille mit schmalem, eckigem Rahmen aus dunklem Metall. Lüppos Blick registrierte lange Beine in aschgrauen Hosen, schlanke Füße in schwarzen Sandalen, gepflegte Zehen, farblosen Lack.
Jetzt schlug sie die Beine übereinander. Merkwürdig. Wenn sie gar nicht gelähmt war, weshalb saß sie dann im Rollstuhl?
Die Frau kreuzte die Arme über ihrem Schoß und lächelte ihre Gesprächspartnerin an. Ihre Wangenknochen traten dabei stark hervor, und dünne Falten bildeten sich, die senkrecht hinab zu den Mundwinkeln führten. Es war, als trete ihr Totenschädel für einen Wimpernschlag aus ihrem blassen Gesicht hervor. Lüppo Buss erschrak und wandte seinen Blick ab.
Fredermann redete immer noch leise auf die Diensthabende in Weiß ein, die ihren Kopf in den Nacken legen musste, um dem langen Inseldoktor ins Gesicht schauen zu können, so dass ihr rotbrauner Pferdeschwanz frei an ihrem Hinterkopf baumelte. Jetzt nickte sie und griff zum Telefon. Die Miene der Frau war angespannt, ihre Stirn in Falten gelegt. Das Wesentliche schien der Doc ihr schon erzählt zu haben. Lange würde es hoffentlich nicht mehr dauern.
Der Blick des Inselpolizisten blieb an einem weiteren Rollstuhl hängen, der leer an der Rezeption stand. Ein ungewöhnlich breites Exemplar. Gab es Rollstühle für Paare? Und wenn ja, wie koordinierten die wohl die Fortbewegung?
Ein lautes Geräusch hinter ihm ließ Lüppo Buss herumfahren. Etwas Großes, Massiges bewegte sich da auf ihn zu, auf den ersten Blick ein Bär, der schwerfällig herantapste und -schlurfte, laut schnaufend und seinen Körper mit beiden Vordertatzen an der Wand abstützend, um ihn mühsam halbwegs in der Senkrechten zu halten. Aber Bären trugen natürlich keine ausgeleierten Trainingsanzüge im verblichenen Ethno-Look, und Bärenhintertatzen sahen nicht aus wie Elefantenfüße und steckten auch nicht in Aldiletten, deren Riemen beinahe von quellenden Fettwülsten unter bleicher, haarloser Haut überwuchert wurden.
Der Mann – natürlich war es ein Mann, kein Bär – lächelte Lüppo Buss entschuldigend zu, während er an ihm vorbeistampfte, mit den Armen rudernd, als gingen die wenigen Schritte ohne Wandstütze schon über seine Kräfte. Erschüttert stellte der Inselkommissar fest, dass dieser Koloss noch relativ jung war, trotz seines zerquälten Gesichtsausdrucks; Anfang oder Mitte dreißig vielleicht. Sein Gewicht mochte an die vier Zentner betragen, vielleicht auch mehr. Himmel, wie konnte man nur so fett werden?
Immerhin war damit die Funktion des überbreiten Rollstuhls erklärt.
Die Frau in Weiß mit dem rotbraunen Pferdeschwanz stand plötzlich vor Lüppo Buss. »Doktor Fredermann hat mich so weit informiert. Natürlich können Sie Angelas Zimmer sehen, auch ohne Durchsuchungsbeschluss. Die Klinikleitung ist einverstanden. Wir sind alle tief erschüttert.«
»Danke«, sagte der Oberkommissar und streckte seine Hand aus. »Mein Name ist Lüppo Buss.«
»Angenehm«, sagte die Frau. Sie mochte knapp über dreißig sein; ihre goldbraunen Augen waren wach und unbefangen auf ihr Gegenüber gerichtet. »Ich bin Sina Gersema.«
Angela Adelmunds Zimmer lag an einem Korridor, der mehr an ein Hotel erinnerte als an eine Klinik. Auch hier lag dieser typische Geruch nach kürzlich verlegtem Teppichboden und frischer Farbe in der Luft, ein Geruch, der eine neue oder zumindest gerade erst generalüberholte Umgebung signalisierte. Allerdings war er durchmischt mit etwas schärfer Riechendem, das an etwas anderes erinnerte. Autowerkstatt, dachte Lüppo Buss. Gummi. Tatsächlich, die kleinen Rampen, mit denen alle Stufen und Treppchen überbrückt waren, hatten einen Belag aus schwarzem Gummi. Anscheinend waren Rollstuhlfahrer hier nichts Ungewöhnliches.
Das Zimmer war recht geräumig, die Einrichtung im Schleiflack-Stil wirkte solide und ebenso praktisch wie schematisch. Eine schmale Glastür führte zu einem winzigen Balkon. Lüppo Buss spähte hinaus: Hochparterre. Also eher eine Terrasse.
»Natürlich konnte Angela leicht dort hinaus«, sagte Sina Gersema scharf. Sie schien Lüppos Blick sofort bemerkt und gedeutet zu haben. »Aber ebenso gut konnte sie das Gebäude auch durch den Haupteingang verlassen. Schließlich sind wir hier keine geschlossene Psychiatrie, sondern eine Klinik für Essstörungen. Unsere Patienten sind hier, weil sie hier sein wollen.«
»Aber sie müssen sich bestimmten Regeln unterwerfen, stimmt’s?«, konterte Fredermann. »Und die Einhaltung dieser Regeln wird überwacht. Wer dagegen verstößt, hat Ausgangssperre, soviel ich weiß. Oder arbeiten Sie hier etwa nicht mit Sanktionen?«
Die junge Frau errötete leicht. Eine steile Falte erschien über ihrer Nasenwurzel. »In der Tat, es gibt Sanktionen«, bestätigte sie. »Obwohl längst nicht jeder hier von der Richtigkeit solcher Maßnahmen überzeugt ist. Und natürlich werden die Patienten überwacht, in mehr als einer Hinsicht. Das brauchen sie, sonst wären sie nicht hier. Aber das bedeutet nicht, dass irgendjemand mit Gewalt daran gehindert würde, mal an die frische Luft zu gehen.«
Fredermann schnaubte geringschätzig. »Inkonsequenz hilft doch niemandem«, grummelte er. »Außerdem haben wir es hier nicht mit einer illegalen Spaziergängerin zu tun, sondern mit einer toten Patientin. Ihrer Patientin.«
Lüppo Buss hielt sich aus dem Disput heraus. Solange die beiden nichts anfassten, sollten sie sich seinetwegen über den richtigen Umgang mit Essgestörten zoffen. Er schaute sich lieber um.
Der Raum sah aus wie frisch verlassen, recht ordentlich, aber mit den üblichen kleinen Anzeichen, dass er bewohnt war: Zeitschriften, ein Buch neben dem Bett, ein leerer Teebecher auf dem Beistelltisch. Keine Wäsche auf dem Boden, und auch die Schuhe standen säuberlich beieinander neben dem Kleiderschrank. Angela Adelmund schien eine Ordentliche gewesen zu sein. Hätte sie ihr Zimmer verlassen, um es nie wieder zu betreten, wäre es gewiss picobello aufgeräumt gewesen.
»Dieses Zimmer muss kriminaltechnisch untersucht werden«, sagte der Inselpolizist. »Ich werde es versiegeln, sobald die erste Inaugenscheinnahme beendet ist.«
Fredermann schaute ihn konsterniert an; es schien eine Weile zu dauern, ehe er merkte, dass sich das Wortungetüm Inaugenscheinnahme auf das bezog, was sie hier gerade taten.
Sina Gersema hingegen nickte sofort.
Lüppo Buss zog ein Paar Latexhandschuhe aus der Tasche und streifte sie über. Wo beginnen? Bei der Schreibtischschublade, entschied er. Der wahrscheinlichste Aufbewahrungsort für Schriftstücke. Vorsichtig zog er die Lade auf.
Papiere, sorgfältig gestapelt. Obenauf lag ein gefalteter Zettel im DIN-A4-Format, liniert, offenbar aus einem Schreibblock gerissen. Etwas stand darauf, in großen Blockbuchstaben.
Lüppo Buss zog den Zettel heraus und las laut vor: »WENN ICH TOT BIN«.
Selbst Fredermann bekam runde Augen. »Doch ein Abschiedsbrief?«, fragte er. »Wie passt das denn …«
Der Oberkommissar brachte ihn mit einer Handbewegung zum Schweigen. Er faltete das Blatt auseinander. Der Text war kurz.
»Wenn ich tot bin, will ich eingeäschert werden. Mein Körper soll brennen. Meine Asche soll am Osterhook verstreut werden, am Strand und in den Dünen. Alles, was ich besitze, soll mein Bruder bekommen.« Und eine kindlich wirkende Unterschrift. Angela Adelmund.
»Kein Abschiedsbrief«, sagte Lüppo Buss, »sondern ein Testament.«
»Und was für eins«, ergänzte Fredermann, der mitgelesen hatte.
»Ach«, sagte Sina Gersema. »Sie hatte einen Bruder?«