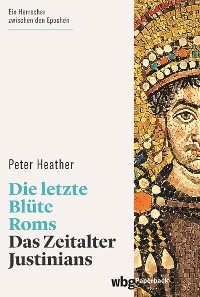Kitabı oku: «Die letzte Blüte Roms», sayfa 3
Was bei einer Aufzählung dieser Taten indes nie fehlen durfte, war der Hinweis auf den göttlichen Beistand, mithilfe dessen der Kaiser seine Siege errungen hatte. Die Darstellung des Barbaren, der sich den Römern unterwift, spielte in der spätrömischen Ikonografie eine wichtige Rolle. Auf diversen Münzen war – oft begleitet von einer passenden Inschrift wie debellator gentium (»Eroberer von Völkern«) – auf dem Revers ein am Boden liegender Barbar abgebildet, der daran erinnern sollte, dass es für den Kaiser quasi zum Tagesgeschäft gehörte, solche Feinde zu besiegen. Besiegte Barbaren in verschiedenen Posen wurden auch regelmäßig auf den Reliefs abgebildet, mit denen die Kaiser die größeren Städte ihres Reiches zu schmücken pflegten, nicht zuletzt an den gewaltigen Triumphbögen.21 Der kapitulierende Barbar war der ideale Begleiter des siegreichen römischen Kaisers, der göttliche Kräfte hinter sich wusste. In ideologischer Hinsicht dienten Darstellungen wie diese dazu, die Botschaft zu verbreiten, dass das derzeitige Regime alles richtig machte.
Die Ideologien des Römischen Reiches, die sich mit dem aufkommenden Christentum kaum veränderten, legten fest, was der Kaiser zu tun hatte – weniger im Sinne bestimmter Tätigkeiten, sondern indem sie (was nicht weniger wichtig war) eine Reihe von Zielvorgaben definierten, die der Kaiser irgendwie erreichen musste. Ein legitimer römischer Kaiser war kein weltlicher Herrscher im modernen Sinne des Wortes, sondern einer, der direkt vom allerhöchsten Schöpfergott des gesamten Kosmos dazu ausgewählt worden war, dafür zu sorgen, dass die zentralen Säulen intakt blieben, auf denen die vernünftige römische Zivilisation ruhte – Bildung, urbanes Leben, niedergeschriebenes Recht und das Wohlergehen der christlichen Kirche; denn diese Säulen sorgten dafür, dass der Mensch dem göttlichen Plan ein Stück weit näherkam, und im Gegenzug sorgte Gott dafür, dass der Herrscher alle, die ihm im Weg standen, auch tatsächlich aus dem Weg räumen konnte. Dieses Konstrukt war bereits mehrere Jahrhunderte alt, als Justinian 527 den Thron bestieg, doch es war wirkmächtig wie eh und je.
Was auch immer ein Regime sonst noch anstellen mochte: Gemessen wurde es daran, ob es in allen Bereichen dem entsprach, wie man sich eine legitime römische Regierung vorstellte, und der weitaus wichtigste Faktor dabei war einer, der sich (scheinbar) ganz leicht messen ließ: der militärische Erfolg. Man sollte stets bedenken, dass hiermit nicht etwa abstrakte Strategien zur Selbstdarstellung des Regimes gemeint sind. Der überwältigende ideologische Imperativ, der der göttlichen Legitimitierung von Macht und dadurch vor allem dem militärischen Sieg anhaftete, hatte für die politischen Prozesse der römischen Spätantike einen regelrechten Dominoeffekt.
Die Politik des Siege(r)s
Dass ein Kaiser behauptete, von Gott persönlich berufen worden zu sein, bedeutete nicht, dass alle politischen Fraktionen jeweils sofort in Jubel ausbrachen und diese Behauptung akzeptierten – im Gegenteil. Die naiv-optimistische Ideologie des Römischen Reiches, es sei der bestmögliche Staat und seine handverlesenen Herrscher seien von göttlichen Mächten eingesetzt, machte es natürlich schwierig, in der Öffentlichkeit eine abweichende Meinung zu äußern. Das kaiserliche Zeremoniell war darauf ausgelegt, dass die einflussreicheren Bürger in der Reihenfolge ihrer gesellschaftlichen Bedeutung ihre uneingeschränkte Zustimmung zu der Grundidee zur Schau stellten, dass sie Teil einer perfekten, gottgewollten politischen Struktur waren. Und wer wollte einer perfekten Struktur widersprechen?
Der bizarre orchestrierte Lobgesang, mit dem die Senatoren an Weihnachten 438 die Vorlage eines neuen Gesetzestextes des Kaisers – des Codex Theodosianus – begrüßten, ist nur ein Beispiel für die formelle Einstimmigkeit, die diese politische Kultur einforderte.22 Einer derart perfektionierten Gesellschaftsordnung konnte wohl nur ein Barbar die Unterstützung versagen. Wer es wagte, in aller Öffentlichkeit Zweifel am Regime zu äußern, lebte gefährlich. Wie John Matthews gezeigt hat, konnte Symmachus, ein Senator des ausgehenden 4. Jahrhunderts, nur mit sehr indirekten Worten signalisieren, wenn er jemanden nicht mochte, insbesondere wenn dieser Jemand ein »Freund« des Kaisers war, dem jener ein einflussreiches Amt zugeschustert hatte.23 Doch auch der Umstand, dass das öffentliche Leben im Römischen Reich ein gewaltiges Maß an formeller öffentlicher Zustimmung erforderte, konnte nicht verhindern, dass Intrigen und Verschwörungen eine Grundkonstante des politischen Lebens darstellten.
Forscher, die sich mit der römischen Spätantike befassen, beschäftigen sich noch immer zu wenig mit dem Phänomen der Thronfolge, obwohl sogar die Abläufe in der modernen Politik bestätigen, wie wichtig das Thema Nachfolge ist. Innerhalb einer höfischen Struktur wirkte sich die Thronfolge auf alle einflussreichen Akteure ganz unmittelbar aus. Für jeden kaiserlichen Günstling war die Vorstellung, dass der aktuelle Herrscher abgelöst wurde, äußerst bedrohlich. Würde ihm das nächste Regime die gleiche Gunst erweisen? Umgekehrt konnten all jene, die beim Kaiser in Ungnade gefallen waren, darauf hoffen, dass sich die Dinge unter seinem Nachfolger zum Besseren wenden würden, und alle, die irgendwo dazwischen »unterwegs« waren, durften auf einen Aufstieg hoffen. Mit anderen Worten: Sobald sich abzeichnete, dass das Reich einen neuen Kaiser bekommen würde, wurden alle bestehenden politischen Bündnisse und Beziehungen neu verhandelt, und allerorten traten lange Zeit unterdrückte Hoffnungen zutage. Und wie man unlängst in Großbritannien beobachten konnte, als Michael Gove, der Boris Johnson eben noch hofiert hatte, auf einmal umschwenkte und versuchte, ihn politisch kaltzustellen, können scheinbar solide Bündnisse von einem Tag auf den anderen zu Bruch gehen, wenn bei gewissen Politikern der Ehrgeiz erwacht.
In der römischen Spätantike gab es ein gewaltiges Spektrum an Gruppen und Fraktionen, für die alles rund um die Thronfolge von höchstem Interesse war. Zuerst war da natürlich die aktuelle Kaiserfamilie, der die naheliegendsten Anwärter auf den Thron angehörten, doch schon dieses Netzwerk dehnte sich mitunter recht weit aus, bis hin zu den Seitenlinien früherer Dynastien. Nach dem Tod von Leo I. gab es in den 470er- und 480er-Jahren in Konstantinopel ein ganzes Jahrzehnt lang Machtkämpfe bei Hofe, in die diverse Cousins, Schwager und sogar Ehefrauen ehemaliger Kaiser verwickelt waren.24 Aber nicht nur mehr oder weniger bedeutende Mitglieder der Herrscherfamilien machten sich Gedanken über die kaiserliche Nachfolge. Mitunter traten auch Außenseiter als Thronanwärter auf den Plan, vor allem wenn es keinen »offensichtlichen« männlichen Erben gab.

Abb. 3 Justinians Onkel und Vorgänger, Kaiser Justin.
Traditionell kommt man an diesem Punkt auf die Armee als politischen Faktor zu sprechen, doch damit ist in der Regel nur der Offizierskader eines ganz bestimmten Segments des römischen Militärs gemeint: derjenige der elitären Feldarmeen nämlich. Hochrangige Offiziere dieser Streitkräfte hatten unter den richtigen Umständen immer gute Chancen auf den Thron. Valentinian I. war ein prominenter Militär, bevor er Kaiser wurde, genau wie Theodosius I. und auch die späteren Kaiser Markian und Justin, Justinians Onkel.25 Ganz gelegentlich kamen auch Bürokraten und Beamte des kaiserlichen Hofs für die Thronfolge infrage. Nach Julians Tod wurde dessen wichtigstem Finanz- und Justizbeamten, dem Prätorianerpräfekten Salutius Secundus, die Kaiserwürde angeboten, die weströmischen Usurpatoren Eugenius (392–394) und Johannes (423–425) waren beide leitende Bürokraten, und Anastasios I., der zweite Kaiser vor Justinian, war zuvor ein ranghoher Würdenträger bei Hofe gewesen.26 Selbst wenn die Umstände eine dynastische Erbfolge diktierten, waren eben jene militärischen und zivilen Würdenträger dennoch stets eng involviert, und viele überlegten sich bereits, während sie noch unter dem aktuellen Herrscher ihre Position zu sichern oder zu verbessern suchten, welches Mitglied der Dynastie sie später einmal unterstützen würden (falls überhaupt mehrere zur Wahl standen).
Aber auch weiter unten in der Hackordnung hatten manche Akteure einen großen Anteil am Prozess der Thronfolge. Viele mittlere Bürokraten gehörten zum Bekanntenkreis einflussreicher Mäzene, deren Erfolg oder Misserfolg ernsthafte Auswirkungen auf ihre eigene Karriere hatte. Mitte der 350er-Jahre versorgten mittlere Finanzbeamte Caesar Julian mit wichtigen Informationen, die es jenem ermöglichten, sich der Kontrolle des Finanzministers und Prätorianerpräfekten Florentius zu entziehen, der ihm von Constantius II. vor die Nase gesetzt worden war, und sich politisch zu emanzipieren. Bereits vorher hatten Funktionäre in der östlichen Reichshälfte Julians Halbbruder, Caesar Gallus, zu einem ähnlichen Manöver ermutigt, aber dort war der Versuch fehlgeschlagen – und am Ende war Gallus tot. In beiden Fällen hatten die Beamten geglaubt, ihr jeweiliger Caesar sei der kommende Mann, und sie hatten sich Vorteile für die Zeit erhofft, wenn er später einmal Kaiser wäre.
Diese Dynamik gab es durchaus auch noch im 6. Jahrhundert. Johannes Lydos’ Wohlstand war eng mit dem Erfolg seines viel einflussreicheren Gönners Zoticus verbunden, des Prätorianerpräfekten des Ostens. Ende der 540er-Jahre versuchte eine Gruppe mäßig gut vernetzter Militärs, Justins Neffen Germanus, der zwar nicht offizieller Erbe, aber ein durchaus plausibler Kandidat für die Thronfolge war, dazu zu bringen, sich an einer Verschwörung zu beteiligen, die den Tod des Kaisers herbeiführen und den Neffen als seinen Nachfolger installieren sollte.27
Noch weiter vom Zentrum der Macht entfernt, auf lokaler Ebene, hatte der Kaiser loyale Erfüllungsgehilfen, die dafür sorgten, dass Steuern ins Staatssäckel flossen. Im Gegenzug nutzten solche Männer – ein klassisches Beispiel ist Synesios von Kyrene zu Beginn des 5. Jahrhunderts – ihre Verbindungen in die Hauptstadt dazu, die politische Agenda ihrer Heimat zu bestimmen; über diesen Umweg hatten auch jene Männer einen nicht zu unterschätzenden Anteil an der kaiserlichen Politik in ihren Feinheiten.28 Auch wenn stets der Kaiserhof im Zentrum der politischen Prozesse der römischen Spätantike stand, hatte dennoch auch ein beträchtlicher Querschnitt seiner landbesitzenden Elite Anteil an diesen Prozessen. Bedenkt man, für wie viele unterschiedliche Interessengruppen der römischen Spätantike die Thronfolge ein heißes Eisen war, ist es wenig verwunderlich, dass die Machtübergabe von einem zum anderen Kaiser nur selten ruhig und gesittet vor sich ging.
Zum einen wusste man nie, wann der derzeitige Kaiser ableben würde. Selbst wenn man verlässliche Daten über die durchschnittliche Lebenserwartung gehabt hätte, so gab es doch immer wieder jemanden, der in dieser Hinsicht alle Erwartungen übertraf. Konstantin wurde 65 Jahre alt und Anastasios sogar erstaunliche 87, doch die meisten Männer segneten zwischen Mitte vierzig und Mitte fünfzig das Zeitliche, wie Constantius II., der einzige von Konstantins Söhnen, der eines natürlichen Todes starb, oder Theodosius II., der 49 Jahre alt war, als er im Jahr 450 starb.
Und manchmal kam der Tod ganz unerwartet. Valentinian I. erfreute sich bester Gesundheit – und dann raffte ihn binnen weniger Stunden ein Schlaganfall dahin; immerhin war er schon Mitte fünfzig und wurde somit von seiner unmittelbaren Umgebung ohnehin bereits mit Argusaugen beobachtet. 45 bis 55 ist nur ein Durchschnittswert, viele Amtsinhaber lebten weit früher ab: Arcadius und Honorius, die Söhne von Theodosius I., starben beide in ihren Dreißigern.29
Die Tatsache, dass es vor ca. 400 nicht üblich war, Minderjährige auf den Thron zu setzen, brachte weitere Komplikationen mit sich, da es immer wieder Nachkommen gab, die für das Kaiseramt qua jugendlichem Alter noch gar nicht infrage kamen. Der Sohn von Kaiser Jovian zum Beispiel verschwand unmittelbar nach dem plötzlichen Tod seines Vaters im Frühjahr 364 komplett aus dem öffentlichen Leben (und vielleicht auch aus dem privaten …).
Plötzliche Todesfälle waren indes nur ein Teil des Problems. Selbst wenn der Kaiser einen erwachsenen männlichen Erben hatte, der bereits die Zügel der Macht in Händen hielt, kam es vor, dass er seine Meinung änderte. Konstantin verstieß etwa nach der Hälfte seiner Regierungszeit Crispus, seinen erwachsenen Sohn aus einer früheren Liaison, zugunsten seiner Söhne mit seiner jüngeren Frau und ließ ihn sogar hinrichten.30 Dieser Schachzug wird das politische Kalkül vieler Beteiligter gehörig durcheinandergebracht haben.
Selbst wenn es einen plausiblen dynastischen Erben gab, brachten es die Struktur und die Dynamiken des politischen Lebens der Spätantike also mit sich, dass ein Regimewechsel selten reibungslos über die Bühne ging. Jedes der spätrömischen Regime war für sich genommen ein Balanceakt, mit diversen Hintermännern unmittelbar unterhalb des Kaisers, die ihre eigene Einflusssphäre kontrollierten und für gewöhnlich miteinander wetteiferten, wer innerhalb des Regimes den größeren Einfluss ausübte. Sosehr man auch den öffentlichen und zeremoniellen Konsens betonen mag: Es wird damals kaum weniger Rivalitäten und Spannungen gegeben haben, als sie für die höfischen Gesellschaften der Frühen Neuzeit dokumentiert sind, zum Beispiel für den Hofstaat Heinrichs VIII. von England. Vor diesem Hintergrund geriet selbst die reguläre dynastische Thronfolge meistens zum Hahnenkampf.
Valentinian I. hinterließ zwei Söhne: den sechzehnjährigen Gratian und den vierjährigen Valentinian II. Als er ganz unerwartet einem Schlaganfall erlag, rief eine Gruppe von Funktionären in Trier, wo Valentinians Hof residierte, umgehend Gratian zum Kaiser aus. Zugleich jedoch machte eine andere Fraktion in Aquincum an der Mittleren Donau dasselbe mit dem kleinen Valentinian II., der seinen Vater auf dessen Feldzug begleitet hatte. Diese Aktion war nichts weniger als ein Staatsstreich. Es folgte ein langwieriger Prozess mit vielen Verhandlungen und mehreren Hinrichtungen: Diverse Hintermänner von Valentinian I. fielen der eigenen Machtgier zum Opfer, darunter der Vater des späteren Kaisers Theodosius I., bevor aus dem Wirrwarr eine neue Koalition hervorging.31
Dass Valentinian II. das Gemetzel überlebte und zurückgezogen ins Privatleben weiterleben konnte, darf über zwei ganz grundlegende Wahrheiten nicht hinwegtäuschen: Erstens war ein Regimewechsel in der römischen Spätantike selbst innerhalb der herrschenden Dynastie in aller Regel schon deshalb eine äußerst unerfreuliche Angelegenheit, da viele Menschen in der unmittelbaren Umgebung des Herrschers alte Rechnungen zu begleichen hatten und sich selbst einen Teil der Macht sichern wollten. Dazu mussten sie mögliche Rivalen isolieren und eliminieren. Und da man zweitens nie wusste, wann der Kaiser sterben würde, mussten alle, die ein substanzielles Interesse am politischen System hatten, stets einen Plan B parat haben, um ihre eigene Position zu konsolidieren, damit sie beim Ableben des Kaisers also nicht mit leeren Händen dastünden und sich, im Gegenteil, ihre Position unter dem künftigen Regime möglichst weiter verbessern würde.
Dieses dynamische Wechselspiel zwischen Tod des Kaisers, Thronfolge und politischem Ehrgeiz brachte es mit sich, dass die politischen Akteure der römischen Spätantike ständig hinter den Kulissen ihre eigenen Pläne schmieden mussten, um für alle möglichen Zukunftsszenarien gerüstet zu sein. Und von der legitimen Sorge um die Zukunft war es da oft nur ein kleiner Schritt hin zu Verrat und Verschwörung. Anfang der 370er-Jahre gerieten mehrere ranghohe Beamte in Antiochia in ernsthafte Schwierigkeiten, als sie einen Dreifuß für eine Séance missbrauchten, bei der sie den Namen des nächsten Kaisers herausfinden wollten. Der damalige Kaiser Valens war außer sich, zumal die Inschrift auf dem Dreifuß den Namen eines der Teilnehmer der Séance nannte und dieser sich deswegen veranlasst sah, politisch aktiv zu werden. In der Inschrift stand gerade einmal »THEOD« – einer der Anwesenden war ein leitender Bürokrat namens Theodoros. Doch er hatte das Nachsehen: Der nächste Kaiser hieß Theodosius32 – was einmal mehr die Bedeutung der praktischen Implikationen der vorherrschenden Ideologien im Römischen Reich unterstreicht.
Denn auch wenn die Ideologien, die die Basis des öffentlichen Lebens bildeten, einen kompromisslosen politischen Konsens zugunsten des gegenwärtigen, von Gott zum Herrscher über die beste aller möglichen Welten eingesetzten Kaisers forderten, so implizierten sie dennoch, dass ein Kaiser auch ohne Unterstützung Gottes an die Macht kommen konnte – oder doch zumindest, dass Gott seine Unterstützung erst dem einen und dann auf einmal einem anderen Thronanwärter zukommen ließ. Ein schönes Beispiel dafür sind zwei Reden, die der Redner Themistios im Jahr 364 für zwei verschiedene kaiserliche Regime hielt: am 1. Januar für Jovian und im Herbst desselben Jahres für Valentinian und Valens. In der ersten Rede, in der er Jovians Konsulat preist, nennt Themistios, wie es sich gehört, jene Details des Aufstiegs des Kaisers zur Macht, die zeigten, dass er von Gott auserwählt worden war. Leider starb Jovian wenige Monate später unter mysteriösen Umständen – offenbar war er doch nicht Gottes erste Wahl gewesen, denn sonst hätte dieser ja nicht zugelassen, dass er so früh verstarb. Genau diesen Umstand greift Themistios dann in seiner zweiten Rede zumindest implizit auf, wenn er betont, was bei der Machtübernahme durch das neue Regime anders gemacht wurde, um sicherzustellen, dass die fehlbaren Menschen dieses Mal bei der Wahl der neuen Kaiser den Willen Gottes richtig verstanden hatten.33
In diesem Fall räumte Themistios im Nachhinein die Illegitimität von Jovians Machtübernahme ein, sodass seine Rede niemandem mehr Anlass geben konnte, irgendwelche Intrigen zu spinnen. Aber dieser Umstand unterstreicht noch einmal, dass es selbst bei einem Posten, der in einem solchen Maße dem öffentlichen Konsens unterlag wie der des Kaisers, niemandem verwehrt war, sich nach anderen Optionen umzuschauen. War der derzeitige Herrscher wirklich Gottes Favorit? Die Unwägbarkeiten der Thronfolge verlangten ohnehin ein hohes Maß an politischem Kalkül, und die schiere Zahl erfolgreicher Usurpationen oder Quasi-Usurpationen – sogar die Inthronisierung Konstantins durch die Anhänger seines Vaters in York gegen den erklärten Willen der meisten Tetrarchen und später diejenige Valentinians II. erfolgten widerrechtlich – beweist, dass Intrigen und Verschwörungen im spätrömischen politischen Leben eine Konstante darstellten, übrigens auch abseits der Thronfolge. Kein Kaiser konnte es sich leisten, diese Vorgänge zu ignorieren, am allerwenigsten jemand wie Justinian, der, wie wir noch genauer erfahren werden, nicht aus einer alteingesessenen Dynastie stammte. Es gab jedoch Momente, in denen ein Regime besonders anfällig war, weil die Intensität der Verschwörungen wuchs und dementsprechend die Wahrscheinlichkeit, dass eine Usurpation von Erfolg gekrönt war, zunahm. Gerade in den ersten Jahren eines Regimes gab es stets eine Vielzahl solcher Momente.
Eine neuere Studie über Karl den Großen und seine Nachfolger hat überzeugend dargelegt, dass ein karolingischer Herrscher zwischen fünf und zehn Jahren brauchte, bis er die Zügel der Macht fest in Händen hatte; so lange dauerte es, solide Beziehungen zu einer Reihe von zuverlässigen Untergebenen aufzubauen, die de facto – im Auftrag des Herrschers – die einzelnen Regionen des Königreichs regierten. Die Verwaltungsbürokratie des Römischen Reiches funktionierte zwar besser als die des Reiches Karls des Großen, aber nicht viel besser, und es war viel größer als das Karolingerreich. In der Praxis war der Erfolg der römischen Regime ebenfalls von zahlreichen lokalen Machthabern abhängig: Sie leiteten die lokalen Gemeinden auf eine Art und Weise, die dem zentralen Regime zum Vorteil gereichte; dies betraf insbesondere das Erheben von Steuern und die Aufrechterhaltung der gesellschaftlichen Ordnung. Folglich wurden die frühen Stadien der Herrschaft von jedem römischen Kaiser dazu genutzt, diese Beziehungen aufzubauen: Man identifizierte potenziell loyale Akteure und förderte sie durch Bezeigungen kaiserlicher Gunst. Aber das brauchte seine Zeit.34
Meiner Ansicht nach sind die Parallelen zwischen den Karolingern und den kaiserlichen Regimen des Römischen Reiches recht aufschlussreich. Der zeitliche Rahmen, innerhalb dessen ein neues Herrscherhaus für Störungen anfällig war, wird noch größer gewesen sein, wenn ein substanzieller Bruch mit dem vorherigen Regime vorlag, zum Beispiel bei einem erzwungenen Dynastiewechsel oder einer direkten Usurpation. Valentinians Bruder Valens, der auf das kurze und wenig erfolgreiche Intermezzo von Julian und Jovian folgte, scheint es während seiner vierzehnjährigen Regierungszeit nie ganz gelungen zu sein, sich die Loyalität der wichtigeren politischen Akteure des Ostreichs zu sichern. Ein weiterer aufschlussreicher Aspekt des politischen Lebens in der römischen Spätantike war, dass eine Usurpation oft eine weitere nach sich zog – von der Auflösung der Tetrarchie Anfang der 300er-Jahre über den Niedergang von Konstantins Sohn Constans im Westen Ende der 340er-Jahre bis in die 470er-Jahre, als in Konstantinopel der isaurische Außenseiter Zenon herrschte.35
Auch externe Ereignisse konnten ein Regime destabilisieren. Anfang der 380er-Jahre verlegte Kaiser Gratian seinen Hof von Trier nahe der Rheingrenze nach Norditalien und gliederte eine große Anzahl von Alanen in seine Feldarmee ein. Diese Alanen waren im Zuge des Chaos, das die Hunnen zu dieser Zeit in Ost- und Mitteleuropa erzeugten (und das auch Gratian veranlasst hatte, seine Operationsbasis nach Mailand zu verlegen, das näher am neuen Epizentrum der Bedrohung lag), aus ihrem alten Stammesgebiet am Schwarzen Meer vertrieben worden. Doch so sinnvoll und nachvollziehbar ihre Eingliederung für sich genommen auch war, sie brachte die bestehenden Machtverhältnisse innerhalb der westlichen Feldarmeen – insbesondere derer, die in Gallien stationiert waren – so sehr durcheinander, dass der Feldherr Maximus den allgemeinen Unmut dazu nutzte, sich als Usurpator (vorübergehend) zum Kaiser aufzuschwingen.
Nicht nur, wenn ein ranghoher Augustus von der Bildfläche verschwand, konnte das die höfische Politik ins Chaos stürzen. Ende der 410er-Jahre heiratete Constantius III. nach einer äußerst erfolgreichen Karriere beim Militär Galla Placidia, die Schwester des kinderlosen Kaisers Honorius, und zeugte mit ihr den voraussichtlichen Thronfolger Valentinian III.; Constantius wurde neben Honorius ganz ordnungsgemäß zum Augustus gekrönt. Doch als er im Jahr 421 plötzlich starb, kam das Gleichgewicht der weströmischen Politik sofort ins Wanken, und das obwohl Honorius immer noch auf dem Thron saß. Wir kennen nicht alle Details, aber offenbar gelang es den widerstreitenden Parteien nun, da Constantius fort war, Bruder und Schwester, die zuvor für einen liebevollen Umgang miteinander bekannt gewesen waren, gegeneinander aufzuwiegeln. Am Ende verkrachten sie sich so sehr, dass Galla mit ihrem Sohn nach Konstantinopel fliehen musste; ihre Flucht und Honorius’ plötzlicher Tod machten den Weg dann frei für den Usurpator Johannes.36
Doch von all den Unwägbarkeiten stellte eine militärische Niederlage noch immer die größte Gefahr für die politische Stabilität dar – aus naheliegenden Gründen. Valens’ gesamtes Regime löste sich mit einem Schlag auf, als der Augustus am 9. August 378 zusammen mit vielen seiner führenden Beamten bei der Schlacht von Adrianopel ums Leben kam. Doch auch einfache Rückschläge, die nicht gleich tödlich waren, konnten schlimme Folgen haben: Als die Vandalenexpedition Kaiser Majorians im Jahr 461 scheiterte, wandten sich so viele Unterstützer von ihm ab, dass sich der patrizische Feldherr Ricimer berufen fühlte, ihn abzusetzen und hinzurichten. Als es Stilicho nicht gelang, den Rheinübergang von 406 und die Usurpation Konstantins III. zu verhindern (die auf Stilichos offenkundige Unfähigkeit zurückzuführen war, den römischen Nordwesten vor Übergriffen zu schützen), verlor er drastisch an Einfluss auf Kaiser Honorius, den er mehr als ein Jahrzehnt lang aufgebaut hatte, seit er im Jahr 395 an die Macht gekommen war. Im August 408 wurde Stilicho gestürzt und hingerichtet. Doch als seine unmittelbaren Nachfolger nicht in der Lage waren, die politische Stabilität wiederherzustellen, wandten sich nach und nach die Unterstützer von ihnen ab. Es folgte eine ganze Reihe kurzlebiger Regime, von deren Protagonisten einige grausam ermordet wurden.37
Jede militärische Niederlage und sogar der bloße Anschein militärischen Unvermögens waren ein politisches Todesurteil, nicht nur ganz real, wenn ein Kaiser auf dem Schlachtfeld den Tod fand, sondern auch weil dies die Verschwörer und Intriganten auf den Plan rief. Schließlich gab es keinen größeren Beweis göttlicher Gunst – und damit kaiserlicher Legitimität – als militärischen Erfolg, und da dieser Erfolg scheinbar so leicht nachzuvollziehen war, galt auch das Gegenteil. Nichts zeigte deutlicher, dass dem aktuellen Regime der göttliche Beistand und damit die Existenzberechtigung fehlte, als ein militärisches Versagen, das die politische Stabilität beeinträchtigte. Insofern ist es kaum verwunderlich, dass es viele Kaiser, wenn es um den Ausgang einer Schlacht ging, mit der Wahrheit nicht allzu genau nahmen.
Ein Remis in einen Sieg oder einen kleinen in einen großen Sieg umzudeuten – das waren die offensichtlicheren Strategien, wie Themistios sie in den Reden, die er Mitte des 4. Jahrhunderts für diverse Regime verfasste, bis zum Gehtnichtmehr wiederholte. Gleich in seiner ersten Rede behauptete er, der Vormarsch von Constantius II. auf Singara im Jahr 344 habe den persischen Großkönig Schapur zu Tode erschreckt, und verschleierte die Tatsache, dass es überhaupt keine Schlacht gegeben hatte. Das Gipfeltreffen von Valens und Athanarich im Jahr 369 wurde mit den Mitteln der Rhetorik als gewaltiger Triumph dargestellt (inklusive einem Flussufer voll demütig murmelnder Goten), obwohl (beziehungsweise gerade weil) das neue diplomatische Abkommen für eine viel größere Gleichberechtigung zwischen den Parteien sorgte als der Vorgänger, und das nach drei für das römische Militär äußerst frustrierenden Jahren. Auch den Umstand, dass es Theodosius im Anschluss an Adrianopel nicht direkt gelang, einen Sieg über die Goten zu erringen, beschönigte man mit einer ganzen Reihe von Behauptungen; so hieß es, der neu ausgehandelte Vertrag sei eben nur eine andere Art von Sieg und im Grunde genommen ein viel größerer Triumph.38
Diese Inszenierungsstrategien waren dermaßen verbreitet, dass es genauso üblich wurde, seine Rivalen der Übertreibung zu bezichtigen. Das Regime von Constantius II. setzte alles daran, die möglichen politischen Konsequenzen von Julians überwältigendem Sieg über die Alamannen in Straßburg im Jahr 357 zu begrenzen, indem es behauptete, jeder Trottel hätte einen Haufen »nackter Wilder« besiegen können. Wer ein Stratege sei, zeige sich allein im Kampf gegen die Perser im Osten.39
Der politische Imperativ, militärische Siege zu erringen (oder zumindest so zu tun), war so gewichtig, dass sich die beschönigende Präsentation politischer Strategien irgendwann auch auf deren Entwicklung selbst auswirkte: Wenn sie sonst nichts tun konnten, ließen die Kaiser an ungewöhnlichen Standorten entlang der Grenzen Festungen errichten. Ob man zur Zeit von Valentinian und Valens wirklich noch mehr solcher Anlagen brauchte, dürfen wir getrost bezweifeln, doch sie waren ein gutes Propagandamittel. Mitunter zeitigte diese Praxis allerdings ganz unerwartete Ergebnisse. Einmal ließ Valentinian in einem Gebiet, in dem die Römer, so war vorher vereinbart worden, nichts bauen durften, Befestigungsanlagen errichten; das veranlasste die empörten ortsansässigen Alamannen dazu, einen blutigen Aufstand vom Zaun zu brechen. Schon zu Beginn seiner Regentschaft hatte sich Valentinian seinen Steuerzahlern als Barbarenschreck präsentieren wollen. Nun senkte er einseitig den Wert der alljährlichen Geschenke für die Könige der Alamannen. Diese nutzten die Geschenke jedoch ihrerseits dazu, daheim ihr Prestige zu steigern und die Netzwerke ihrer Unterstützer zu unterhalten. Das Resultat waren weitere wütende Alamannenproteste und noch mehr Schwierigkeiten an der Rheingrenze.
Manche meinen, das Römische Reich habe jeden einzelnen aufgezeichneten Konflikt mit den Alamannen in der späten Kaiserzeit selbst initiiert – die Kaiser hätten nun einmal ständig unter dem Druck gestanden, militärische Siege vorzuweisen. Meiner Ansicht nach geht diese Argumentation zu weit, denn sie spricht den Menschen jenseits der Grenze letztlich das Handlungsbewusstsein ab. Dennoch: Der innenpolitische Zwang, klare Siege zu erringen, wird sich doch hier und da auf die kaiserliche Außenpolitik ausgewirkt haben.40 Und eben jener Zwang veranlasste manche Kaiser sogar dazu, ihre Niederlagen zu vertuschen.
Im Spätsommer 363 wurde Kaiser Julian beim Versuch, seine Armee aus dem Territorium der Perser herauszuholen, in einem Scharmützel getötet. Wie der Bericht des Ammianus Marcellinus deutlich macht, war Julians Streitmacht, obgleich in taktischer Hinsicht ungeschlagen, in eine strategische Falle gelockt worden. Sein Nachfolger Jovian sah sich gezwungen, einen geradezu demütigenden Friedensvertrag zu schließen: Die Perser erhielten die römische Regionalhauptstadt Nisibis sowie eine Reihe von Gebieten östlich des Tigris. Die naheliegende Option in puncto Propaganda wäre gewesen, diese Niederlage Julians unvorsichtigem Verhalten anzulasten – so wie es auch heute noch die meisten Regierungen tun, wenn sie für jedes aktuelle Problem ihre Vorgänger verantwortlich machen. Einer der Gründe, warum ich das britische Finanz- und Wirtschaftsministerium verließ und mich der Wissenschaft zuwandte, war die alberne offizielle Vorgabe, auf Fragen der Presse mit dem Satz zu antworten: »Ja, aber unter der letzten Regierung war die Situation noch viel schlimmer.« Doch sowohl die Münzen, die Jovian prägen ließ, als auch eine Rede, die er bei Themistios in Auftrag gab, machen deutlich, dass sich das neue Regime für eine viel unbequemere Option entschieden hatte: Man behauptete, die erniedrigenden Klauseln des Friedensvertrags seien für die Römer in Wirklichkeit ein Sieg. Niemand glaubte das, insbesondere als das Römische Reich den Persern dann wirklich Nisibis und viele weitere Territorien im Osten überlassen musste, doch das war auch gar nicht der Punkt: Der ideologische und politische Imperativ, siegreich zu sein, war so gewaltig, dass kein römischer Kaiser eine militärische Niederlage eingestehen durfte – nicht einmal dann, wenn er noch ganz am Anfang seiner Herrschaft stand und sie noch ganz plausibel seinem Vorgänger hätte anlasten können. Vor allem aber durfte man keine so gewaltige Niederlage gegen den Erzfeind der Römer eingestehen.41