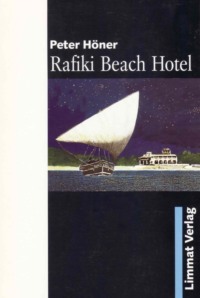Kitabı oku: «Rafiki Beach Hotel», sayfa 2
Die Polizeibeamten, die die Leiche der ertrunken Weissen quer durch die Stadt zum alten Spital brachten, werden dort nicht gern gesehen. Der Chefarzt, der von Tetu informiert wurde, versuchte, die Annahme zu verweigern. Aus Platzgründen. Schliesslich musste er aber einsehen, dass die Tote nicht irgendwo untergebracht werden kann, dass er ebenfalls dazu verpflichtet ist, die Todesursache festzustellen und den Tod der Frau zu bescheinigen. Etwas, das er unter normalen Umständen widerstandslos getan hätte, aber, wegen der herrschenden Verhältnisse, immer dazu benutzt, auf den katastrophalen Zustand des Spitals hinzuweisen, vor allem auf die Tatsache, dass der Spitalneubau, obwohl schon lange fertig, nicht bezogen werden kann. Er lässt die Beamten mit der Leiche warten,
«Tote haben Zeit, meine Kranken nicht»,
um erst kurz vor Feierabend zu schreien: «Die ertrunkene Frau Hornacker in den Operationssaal!»
ein Zynismus, der die biederen Beamten beleidigt, sie wissen nicht warum, aber trotzdem, handelt es sich doch um «ihre» Leiche, der man nicht mit der notwendigen Hochachtung begegnet. Tatsächlich trifft es aber zu, dass der Operationssaal der einzige, freie Raum ist, der, vorübergehend, als letzte Ruhestatt für eine Leiche dienen kann.
Der Eisverkäufer Ali Maiwa, von den Touristen wegen seines grossen Strohhutes «der Mexikaner» oder «Sombrero» genannt, betritt, kurz vor Dunkelheit, seine Hütte am Rand der Stadt. Er hängt seinen Hut an den dafür vorgesehenen Nagel über seiner Schlafstelle, schiebt seine Kühltasche, ohne die restlichen Eisbeutel herauszunehmen, in eine Ecke und zieht sich aus. Die aufgetauten Beutel wird er morgen in die Tiefkühltruhe eines Freundes legen und seine Tasche mit frisch gefrorenen füllen, um sie übermorgen, wenn sie wieder gefroren sind, wieder gegen aufgetaute einzutauschen. Ein Vorgehen, das nicht ausschliesst, dass immer wieder dieselben Beutel auftauen, wieder gefroren werden, auftauen, was aber dem wässrigen Inhalt kaum schaden kann. Nachdem Maiwa die wenigen Münzen und Scheine, die Tageseinnahmen, aus seinen Kleidern klaubte und, ohne sie zu zählen, in eine verbeulte Zigarrendose warf, zieht er unter seiner Matratze eine Hose und ein Hemd hervor, die ihn in einen smarten, leicht schmierigen Schönling verwandeln, dessen Eleganz an einen Aushilfskellner oder Coiffeurgesellen erinnert, ein Eindruck, der durch eine Halskette und ein Wollmützchen allerdings wieder aufgehoben wird.
Aus einem schäbigen Schränkchen, das umständlich mit einer Kette und einem Vorhängeschloss gesichert ist, nimmt Maiwa ein Päckchen Zigaretten, getrocknete Bananenschalen, ein kleines, in Aluminiumfolie geschlagenes Stück Haschisch und ein paar Betelnüsse. Er legt alles auf ein auf dem Tisch ausgebreitetes Stück einer glattgestrichenen Plastiktüte, und, nachdem er sich vergewissert hat, dass die Türe geschlossen ist, setzt er sich an den Tisch, wo er konzentriert, im schwachen Licht einer Paraffinlampe, mit einem kleinen, scharfen Messer erst einen Teil der Bananenschale in feine Streifchen schneidet, danach den Tabak zweier Zigaretten über den Bananenstreifchen zerkrümelt, ein Stückchen des gepressten Haschischs abbricht und mit dem Messerschaft zerdrückt, schliesslich eine Betelnuss zu Pulver schabt, um abschliessend die Ingredienzen seiner Rauschgifte zu mischen, zu kneten und die Masse, in die er auch mehrmals hinein gespuckt hat, zu kleinen, marmelgrossen Bällchen zu formen, die er, alle einzeln, in kleine Fetzchen Aluminiumfolie gewickelt, in den Taschen seiner Hose verschwinden lässt. Nachdem er alles, was noch auf dem Tisch liegt, wieder sorgfältig ins Schränkchen zurückgeräumt hat, das er erneut mit dem Vorhängeschloss sichert, löscht er die Lampe und verlässt seine Hütte.
Am Haus seiner Mutter vorbeischlendernd, erreicht er die abendlich belebte Hauptgasse, wo er sich unter die Leute mischt, um unauffällig nach möglichen Käufern für seine Kügelchen zu schauen. Seine Verkaufstaktik ist einfach. Nachdem er sich für einen Kunden entschieden hat, verwickelt er ihn geschickt und liebenswürdig in ein Gespräch, um ihm, hat er ihn erst einmal an der Angel, mit seinem Angebot zu überraschen, das dieser, ohne ihn zu beleidigen, kaum noch auszuschlagen wagt.
Nach ein paar missglückten Versuchen setzt sich Ali zu seinen Freunden in einer Teestube.
«Es heisst: Lady Gertrud sei ertrunken, die Sugarmama von‹Jambo›. Gestern Nacht. Der alte Kamani hat die Leiche gefunden, heute Morgen, am Strand, als er mit seinen Eseln draussen war. – Ich Maiwa, ich glaub das nicht.»
Mettler sitzt im Restaurant des Hotels «Baobab Inn» und wartet auf sein Nachtessen. Obwohl das Hotel um diese Jahreszeit nur schwach belegt ist, sind die meisten Tische im Speisesaal besetzt. Mettler, der sich in fremden Lokalen nie auf Anhieb wohl fühlt, selbst dann nicht, wenn es ihm gelingt sich einen Ecktisch zu erobern, stört sich sowohl an der kühlen, entfernt an einen Wartesaal eines Provinzbahnhofs erinnernden, Atmosphäre als auch an der Servilität der vielen Kellner, die ihn zwar nicht bedienen, das heisst, ihm weder das bestellte Essen noch das gewünschte Bier bringen, sondern ihn, der sich vorgenommen hat, ein bisschen in die Akten seines Auftrags zu schauen, belästigen, indem sie sein Gedeck verändern, die Gläser auswechseln oder umständlich eine Blumenvase gegen einen Kerzenständer austauschen.
Neben Mettler hat ein deutsches Ehepaar Platz genommen, beide um die Vierzig, schlanke Leute, die – ihr Kind zwischen sich – einander leise die Speisekarte vorlesen. Ihre Kommentare lassen Mettler vermuten, dass ihnen die fremden Gerichte nicht geheuer sind. Einerseits weil sie die phantasievollen Bezeichnungen nicht verstehen, andrerseits weil sie unter den vielen Fischgerichten kaum etwas entdecken, das ihren Essgewohnheiten, vor allem im Hinblick auf das Essen für das Kind, entspricht. In der Mitte des Raumes haben sich zwei Paare niedergelassen, die sich in Englisch, das aber nicht ihre Muttersprache zu sein scheint, erzählen, was sie bereits alles gesehen und erlebt haben, nicht nur hier in Lamu, sondern in Kenia überhaupt. Sie scheinen sich gegenseitig beweisen zu wollen, wer von ihnen das Land besser kennt. Offenbar leben sie schon ziemlich lange hier, was eine der Frauen dazu veranlasst, fast ein bisschen theatralisch, auszurufen: «Wir sind doch unerwünscht!»
Eine Bemerkung, von der Mettler nicht genau weiss, ob sie ganz allgemein zu verstehen ist, oder sich auf die lange Wartezeit bezieht. Aus einer der entfernteren Ecken schallt fröhliches Gelächter, laut und störend, offensichtlich glaubt jemand, vielleicht ein Reiseleiter, er müsste die Wartezeit für die ihm anvertrauten Touristen mit Anekdoten überbrücken. Mettler, der die Geschichten nicht versteht, den nur das salvenartige Gelächter immer wieder von seiner Lektüre aufschauen lässt, schüttelt halb verärgert, halb belustigt den Kopf: «Immer diese Italiener.»
In die gegenüberliegende Ecke gequetscht, hocken zwei Männer, ein dicker Koloss, der Mettler den Rücken zukehrt und ein blasser, schnauzbärtiger Mann, der trotz seiner grauen Haare, noch ziemlich jung aussieht und den Mettler für einen Architekten oder Entwicklungshelfer hält. Der Mann erwidert Mettlers Gesten mit einem zustimmenden Schmunzeln, was den Koloss, mit dem er in ein Gespräch vertieft ist, dazu veranlasst, sich ebenfalls nach Mettler umzudrehen und diesem, ohne zu wissen warum, freundlich zuzunicken. Mettlers Aktenbündel enthält neben der Beschreibung seines Auftrags, einem Lebenslauf der verwitweten Gertrud Hornacker, geborenen Lang, ein paar Fotografien Gertruds, einer Karte Kenias und einem halben Dutzend Quittungen und Notizen, vor allem einen leeren Schreibblock. Mehr aus Langeweile, denn aus wirklichem Interesse liest Mettler in seinen Notizen: «Unattraktive Frau zwischen fünfundzwanzig und dreissig, verheiratet, kinderlos. Auf G.H. eifersüchtig. (Warum?) Erbverzichtsvertrag, Wunsch des Vaters, nicht unterzeichnet. ... Über Tochter von G.H.»
Seinen Auftrag hat er ebenfalls auf einem Zettel festgehalten: «Gertrud Hornacker, die vor einem Monat nach Lamu reiste, allerdings nicht zum ersten Mal, nachfliegen, um die etwas über fünfzigjährige Witwe zu beobachten, die von ihren Kindern, vor allem der Tochter, verdächtigt wird, das Familienvermögen in leichtfertiger Weise zu verschleudern.»
Auf einem weiteren Papierschnitzel hat er sich den Verdacht der Tochter aufgeschrieben: «Die Mutter hat in Lamu einen Liebhaber.»
Mettler erinnert sich nur sehr ungern an das Gespräch mit der Tochter: «...und dass das klar ist, Diskretion. Diskretion. Nie darf ‹Mam› erfahren, dass wir ihr einen Privatdetektiv ... um Gottes Willen! Ein Skandal ...»
Ein Kellner führt einen weiteren Gast herein und bittet ihn, nicht ohne Mettler zu fragen, sich an dessen Tisch zu setzen. Leider zeigt es sich sehr schnell, dass der ältere Herr, der sich als Raffaele Di Polluzzi vorstellt, ein Schwätzer ist, und Schwätzern ist der wortkarge Mettler mehr oder weniger hilflos ausgeliefert.
Nachdem Di Polluzzi erst einmal sämtliche Menüs der Speisekarte laut durchgelesen hat, beginnt er das Kind am Nachbartisch zu necken. Er treibt Faxen, die die Kleine, oder ist es ein Junge, zum Lachen bringen sollen, schreit «Uhuu» und «Cucù», was das Kind verunsichert, so dass es zu weinen beginnt, ein Umstand, der den Eltern peinlich ist. Sie bemühen sich, die Grimassen Polluzzis lustig zu finden, in der Hoffnung, ihre gespielte Heiterkeit werde das Kind beruhigen, worauf das Kind laut zu schreien anfängt, bis die Mutter schliesslich entschieden aufsteht, das Kind vom Stuhl zerrt und mit ihm hinausgeht, nicht ohne eine wütende Bemerkung zu ihrem Mann zu machen, der sich immer noch darum bemüht, über Polluzzis Scherze zu lachen und sich jetzt von Polluzzi in ein stupides, halb auf Deutsch, halb in Italienisch geführtes Gespräch über Bambini verwickeln lässt, das Polluzzi aber plötzlich abbricht, weil er eine Katze entdeckt, die er nun mit Gesäusel und Geschmatze an den Tisch lockt, ein mageres, hochbeiniges Tier, über dessen Eigenart er Mettler, der verzweifelt in seine Akten starrt, einen Vortrag hält, der schliesslich Ausgangspunkt für eine Beurteilung Lamus wird, das er vor der Unabhängigkeit Kenias schon einmal besucht hat.
«Oh, was war Lamu für ein Kleinod, wie freundlich waren diese Leute. Und heute? Ein stinkendes, korruptes Nest. Schuld sind die Neger aus dem Landesinnern. Kikuyus. Überall machen sie sich breit. Nur weil Kenias erster Präsident ...», und er schlägt die Hände zusammen, «Geschichten, mein Herr! Geschichten!»
Auch während des Essens, das nun endlich serviert wird und das Mettler schmeckt, zu dem er sich ein zweites Bier bestellt, das er allerdings nie erhält, schwatzt Di Polluzzi fast pausenlos. Erst ist das Essen völlig missraten, da alle Gerichte mit Kardamom gewürzt sind.
«Was für eine Barbarenküche!»
Dann meckert er an den Kellnern herum oder belästigt Mettler mit einer abstrusen Geschichte über eine weisse Frau, die ertrunken sei, so werde erzählt, wenn er dies auch nicht glaube, denn die Frau sei eine gute Schwimmerin gewesen, viel wahrscheinlicher sei, dass die Frau mit einem der fürchterlichen Rauschgifte, die einem hier ja bald an jeder Hausecke angeboten würden, vergiftet worden sei.
«Vielleicht hat man sie auch kaltblütig ermordet. Man muss ja nur die Zeitungen lesen. Diese Brutalität. – 5o Frauen und Kinder von Viehdieben massakriert, drei Frauen mit Panga erschlagen, ... Jeden Tag. – Aber was zählt ein Mensch für diese Leute? Nichts. Ein Menschenleben? Nichts»
Als dann auch noch ein alter Mann mehrere Siwas, mit vielen Schnitzereien verzierte Holzhörner, zum Verkauf auf ihrem eh kleinen Tisch ausbreitet, um eines der Hörner an den Mund zu pressen und dem Instrument seltsame Brunstrufe zu entlocken, die er mit merkwürdigen Sprüngen begleitet, weiss sich Mettler, dem die Situation auf den Magen schlägt, nicht mehr zu helfen. Er kauft dem Alten eines seiner Krummhörner ab, bezahlt und verlässt den verdutzten Polluzzi, um, immer noch hungrig und durstig, eine Siwa unter dem Arm, was soll er damit, so schnell als möglich zurück in sein Quartier zu flüchten.
Der Eseltreiber Hamischi Kamani bindet seine Esel fest. Er schätzt die paar Minuten, die er bei seinen Eseln steht, bevor er sich zu seiner Familie legt, die um diese Zeit längst in die wenigen Betten geschlüpft ist. Er denkt über die letzten Tage nach, träumt in die Zukunft oder setzt sich noch zu einem Nachbarn, den er bei seinen Eseln im Schatten des Mangobaumes hocken sieht. Man wechselt ein paar Worte, spricht über die Arbeit, die Familie, Feste oder schweigt, schaut in den afrikanischen Sternenhimmel, lauscht den Geräuschen des nahen Wassers, das an die Kaimauer klatscht oder den Klängen eines Radios, das aus der nahen Stadt durch die Nacht plärrt.
In letzter Zeit jedoch wird er immer öfters von Fragen gequält, die sich nicht verdrängen lassen. Wie lange wohl wird er mit seinen Eseln noch ein Auskommen finden, von dem seine Familie lebt, seine Kinder zur Schule gehen, sie alle genügend Kleider und zu essen haben? Viele Leute sagen, Lamu dürfe sich nicht länger dem Fortschritt verschliessen, es müsse endlich eine Brücke zum Festland gebaut werden. Eine Autofähre! Wenigstens eine Autofähre. Eine Fähre zwischen Lamu und Mokowe. Aber sind die Autos erst einmal da, dauert es nicht lange, bis der Sand, den er und viele andere mit ihren Eseln auf die Bauplätze bringen, mit Lastwagen transportiert wird, ihm und seinen Kollegen bleibt die mühsame Arbeit des Sandschaufelns, wenn nicht auch dafür eine Maschine eingesetzt wird. Zwar wurden alle Vorschläge bis jetzt immer wieder abgewehrt, doch was rund um die Inseln wirklich geschieht, wissen sie alle nicht. Die Annahme des Entwicklungshilfeprojekts der Israelis, eine Fahrrinne für hochseetaugliche Schiffe bis zur Busstation Mokowe auszubaggern, wird letztlich ähnliche Folgen für die Insel haben.
Der Fortschritt wird seinen Einzug halten.
Die hellbeleuchteten Baggerschiffe, die Tag und Nacht zwischen den Inseln wühlen, die vielen unnötigen Lichter, aber auch die Touristen, die, jedes Jahr mehr, die Inseln besuchen, sind für Hamischi nichts anderes als Zeichen für Lamus Untergang.
Nur mit Abscheu erinnert er sich an die Zeit vor rund zwanzig Jahren, als die ersten Horden langhaariger und schmuddeliger Jugendlicher aus Europa in Lamu ankamen, die, kaum vorstellbar, die Kinder der einstigen Kolonialherren sein wollten. Überall in der Stadt rollten sie ihre Schlafsäcke aus, lagen nackt am Strand, wälzten sich im Sand, schliefen miteinander und berührten sich vor seinen Augen, dass er, der damals wie heute, mit seinen Eseln Bausand aus der Bucht in die Stadt transportierte, sich für die Weissen schämte. Die Schamlosigkeit der Fremden verdirbt Lamus Jugend, vor allem die Männer, die die weissen Frauen umschwirren wie die Fliegen den Scheissdreck. Auch sein einziger Sohn hat nichts anderes im Kopf als eine der oft älteren Damen zu erobern, von der er sich Reichtümer dafür versprechen lässt, dass er mit ihr ins Bett geht. Widerlich, ein Mann, der sich an eine Frau verkauft. Welches anständige Mädchen wird seinen Sohn noch heiraten wollen? Er wird ohne Enkel bleiben. Ein Gedanke, der Hamischi das Herz schwer macht. Die Vorstellung, nicht als Grossvater zu sterben, erschreckt ihn fast noch mehr als die Vision einer von Autolärm und Gestank erfüllten Insel.
In seinem Zimmer des «Kwaheri Guesthouse» legt sich Mettler sofort ins Bett. Es geht ihm gar nicht gut. Trotz der Hitze fällt er in einen ungesunden, dumpfen Schlaf, aus dem er mitten in der Nacht mit dem dummen Gefühl, nicht mehr zu wissen, wo er ist, hochschreckt. Sein Zustand hat sich verschlechtert und, sich mühsam aus seinem Moskitonetz schälend, schwankt er im Dunkeln auf die Toilette und erbricht sich fürchterlich.
L A M U : Dienstag, den fünften April ...
Trotz einer leichten Brise ist es auf der Hotelterrasse des Strandhotels «Rafiki» in Shela morgens um acht schon so heiss, dass die Hotelgäste es vorziehen, im kühleren Innenhof des Hotels zu frühstücken, wenn sie nicht noch in ihren Betten liegen. Zwei Angestellte des Hotels sind damit beschäftigt, die leeren Bierkisten in ein Motorboot zu schleppen. Das Geschepper der leeren Flaschen in den Kästen stört die morgendliche Ruhe, so dass der Hotelmanager auf der Terrasse erscheint und seinen Angestellten mit einen kurzen Pfiff zu verstehen gibt, sie sollten bitte leiser sein.
Der junge Belgier ärgert sich. Er glaubt zu wissen, dass sie ein gutes Arbeitsklima haben, die Kompetenzen sind klar, ihre Löhne anständig. Umso weniger versteht er, warum solche Kleinigkeiten, die er den Leuten schon hundertmal gesagt hat, nicht befolgt werden. Vor allem da er und seine Frau sich bemühen, nicht die Unerreichbaren zu spielen. Im Gegenteil, sie pflegen mit den Angestellten ein geradezu kameradschaftliches Verhältnis. Aber das «Rafiki» ist ein Hotel. Die Gäste sind hier, um sich zu erholen. Seine Frau und er, aber auch seine Angestellten, haben sich nach den Wünschen der Kunden zu richten und nicht umgekehrt.
Der junge Mann, dessen Kleidung in keiner Weise den Direktor verrät, der mit seinem Kikoi um die Hüften wie einer seiner Gäste aussieht, will ins Hotel zurück, als sich von Lamu mit grosser Geschwindigkeit ein Boot nähert, das Polizeiboot, das direkt auf den Strand vor dem Hotel zuhält. Noch bevor es aufläuft, springt ein Mann heraus, das Boot wendet und schiesst mit laut aufheulendem Motor wieder ins offene Wasser. Der Polizeiassistent Mwasi eilt mit nassen Hosenstössen, die Schuhe in der Hand, auf den Hotelmanager zu, den er schon von weitem erkannt hat und streckt diesem eine amtliche Verfügung entgegen.
«Eine Routineangelegenheit. Eigentlich müssten wir das jedes Jahr machen, aber ... Es sind ja keine Klagen laut geworden, nur: Nach dem gestrigen Badeunfall, Sie verstehen. Man weiss nie, plötzlich steht einer von Nairobi da. Schliesslich ist die Tote eine Weisse, da ist immer alles anders.»
Der Hotelmanager, der Mwasi kennt, erinnert sich nur ungern an den übereifrigen Beamten. – Das letzte Mal, eine Diebstahlgeschichte, wurde er anschliessend gezwungen, am Strand alle hundert Meter ein Schild aufzustellen, das vor Stranddieben warnt.
«When swimming guard property against thieves.»
Eine Einrichtung, die dem Ruf des Hotels, das ohnehin nicht als Tugendburg gilt, sehr geschadet hat. Die Papiere, die Mwasi dem Hotelmanager überreicht, betreffen die Kontrolle von Vorschriften, die zur Geschichte des Hotels gehören.
Das Hotel wurde vor gut zwanzig Jahren gebaut. In den ersten Jahren nach der Unabhängigkeit Kenias musste das Hotel immer wieder für längere Zeit geschlossen werden, weil keine Gäste kamen, die wenigen Gebäude zerfielen, und dem Hotel drohte dasselbe Schicksal wie der gesamten Insel. Die Inselstadt, bald einmal nur noch von Alten und Frauen bewohnt, zerfiel zur Geisterstadt. Der einstige Reichtum und die blühende Wirtschaft wurden zur Legende und das malerische Fischerdorf Shela, kaum noch bewohnt, schien ein Opfer der Sanddünen zu werden. In den späten Sechzigerjahren wurde Lamu dann von den Hippies entdeckt, die auf der Flucht vor ihren Vätern vom friedlichen Leben auf unberührten Inseln träumten. Zwar wehrten sich die Bewohner Lamus gegen die ungebetenen Gäste, die sich in den verlassenen Häusern der Stadt einquartierten, die die anfängliche Gastfreundschaft der Leute von Lamu ausnützten und sich über die Sitten und Moral ihrer Gastgeber hinwegsetzten. Doch erst eine Reihe von Verordnungen der Stadtverwaltung – das Schlafen in den besetzten Häusern, Nacktbaden und das Campieren am Strand sind verboten – vertrieb die Blumenkinder wieder. Trotzdem gilt Lamu bis heute als Geheimtipp für junge Leute, wo sich für wenig Geld Ferien machen lassen. Von dieser Entwicklung profitierte lange Zeit das einzige Hotel auf Lamu, das «Rafiki». Viele der ehemaligen Hippies kehren als arrivierte Leute nach Lamu zurück, und da es die damalige Hoteldirektion verstand, die Enttäuschung der Jugendlichen wenigstens teilweise aufzufangen, gehören Ferien im «Rafiki» für Ehemalige durchaus zum guten Ton.
Diesem, wenn auch geschäftlich verbrämten, Verständnis verdankt das Hotel die sogenannten Sicherheitsvorschriften, die Mwasi nun überprüfen soll. Es sind dies einerseits Bestimmungen, die allgemeinen Gesichtspunkten entsprechen, wie die Kontrolle eines Rettungsrings, die Sicherheit der Ufermauern und so weiter, anderseits erinnern sie an die Zeit vor zwanzig Jahren, wie zum Beispiel das Campingverbot auf dem Hotelareal. Mwasi, der sich wichtig an seine Untersuchungen macht, hat denn auch nichts zu bemängeln, obwohl er an allem herummäkelt und immer wieder ein bedenkliches Gesicht macht.
«Das Geländer rings um die Terrasse ist zu wackelig und zu niedrig. Es könnte jemand ins Meer fallen, das bei Flut an die Hotelmauer klatscht. Der Kasten, in dem der Rettungsring aufbewahrt wird, muss besser signalisiert werden. Und, bitte, schauen Sie sich den Bootssteg an. Kriminell!»
Ein Vorwurf, den der Manager nicht auf sich sitzen lassen kann: «Der Bootssteg ist nicht Eigentum des Hotels. Vor Jahren habe ich, als Direktor und Manager, die Distriktverwaltung gebeten, den Bootssteg zu reparieren. Bitte, kommen Sie mir nicht mit Dingen, die mit ihrem Papier nichts zu tun haben.»
«Der Bootssteg ist eine Gefahr für Ihre Gäste, für die Sie verantwortlich sind, nicht die Stadtverwaltung. Unsere Leute sind doch auf einen Bootssteg gar nicht angewiesen. Ihre Gäste bekommen nasse Schuhe, wir...» Mwasi lacht, zeigt seine nackten Beine. «Wir sind nasse Füsse gewohnt. – Aber seit gestern, seit wir eine Tote, eine Badetote, haben ...»
«Die Frau ist kein Gast des ‹Rafiki›. Was hat das mit dem Bootssteg zu tun?»
«Ist es etwa keine Weisse?»
Gegen die Logik eines kenianischen Polizisten kommt der Hotelmanager nicht an. Kopfschüttelnd gibt er zu verstehen, dass er Mwasis Argumentation begriffen habe, noch eh dieser seine Gedankenkette ausgebreitet hat.
Er ist froh, dass eines der schwerfälligen Motorboote, ein Busbetrieb zwischen den Inseln und dem Festland, um die Ecke biegt und auf die Überreste eines zu dreiviertel zerstörten, eben des von Mwasi kritisierten Bootsstegs zusteuert. Der einzige Passagier, ein älterer, rundlicher Herr mit Halbglatze, versucht auf alle Arten, aus dem Boot zu klettern, vorwärts, rückwärts, bis er schliesslich vom Kapitän in die Arme genommen und auf den Steg gesetzt wird. Der Hotelmanager und Mwasi amüsieren sich über die Ungeschicklichkeit des kleinen Dicken, bis sich herausstellt, dass das Männchen mit Sack und Pack, mit Koffern und Taschen ins «Rafiki» will und nach dem Hoteldirektor schreit.
Mein Gott, was für eine Nacht! Irgendwann hörte Mettler auf, den Wechsel von Erbrechen und Durchfall zu zählen. Gleich am ersten Tag hat er sich die Scheisserei geholt. Gegen Morgen, die Muezzins riefen bereits zum Gebet, nachdem er bestimmt ein halbes Dutzend «Baktrisolidin» geschluckt hatte, beruhigte sich sein Gedärm, so dass er sogar ein bisschen schlafen konnte.
Jetzt sitzt er mitgenommen und allein in der Frühstückshalle, es ist bereits nach Zehn, die Frühstückszeit vorbei. Simon, der Mettler in einem kaum zu ertragenden Wortschwall mit den Frühstücksgepflogenheiten des Gasthauses vertraut machte, liess sich dann wenigstens dazu bewegen, Mettler einen Tee aufzugiessen, den er in kleinen Schlückchen trinkt, immer in Sorge, jeden Moment wieder auf Toilette zu müssen. Sein Hemd klebt am Körper, er spürt, wie sich in seinen Bauchfalten die vielen kleinen Schweissbäche sammeln, die überall an ihm herunterrinnen, entsetzlich, und das alles... – Ja. Warum eigentlich?
Mettler hat seine Akten auf dem Frühstückstisch ausgebreitet. Er hofft, seinen Fall so schnell als möglich erledigen und Lamu wieder verlassen zu können. Was will er hier? Hat er geglaubt, in ein Paradies zurückzukehren? Seine Jugend wieder zu finden?
Ein paar Bilder von Gertrud schiessen, möglichst wie sie in den Armen ihres schwarzen Freundes liegt oder Hand in Hand den Strand entlang schlendert. Das wird den Verwandten in der Schweiz, der Tochter, genügen, er bekommt sein Geld, und was die Leute mit den Fotos machen, ist nicht seine Sache.
Trotz seines Ärgers, der Wut über seine Arbeit, die Mettler in letzter Zeit immer öfters überfällt, bleibt er seinen Arbeitsprinzipien treu: Diskretion nach Aussen, Sorgfalt im Detail. In wenigen Stichworten, die er aus losen Notizen sammelt, skizziert er, was er über Gertrud Hornacker und ihre Familie weiss.