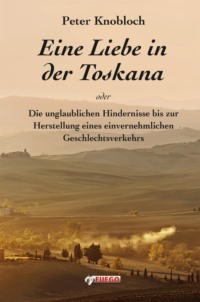Kitabı oku: «Eine Liebe in der Toskana»
Peter Knobloch
Eine Liebe in der Toscana
oder
Die unglaublichen Hindernisse bis zur Herstellung eines einvernehmlichen Geschlechtsverkehrs
– Ein Tatsachenroman –
FUEGO
– Über dieses Buch –
Der fünfzigjährige Familienvater und Ich-Erzähler führt ein geordnetes Leben, als ein Sprachkurs in der Toskana plötzlich alles verändert. Er verliebt sich in seine Italienisch-Lehrerin. Von zu viel toskanischer Sonne und südlicher Sinnlichkeit schon bald nicht mehr ganz richtig im Kopf, hofiert er die Schöne und stolpert dabei von einer Peinlichkeit zur Nächsten. Doch trotz aller Körbe, die er sich einholt, schmiedet er immer tollkühnere Pläne, um endlich die Gunst der Angebeteten zu erwerben. Und je mehr er um sie buhlt, desto mehr verliert er sich im mediterranen Strudel von praller Lebenslust und wundersamen Katholizismus.
Mit viel Selbstironie erzählt Peter Knobloch in seinem ersten Roman eine turbulente Liebesgeschichte vor dem Hintergrund des für uns so rätselhaften, aber deshalb nicht minder faszinierenden Landes südlich der Alpen. Und es gelingt ihm, diesem Evergreen noch viele neue Facetten abzugewinnen.
I
»Die meisten Touristen werden, sobald sie italienischen Boden betreten, von einer milden Form des Wahnsinns befallen.«
Luigi Barzini, »Die Italiener«
Franca
»Die Situation ist da!«, konstatierte der alte Adenauer immer dann, wenn eine lange befürchtete Lage eingetreten war.
Ich saß wie betäubt auf dem Bettrand in dieser schäbigen Pension. Ja, die Situation war da.
Draußen war ein schöner Frühlingstag. Familien machten ihre Sonntagsspaziergänge. Nein, ich konnte nicht ins Freie gehen. Sie würden mich erkennen, über mich tuscheln oder gar mit dem Finger auf mich zeigen. Aber das hat man davon, wenn man in einem Drecksnest wie Sollnstein lebt. Ein schöner Skandal war das, und vielen, auch erstaunlich vielen Freunden, war es eine Genugtuung, mich so tief fallen zu sehen.
Mir fehlte alles. Meine Kinder, mein Haus, mein Garten, und – ja, und auch meine Frau. Kein Wunder, nach über fünfundzwanzig gemeinsamen Jahren. Aber Gott hat einen harten linken Haken, da hatte Peter Fox schon recht.
Und schuld an dieser Situation war Rainer Maria Rilke, dieser Blindfisch. Der und dieses verdammte Land im Süden, dessen vermeintliche Sinnlichkeit mich zum kompletten Vollidioten gemacht hatte. Dieses verdammte Land, das in Wirklichkeit doch keinen Schuss Pulver wert war. Genauso wenig wie die Ratschläge von diesem dämlichen Rilke.
Was war das eigentlich? Es fühlte sich so unecht an. Gar nicht wie eine Situation, mehr wie ein schlechter Traum. Und wie lange würde ich das noch aushalten? Zwei Stunden? Zwei Tage? –
Egal, ich musste nach vorne sehen. Lebbe geht weiter, wie ein serbisch-hessischer Fußballtrainer immer sagte. Nicht unterkriegen lassen, Mund abputzen, Zähne zusammenbeißen! Ich musste einfach fest an mich glauben, dann würde ich auch diese Situation meistern. Ich kannte das Leben, ich war schließlich im Kino gewesen. Ich würde es noch allen zeigen!
Heute Abend hatte ich wenigstens einen Auftritt. Endlich etwas Ablenkung. Und ab morgen würde ich mich nach einer Wohnung umsehen. Ab morgen würde ich wieder ganz von vorne anfangen. Jetzt, mit meinen fünfzig Jahren.
Wo war eigentlich der ›point of no return‹ gewesen, der Moment, an dem ich umkehren, die Kreuzung, an der ich wenigstens die Richtung noch hätte ändern können?
Vor einem Monat? Vor einem Jahr?
Nein früher ...
November 2005
»Accomodati!«, sagte Franca und deutete auf den gedeckten Tisch. »La pasta è pronta!«
Das war einfach zu verstehen: ich solle mich setzen, denn die Nudeln seien fertig. Das ließ ich mir nicht zweimal sagen. Ich war den ganzen Tag mit dem Auto unterwegs gewesen und hatte am Morgen nicht einmal richtig gefrühstückt.
Sonst verstand ich kaum die Hälfte von dem was die alte Dame da alles auf mich einpalaverte. Ich hatte kapiert, dass sie Angela Merkel, die erst vor wenigen Wochen zur Bundeskanzlerin gewählt worden war, toll fand, und dass Signora Merkel überhaupt eine bella figura mache.
Ob Frau Merkel denn verheiratet sei, wollte sie wissen, die Frage brannte ihr ganz offensichtlich auf den Nägeln. Klaro, antwortete ich, meinte natürlich »chiaro«. Che bello, rief sie darauf erfreut und fragte, wie er denn aussehe, der Herr Merkel, der ja eigentlich Herr Sauer heißt. Er sei ein stattlicher signore mit einem barba, antwortete ich und spürte tatsächlich so etwas wie – das muss man sich mal vorstellen – Stolz auf unseren First Man. Was Herr Merkel, der ja eigentlich Herr Sauer heißt, beruflich mache, fragte sie, worauf ich antwortete, dass er ein professore sei. »Oh un professore, bravo«, rief sie begeistert und wollte gleich wissen, ob sie Kinder hätten. Nein, antwortete ich, worauf ihr Stimmungsbarometer wieder auf normale Werte sank. Aber es sei doch hoffentlich eine harmonische Ehe, fragte sie besorgt, wo doch Frau Merkel immer so viel unterwegs sein müsse, worauf ich sinngemäß sagte, dass sich dies meiner Kenntnis entziehe ...
Mein lieber Mann, es mag ja polyglotte Franzosen geben, alkoholabstinente Russen, ausgeflippte Schweizer und ausländerfreundliche Sachsen, aber es gibt anscheinend keine schweigsame Italienerin.
Ich hatte einen zweiwöchigen Sprachkurs in der Toskana mit Unterkunft bei einer italienischen Familie gebucht und ein bisschen Bammel davor gehabt, mich einfach so in das Leben fremder Menschen, deren Sprache ich zudem kaum spreche, zu begeben. Wirklich putzige Sorgen hatte ich damals noch, aber selbst die wurden von Francas epischem Redeschwall regelrecht hinweg gespült.
Nein, das ließ sich alles sehr gut an. Francas Redseligkeit war zwar ein bisschen anstrengend, aber gut für mein Italienisch, und deswegen war ich ja schließlich hier. Außerdem wollte ich ein paar private Studien betreiben, wollte zum Beispiel herausfinden, wie dieses Volk im Alltag, abseits von Strandliege und Luftmatratze, so tickt. Völkerkunde in Berluskonistan gewissermaßen, aber rein hobbymäßig versteht sich.
Aber der Reihe nach. Ich war mithilfe eines Stadtplans und ein paar Mal nachfragen vor zwanzig Minuten im ersten Stock eines Altbaus direkt an der Piazza von San Giovanni gelandet.
San Giovanni Valdarno, ein Städtchen in der Toskana mit siebzehntausend Einwohnern, vierzig Kilometer südlich von Florenz im – wie der Name »Valdarno« sagt – Arnotal gelegen.
Meine Unterkunft befand sich mitten im centro storico, in der Altstadt. Das war schon mal gut. Die Wohnküche, ein großer, hoher Raum mit Toskana-typischer Ziegeldecke und offenem Gebälk, betrat man direkt vom Treppenhaus aus. Es war das Herzstück der Wohnung, eingerichtet mit Jugendstilmöbeln und einem großen, prallgefüllten Bücherregal, deren zahlreiche Lexika – so sie nicht rein dekorativen Zwecken dienten – auf gebildete Bewohner schließen ließen. Ein Torbogen führte zu den anderen Räumen. Direkt vor dem Esstisch lief, auf einer Kommode postiert, der Fernseher.
»Meine Familie« bestand, wie sich herausstellte, nur aus Franca, einer alleinstehenden Frau, die ich auf Ende sechzig schätzte. Sie war eine schlanke, drahtige Dame, die zwar auf den ersten Blick mit ihren weißen, nach hinten geknoteten Haaren und ihrer Kittelschürze großmütterlich wirkte, dieses Bild aber mit modernen, weinroten Nike-Turnschuhen apart konterkarierte. Trotz ihres Alters bewegte sie sich erstaunlich behände und wurde sogar temperamentvoll jugendlich, sobald sie ihre Reden gestisch untermalte.
An den Wänden hingen gerahmte Schwarzweißfotos ihres verstorbenen Ehemannes, sowie eine ganze Reihe von Bildern, die ihre Tochter in verschiedenen Altersabschnitten zeigten.
Francas Kommunikationsfreudigkeit war gleich mal ein erster Härtetest für mein wackliges Italienisch. Sie kommentierte alles: das Wetter, die Weltpolitik und vor allem das laufende Fernsehprogramm.
Und der Fernseher lief immer.
»Deutschland ist ein schönes Land ...«, sagte sie, während sie einen großen Topf mit Penne und einer Zucchini-Pomodorini-Soße auf den Tisch stellte. »Das schöne Bayern, die Alpen, die Schlösser. Vor zwei Jahren habe ich an einer Busreise teilgenommen, sulla Romantische Straße.«
»Romantische Straße« kostete sie einige Mühe, das »st« sprach sie in plattdeutscher Manier, also buchstäblich aus.
»Die Reise ging von Neuschwanstein ...«, noch so ein Zungenbrecher, »... nach Francoforte, über Augsburgo, Dinkelbul...«, Dinkelsbühl, eine Gemeinheit für eine italienische Zunge, »... und Rothenburg. C’era meraviglosa!« Es war wundervoll.
Sie setzte sich mit an den Tisch, verspürte aber offenbar keinen großen Appetit, denn sie redete unentwegt weiter. Nach ein paar Anstandssekunden hielt ich es nicht mehr länger aus und fing schon mal zu essen an. – Die Nudeln schmeckten köstlich.
»Wir hatten hier im Sommer einen Europatag. Jedes Land hatte auf unserer Piazza seinen eigenen Stand, und rate mal, welcher Stand am beliebtesten war?«
»Mmpf?«
»Der deutsche Stand! Besonders unsere Jugend hatte ihn bis spät in die Nacht belagert, und ihr habt ja auch wirklich feine Sachen ...«, sie nahm die Gabel in die rechte Hand und begann bei angelegtem Ellbogen mit dem Essbesteck Luftkreise zu zeichnen, »das gute Bier, die Würstel, das Krauti, dann das gute Schwarzbrot, das es ja bei uns leider überhaupt nicht zu kaufen gibt, und der köstliche Apfelstrudel ...«
»Mmpf, Austria!«, brachte ich gerade noch heraus.
»Ach der kommt aus Österreich? Egal, ist ja sowieso dasselbe ...«
»Mmmpfff!!!!«
»Deutschland ist wirklich ein tolles Land. Und dann das Oktoberfest! Warst du schon mal auf dem Oktoberfest?«
Ich nickte.
»Schmeckt es dir?«
Ich nickte.
»Ah si, weißt du, was ich heute im Fernsehen gesehen habe?«
Ich zuckte mit den Schultern.
»Die neurenovierte Frauenkirche in Dresden. Die habt ihr wirklich toll wiederaufgebaut!« Sie legte die Gabel wieder beiseite und bildete mit Daumen und Zeigefinger ein »o«, »Perfetto! Und Frau Merkel war übrigens auch da«, strahlte sie. »Sie machte wie immer eine bella figura!«
Du lieber Gott, wenn ich ihr erzählen würde, was sich unsere Angela in ihrer Heimat schon alles wegen ihrer »bella figura« von totwitzigen Kabarettisten anhören musste ...
Franca nahm ihre Gabel wieder in die Hand, und ich dachte, es sei nun an der Zeit, auch mal was zur Unterhaltung beizusteuern, was aber arg wenig wertvoll geriet:
»Aber Berlusconi macht doch auch eine bella figura, oder nicht?«
Franca ließ die Gabel sinken und sah mich entgeistert an: »Ma sei pazzo (bist du verrückt)?«
Sie legte die Gabel beiseite und formte ihre Hand zu einem Ei, indem sie die Fingerspitzen zusammenpresste. Da war er, der C-Dur-Akkord der italienischen Gestiktonleiter, kleine Kinder lernen ihn noch vor dem Sprechen. Sie schüttelte den Unterarm heftig auf und ab: »Willst du mich veralbern? Berlusconi mit La Merkel zu vergleichen? Ma che dici tu (was redest du)?«
Sie öffnete die rechte Hand, als lasse sie eine Taube fliegen. »Berlusconi ist ein Hallodri, ein Betrüger, un cretino, un criminale! Mamma mia! Berlusconi und Signora Merkel, das sind doch Welten ...«
Sie schüttelte den Kopf, griff wieder zur Gabel und schien sich zu fragen, was für einen Idioten man ihr da nur diesmal ins Haus geschickt hatte. Dabei war ich doch nur neugierig. Silvio hatte in Deutschland eine derart verheerende Presse, da wollte ich einfach herausfinden, wo in diesem doch scheinbar zivilisierten Land seine Wähler steckten.
»Aber wer war denn in der italienischen Politik noch kein criminale?«, hielt ich dagegen, so schnell ließ ich mich nicht unterkriegen. »Andreotti vielleicht?«
Sie wackelte mit dem Kopf. »Auch wieder richtig, im Grunde sind sie alle mafiosi!«
Offenbar hatte sie keine große Lust, das Thema Politik weiter zu vertiefen, denn sie schwieg und fing nun tatsächlich zu essen an. Mein erster Versuch, in die Abgründe der italienischen Politik einzudringen, wurde abgeschmettert. Va bene! Ich würde dranbleiben.
Ihr Schweigen gab mir die Möglichkeit, meine Aufmerksamkeit den Abendnachrichten des staatlichen Senders RAI zu widmen, womit wir gleich wieder beim Thema waren, denn als Toppnachricht kam gerade ein Bericht über die aktuelle Regierungskrise. Eben genannter Berlusconi war nicht mehr, beziehungsweise noch nicht wieder Ministerpräsident und setzte dem Zwischendurchregierungschef Prodi und seiner mühsam zusammengehaltenen Linkskoalition mächtig zu. Schwarze Limousinen fuhren vor, und Politiker gaben vor Mikrofonwäldern wichtige Statements ab.
Die Tatsache, dass sich ihre Regierung in einer dramatischen Krise befand, stieß bei Franca auf totale Gleichgültigkeit. Das Thema war auch für die RAI schnell abgehakt, und man wechselte zu einem folkloristischen Beitrag aus Neapel.
Dieser begann damit, dass ein paar Carabinieri in ihren schönen Uniformen zusahen, wie Männer in weißen Overalls einen Blechsarg aus einem Haus trugen. Eine Reporterin sagte, dass man noch nichts Genaues wisse, und etwa zwei Dutzend Nachbarn teilten den Kameras mit, dass sie allesamt nichts mitgekriegt hätten, aber wahnsinnig betroffen seien. – Auch Franca schüttelte bekümmert den Kopf.
Als nächste Toppnachricht wurden Aufnahmen einer amerikanischen Überwachungskamera gezeigt, die eine Schießerei bei einem Tankstellenüberfall in Florida aufgezeichnet hatten. Danach kamen noch Angelina Jolie und Brad Pitt auf einem roten Teppich im Blitzlichtgewitter posierend und ein paar Fußballtore aus der Seria A.
Damit waren scheinbar die wichtigsten Ereignisse des Tages abgehandelt. Die abschließende Wettervorhersage wurde von einem Soldaten in einer blitzsauberen Uniform präsentiert. Ein feiner Max, dem hochdekorierten Gewande nach zu schließen mindestens ein Offizier, sagt das Wetter vorher. Gleich was anderes als unsere windigen Kachelmänner, dachte ich mir.
Von so viel Neuem und Aufregendem geplättet, äußerte ich bald den Wunsch, schlafen gehen zu wollen. Franca gab mir Handtücher und zeigte mir das Bad. Es war ein normales Badezimmer, wie man es überall auch in Deutschland hätte vorfinden können, bis auf eine Kleinigkeit: Das Bidet!
Sofort musste ich an den letztjährigen Skiausflug mit meiner Altherrenfußballmannschaft in die Dolomiten denken, wo einer meiner Sportkameraden diese Vorrichtung auf katastrophale Art und Weise missbraucht hatte. Gut, er war sturzbetrunken, aber ich gebe zu, dass auch ich den Sinn und Zweck des Sanitärstücks jahrelang nur erahnt hatte, auch wenn mir ein derartiges Malheur gottseidank nie passiert ist.
»Wenn du dich duschen willst«, instruierte mich Franca noch und zog zwei große Handtücher aus dem Badezimmerregal, »dann breite sie bitte immer vorher auf dem Boden aus, die Dusche ist nämlich undicht.« Und dann legte sie gleich nochmal richtig los:
»Dreimal hatte ich schon den Handwerker hier! Dreimal hatte er alles mit Silikon ausgespritzt, aber jedes Mal kam danach das Wasser aufs Neue! Es ist immer das Gleiche!«
Interessant. Sollte ich zufällig ein alles übertrumpfendes Argument für unseren deutschen Meisterbrief gefunden haben? Den gibt es hier nämlich nicht. Und Berlusconi hatte auch noch vor, in Italien Atomkraftwerke bauen zu lassen. Geht das überhaupt ohne Meisterbrief? Und wenn ja, was ist, wenn dann was leckt? Das ist aber dann nicht mit zwei Handtüchern abgetan. Und wer ist dann wieder der Dumme? Doch nur der deutsche Steuerzahler!
»... und bis überhaupt mal einer kommt ...«, riss sie mich aus meinen kühnen Gedankengängen. Sie schlug die Hände zusammen: »Letztes Mal habe ich vier Wochen gewartet, und als er endlich kam, war ich nicht zu Hause, und dann musste ich nochmals geschlagene zwei Wochen warten, und dann, dann hat er mir noch die Anfahrt vom ersten Mal verrechnet ...« Sie breitete die Arme wie eine Opernsängerin aus und zog gleichzeitig die Schultern nach oben, »ich frage mich, für was? Die Dusche ist nach wie vor undicht ...«
Sanft, und bemüht nicht unhöflich zu wirken, schloss ich ganz langsam die Tür.
»Buonanotte«, rief ich durch die halbgeschlossene Badezimmertür.
»Buonanotte«, antwortete sie.
Mir schwirrte der Kopf! Vor zweitausend Jahren hat dieses Volk für Seeschlachten mal schnell das ganze Kolosseum abgedichtet. Und jetzt sowas!
*
Ich wusch mich und ging auf mein Zimmer. Es war ein karges Kämmerlein mit einem Eisenbett, einem alten Bauernschrank, einem Stuhl und einem Tisch, auf dem ein kleines Fernsehgerät stand. Ich versuchte zu schlafen, was sich schnell als aussichtslos erwies. Total aufgekratzt lag ich da. Eine Flasche Wein wäre jetzt hilfreich gewesen, aber das hatte ich versäumt.
Da war das quietschende Bett, die vielen neuen Eindrücke, die ungewohnten Geräusche, die Stimmen, die von der Piazza heraufdrangen.
Nach einer Stunde stand ich auf, öffnete das Fenster und einen Flügel der dunkelgrünen Lamellenläden. Mein Zimmer lag auf der Rückseite des Palazzo.*1
Ich sah auf ein schmales Gässchen, das in die Piazza mündete. Es musste in letzter Zeit viel geregnet haben, die ganze Gasse hing voll mit Wäsche. Auch so ein Klassiker, der uns Deutsche immer wieder schwach macht. Und mich schon zweimal.
Ich ging zurück ins Bett, aber anstatt zu schlafen wälzte ich mich unruhig hin und her.
Warum war ich überhaupt hier? Reichte es nicht, wie jeder anständige deutsche Bildungsbürger im Sommer durch die Altstädte der Toskana zu stolpern? Musste es jetzt auch noch im November sein?
Ich dachte an meine Kinder, und mir fiel auf, dass ich noch nie länger als drei Tage von ihnen getrennt war. Und jetzt gleich für zwei Wochen ... ein lauter Knall! Ich schreckte hoch, ließ mich aber gleich wieder ins Kissen fallen. Idioten! In diesen engen Gassen entfalteten Chinaböller eine besonders effektive Wirkung. –
Wo war ich stehengeblieben? Ach ja, warum ich hier war. Also ich war hier, weil ich vor vier Wochen einen Zahnarzttermin hatte und im Wartezimmer nichts außer Klatschblätter und Autozeitschriften vorfand. Weil ich mich daraufhin auf einen Stuhl gesetzt hatte und in Ermangelung einer Zeitschrift auf die gegenüberliegende Wand starrte. Und weil an dieser Wand ein Kalender mit einem Kalenderspruch hing, den ich von meinem Stuhl aus lesen konnte:
»Du musst dein Leben ändern!«
Rainer Maria Rilke
Meinte der etwa mich? Irgendwie fühlte ich mich angesprochen. Du musst dein Leben ändern. Ja gut, aber wie? Sollte ich etwa meine politische Gesinnung ändern? Nein, nicht schon wieder. Mein Outfit? Schon eher. Auf beiden Gebieten hatte ich ja schon erstaunliche Wandlungen vollzogen. Vom anarchistischen Posthippie zum wertkonservativen Familienvater, mehr ändern geht doch gar nicht.
So richtig fiel mir nichts ein, was ich ändern konnte. Weniger essen wäre nicht verkehrt, auch weniger Alkohol. Du musst Dein Leben ändern. Ich war zwar momentan nicht gut drauf, aber im Prinzip war mein Leben doch in Ordnung, oder? Du musst Dein Leben ändern. Der Satz ließ mich erst wieder los, als der Zahnarzt den Rosenbohrer auf meinen Backenzahn setzte.
Von außen betrachtet war mein Leben wirklich in Ordnung. Ich war – wie man so schön sagt – gesettled. Verheiratet, Kinder, sicheres Einkommen.
Es hatte einige Zeit gedauert, bis ich alles auf die Reihe gebracht hatte. Zwölf Jahre plätscherte meine Beziehung mit Gerlinde ziellos und unverbindlich vor sich hin, bis wir irgendwann doch noch die Kurve gekriegt hatten und eine Familie gründeten.
Mittlerweile waren wir schon fast ein Vierteljahrhundert zusammen. Auch beruflich hatte es lange gedauert, bis ich endlich Boden unter den Füßen fand. Aber seit ein paar Jahren spielte ich in Edelrestaurants Kabarett, sogenannte Dinnershows. Das brachte zwar nicht viel Ruhm, aber dafür sicheres Geld, und nach vielen mageren Bühnenjahren nahm ich diese Form der Halbprostitution gerne in Kauf. Kurz: Es lief ganz gut für mich.
Im Sommer konnten wir uns sogar vier Wochen Urlaub leisten. Den verbrachten wir jedes Jahr im Cilento, etwa hundertzwanzig Kilometer südlich von Neapel.
Als die Kinder noch klein waren, hatten wir dort einen bilderbuchschönen Campingplatz direkt am Meer mit Sandstrand und kristallklarem Wasser entdeckt. Anfangs waren wir immer im September da. Wir waren jene cleveren Nachsaisonurlauber, die Wert auf einen möglichst leeren Strand und günstige Preise legten. Wir waren ja nicht so bescheuert wie die Italiener, die dem Wahn verfallen sind, nur im August ans Meer fahren zu können, weil dann der Strand so schön überfüllt ist und man so richtig abgezockt wird.
Das Verhängnis fing damit an, dass wir irgendwann zu früh angereist waren. Das heißt, die Italiener waren noch da. Dieses Treiben am Strand, das ständige Handygeklingel, der Eisverkäufer, der seinen markisenüberspannten Karren durch den Sand schob, die Hausfrauen bei der Wassergymnastik, die Herren, deren Spieltrieb so stark ausgeprägt war, dass sie selbst den dämlichsten Tricks der Animateure mit Begeisterung auf den Leim gingen. Ich war hin und weg.
Fasziniert beobachtete ich einen Animatore, der sich mit einer Handvoll Pasta an den Strand gestellt hatte und laut schrie: »Wie viele Spaghetti halte ich in meiner Hand?«
Mit diesem Quatsch hielt er eine stattliche Ansammlung von gesetzten Herren ein halbe Stunde lang bei bester Laune. Es wurde mit großen Gesten erörtert, geraten, diskutiert, gefachsimpelt, anfängliche Schätzungen verworfen und neue Theorien aufgestellt. Der Sieger wurde schließlich wie ein Weltmeister gefeiert, wobei auffiel, dass sie das alles nicht wirklich ernst nahmen, sondern einfach einen kindlichen Spaß am Herumblödeln hatten.
Abends die Kids, wie sie sich in Trauben durch die engen Gassen des Campeggios schoben. Giggelnde Gören und gockelnde Jungs. Und schon damals fiel mir auf: In Italien wird viel mehr geschmust als bei uns.
Ich war diesem Flair hoffnungslos erlegen, und auch Gerlinde fand Gefallen am »echten Italien«. Deprimiert sahen wir am Montag nach Ferragosto den leeren Strand vor uns.
Nur noch ein paar clevere Bayern und Schwaben, die die günstigen Nachsaisonpreise nutzten, fingen an, Sandburgen zu bauen.
In den darauffolgenden Jahren fuhren wir immer Anfang August in den Urlaub, zahlten ohne mit der Wimper zu zucken den doppelten Preis, fühlten uns aber in der hauptsächlich aus Neapel stammenden Italienerschar pudelwohl.
Wir schlossen Freundschaften und fingen an, ein bisschen Italienisch zu sprechen.
So vergingen die Jahre. Elf Monate wühlten wir uns durch den Alltag und im August hieß es, den Gürtel weiter schnallen, um einen ganzen Monat lang das süße Leben im Cilento zu genießen.
Die Kinder wuchsen heran, wurden selbst giggelnde Teenager, und alles hätte wunderbar so weitergehen können. –
Ging es aber nicht!
Gerlinde und ich hatten uns auseinandergelebt, daran führte kein Weg vorbei. Es war ein langer, anfangs kaum wahrnehmbarer Prozess. Lange Zeit überdeckte das tägliche Familienmanagement die tiefen Gräben, aber in letzter Zeit half auch alles managen nichts mehr. Wir stritten uns immer öfter.
Und da war auch noch Bernd, diese Kakerlake. Bernd ist Ingenieur und wie viele – wie ich heute finde, zu viele – Herren aus meinem dörflichen Bekanntenkreis im weiteren Sinne für die Automobilindustrie tätig. Normalerweise unterhielt er sich am liebsten über Getriebe und Kardanwellen, aber sobald Weibsvolk in der Nähe war, gab er sofort den bis zur Selbstverleugnung gehenden Frauenversteher ab. Er verstand sich auch mit allen Frauen fantastisch, außer mit seiner eigenen. Mit der führte er eine sogenannte moderne Ehe, was im Klartext heißt, sie war im Eimer.
Bernd, für Gerlinde Bernie, stravanzelte in letzter Zeit etwas viel um Gerlinde herum, machte ihr in schon penetranter Art und Weise Komplimente, und Gerlinde fühlte sich nicht nur geschmeichelt, schlimmer, sie fühlte sich verstanden! – O Weiber!
Der in Beziehungsfragen geschulte Leser hört nun die Alarmglocken läuten, und in der Tat, als Bernd in diesem August plötzlich auf unserem Campingplatz auftauchte, bekam der Spaß ein Loch. – Ich war stocksauer.
Kaum wieder zu Hause, erzählte Bernd allen, wie furchtbar eifersüchtig ich auf ihn gewesen sei, und wie daneben ich mich benommen hätte. Und Gerlinde gab dieser Arschtrompete auch noch Recht. Gut, ich war nicht besonders nett zu ihm, auch die Überdosis Peperoncini, die ich ihm in die Pasta gemischt hatte, war vielleicht nicht die feine Art, aber ich hatte ihn ja schließlich auch nicht eingeladen. Egal, jedenfalls wurden derlei Vorkommnisse von der Automobilistenclique begeistert aufgenommen. Zudem versorgte Gerlinde neuerdings die Gattinnen der Autoknechte zuverlässig mit unseren Ehe-Innereien, was bei den Autoweibern zu großer Dankbarkeit und bei mir zu einem dramatischen Autoritätsverlust führte.
Im September dann die totale Demütigung. Gerlinde fuhr mit den Autohühnern für eine Woche zum Segeln. – Mit Bernd als Skipper! Das konnte dieser Hundertsassa leider auch noch.
Na bravo!, dachte ich mir. Allein mit fünf Weibern auf hoher See, als Hahn im Korb, als Hecht im Karpfenteich, als Fuchs im Hühnerstall! Damit eröffneten sich dem perversen Autobüttel ja schier unvorstellbare Möglichkeiten. Und keiner weit und breit, der ihm in den Arm oder weiß Gott was hätte fallen können. Das war zu viel! Eine Woche lang saß ich machtlos zuhause, hütete brav das Haus und sah im Geiste meine Frau halbnackt, Bacardi-saufend vor diesem Jack-Sparrow-Verschnitt herumtanzen, und das war sicher nur das Vorspiel zu viel Schlimmerem.
Als Gerlinde zurückkehrte, hatte unser Verhältnis einen neuen Tiefpunkt erreicht. - Wir fingen an, uns aus dem Weg zu gehen.
Du musst Dein Leben ändern. In dieser seelisch unsortierten Lebensphase fiel der Rilke-Spruch natürlich auf fruchtbaren Boden. Die Schicksalsuhr tickte, und vor zwei Wochen, an Allerheiligen, stieß ich zufällig auf eine Webseite, die Sprachkurse in Italien anbot. Ich zögerte kurz, aber dann nahm ich meinen Kalender zur Hand, entdeckte zwölf freie Tage und buchte blindlings einen Kurs. Danach fühlte ich mich besser. Ich hatte vielleicht nicht gleich mein Leben, aber doch ein bisschen was verändert. Es war nur ein kleiner Schritt, aber immerhin.
Aber ob das so eine gute Idee war? Inzwischen hatte ich es fast schon wieder bereut. Und jetzt wollte ich endlich schlafen. Schließlich wartete mein erster Schultag seit dreißig Jahren auf mich.
Heiland, hätte ich gewusst, was außerdem noch auf mich wartete, wäre ich sofort aus dem Fenster gesprungen und nach Norden desertiert. Aber vielleicht war ich ja auch deshalb so unruhig, weil ich das nahende Unheil schon spürte, unbewusst, wie die Tiere, die merken auch schon vorher, wenn etwas im Busch ist. Die Schweine zum Beispiel, die riechen sofort Lunte wenn’s zum Schlachthof geht, oder die Hühner vor einem Erdbeben, völlig durch den Wind, andere wiederum sind bei Tsunamis ganz vorn, wittern die Welle um den halben Erdball. Da kann man als Mensch nur demütig den Hut ziehen und kleinlaut seinen Computer- und Seismographenkrimskrams einpacken.
Schlaf endlich, befahl ich mir, schlafe! Aber anstatt zu schlafen, flimmerten die fünfundzwanzig peinlichsten Augenblicke meines Lebens an mir vorüber.
Denk an was Schönes, denk an das Kopfballtor beim Altherrentraining vorgestern oder noch besser, denk an den letzten August am Meer, als Bernd noch nicht da war, und jeder Tag damit begann, dass ich anderthalb Kilometer zum Monte Tresino schwamm, zu jenem Hügel, der als Halbinsel ins Meer ragte, dessen grüne Pinien das alles beherrschende Blau von Wasser und Himmel durchbrachen und dessen Zykaden mir jeden Morgen ein lautes, aber doch so bezauberndes Ständchen zirpten. Ja, das war paradiesisch! Am Abend spielten wir Volleyball am Strand, während gleichzeitig die rote Sonne bei Capri im Meer versank. An klaren Tagen sah man sogar noch Ischia. Nein, schöner konnte das Leben gar nicht sein. Wenn es so dunkel wurde, dass wir den Ball nicht mehr sehen konnten, brachen wir das Spiel ab und rannten schweißtriefend, lachend und jubelnd ins badewannenwarme, glutrote Meer. Ja, das war das große Glück!
Und wenn wir wieder aus dem Wasser stiegen, war es dunkel, und der Mond stand schon am Himmel. – Gähn! – Herrlich! Aber dann kam Bernd, diese Kellerassel!
Mist, jetzt war ich wieder hellwach.
*
Mit dem ersten Glockenschlag fiel ich fast aus dem Bett. Ich sah auf die Leuchtziffern des Weckers, es war erst halb sechs.
Es folgten weitere Schläge.
Gab es wirklich Leute in dieser Stadt, denen man um halb sechs mitteilen musste, dass es gerade halb sechs geworden war? Wenn ja, warum von allen drei Kirchen? Und warum so laut?
Die nächsten Stunden verbrachte ich damit, alle dreißig Minuten die Schläge mitzuzählen, und die Glockenklänge den einzelnen Kirchen zuzuordnen. Irgendwann kamen die Kehrmaschinen, die Tauben begannen zu gurren, dann wurde es hell.
Francas Klopfen riss mich aus dem Tiefschlaf: »Sei pronto, Peter (bist du fertig)?«
Um genauer zu sein, sagte sie: »Sei pronto Biiiedärr?«
Wie alle Italiener sprach sie meinen Namen auf Englisch aus, oder versuchte es zumindest. »Biiiedärr« fällt ihnen leichter, als sich mit der deutschen Aussprache abzuquälen. Dann kommt höchstens ein hartes, russisch anmutendes »Pätärrr« heraus, was aber immer noch besser klingt als das fränkische »Beeeder«, das mir zuhause von den notorischen Konsonantenschändern meines Volksstammes so butterweich an die Ohren geknallt wird.
Zum Milchkaffee, den mir Franca mit Fragen nach meinem Wohlbefinden sowie einer groben Skizzierung der allgemeinen Weltlage auf den Tisch gestellt hatte, gab es Hörnchen, Brot, Butter und Marmelade. Auch zum Frühstück lief der Fernseher, und die Morgennachrichten der RAI knüpften nahtlos am Geschehen des Vortages an. Wieder gab es schwarze Limousinen, Regierungskrise, und schon in aller Herrgottsfrühe trugen weiße Overalls einen Blechsarg durch die neapolitanische Gegend. Eine Reporterin wusste nichts Genaues und ein paar Nachbarn beteuerten, dass sie nichts mitgekriegt hätten. Zum Abschluss gab es noch ein bisschen Überwachungskameravoyeurismus, Brangolina und ein paar Fußballtore.