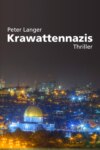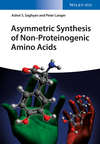Kitabı oku: «Der Ruhrbaron aus Oberhausen Paul Reusch», sayfa 12
Somit darf man wohl annehmen, dass er die in der Runde vorherrschende Meinung teilte: D.h. er glaubte auch nach drei Kriegsjahren und nach dem Kriegseintritt der USA noch an den Sieg; er lehnte jegliche Friedensangebote ab; obwohl er es durch seine Tätigkeit im Kriegsernährungsamt besser wissen musste, widersprach er nicht, als Duisberg von einer Verbesserung der Lebensmittelversorgung sprach; er war gegen jegliche Zugeständnisse an die Gewerkschaften; er hatte an den hohen Kriegsgewinnen im Prinzip nichts auszusetzen und er sagte nichts zur Verteidigung seines schwäbischen Landsmannes Groener, den er doch für einen „prächtigen Menschen“229 hielt.
Die Industrie stand keineswegs einmütig in Opposition gegen General Groener; vor allem in der verarbeitenden Industrie, aber nicht nur dort, gab es durchaus Sympathien für seine Strategie der Einbindung der Arbeiterschaft. Zu seinen Verbündeten zählten der Berliner Industrielle von Borsig und in Süddeutschland MAN-Chef von Rieppel sowie Dr. Sorge von der Firma Krupp.230 Unter den im Düsseldorfer Industrie-Club Anwesenden zeigte Reuschs Kollege Silverberg, später immer als enger Freund des GHH-Chefs bezeichnet, Rückgrat, als er seine abweichende Meinung zum Ausdruck brachte. Reusch trat ihm im Kreise der führenden Industriellen des Rhein-Ruhr-Reviers nicht zur Seite. Deshalb liegt der Schluss nahe, dass er sich ohne Vorbehalte mit dem harten Kurs der Schwerindustrie und der OHL identifizierte.
Die Tatsache, dass diese Besprechung stattgefunden hatte, blieb natürlich nicht geheim. Der Reichstagsabgeordnete Scheidemann (SPD) war offenbar gut informiert: Er wies bei der Debatte im Hauptausschuss des Reichstags auf den Zusammenhang zwischen der Denkschrift des Kriegsamtes über die Kriegsgewinne, der im Industrieclub laut gewordenen Kritik und der Entlassung Groeners hin.231 Auch im „Vorwärts“ äußerte sich Scheidemann zur Entlassung Groeners, der keineswegs „freiwillig“ gegangen, sondern durch eine Intrige der Obersten Heeresleitung gestürzt worden sei, weil er das Haupthindernis für eine Revision des Hilfsdienstgesetzes darstellte. Die von Duisberg ausgegangene Einladung zu der Besprechung vom 19. August beweise eindeutig, dass in den Kreisen der Industriellen schon bekannt war, dass Groeners Tage als Leiter des Kriegsamtes gezählt waren.232 Duisberg antwortete auf Scheidemanns Vorwürfe im Hauptausschuss des Reichstages mit einer öffentlichen „Richtigstellung“: Abgesehen davon, dass derartige Vorwürfe ihm einen Einfluss zuschrieben, den er nicht besitze, stellte er fest, dass er mit Groener immer bestens zusammengearbeitet habe und den General nach wie vor persönlich sehr schätze. Ein Wort des Bedauerns über seine Entlassung findet sich in der Gegendarstellung jedoch nicht.233 Über die von den Unternehmern geforderte Novellierung des Hilfsdienstgesetzes wurde in den folgenden Monaten zäh verhandelt. Industrie, Militärbehörden und Reichsregierung konnten sich aber nicht auf eine Gesetzesvorlage einigen.
Es gab im letzten Kriegsjahr verstärkt Kontakte der Gewerkschaften mit Großunternehmern, die die Zusammenarbeit der Arbeiterführer bei der Demobilisierung nach Kriegsende suchten. Ab dem Sommer 1918 wurde in diesen Gesprächen auch das Thema Arbeitszeit immer wichtiger. Bei allen diesen Kontakten mit den Vertretern der Arbeiterschaft spielte Reusch keine Rolle. Er mag die de-facto-Anerkennung der Gewerkschaften als Verrat an den wirtschaftsfriedlichen Werkvereinen aufgefasst haben. Mit diesem Argument jedenfalls begründete er im November 1918 seine harte Kritik an der Zentralarbeitsgemeinschaft von Unternehmern und Gewerkschaften.234
Nicht weniger katastrophal als die Lebensmittelnot wirkte sich nach drei Jahren Krieg der Kohlemangel aus. Wieland berichtete seinem Kollegen Reusch im August 1917 von einer sehr hitzigen Debatte im württembergischen Landtag, bei der die mangelhafte Kohleversorgung Süddeutschlands einmütig kritisiert worden war. Reusch antwortete – am selben Tag, an dem er die Niederschrift von dem Treffen im Düsseldorfer Industrie-Club erhielt – in einem elfseitigen Schreiben, bei dem am Ende sein ganzer Ärger über die Zugeständnisse an die Arbeiter und die Friedensresolution des Reichstags vom Juli durchbricht. Inhalt und Stil seiner Äußerungen sind entlarvend und müssen deshalb im Originalton wiedergegeben werden. Nach dem einleitenden Hinweis auf seine eigenen Vorschläge für die Kohleverteilung, die aber „Excellenz Gröner“ in den Wind geschlagen habe, erläutert er lang und breit die Transportprobleme auf der Schiene und auf dem Rhein. 45.000 gelernte Bergarbeiter, davon die Hälfte aus dem Ruhrrevier, seien bereits vom Militärdienst freigestellt worden. Genau dort aber, bei den Arbeitern, lag nach Reuschs Überzeugung das Problem: „Notwendig ist nun aber vor allem, dass die Arbeiter etwas in die Hände spucken und mehr als bisher ihre Schuldigkeit tun. Hätten wir heute die Friedensleistung eines Bergarbeiters, so könnten wir spielend 20–25% mehr Kohle fördern! Diese Mehrleistung kann erreicht werden, wenn die Behörden die systematische Verhetzung der Arbeiterschaft nicht wie bisher weiter unterstützen. Meines Erachtens ist schuld an der ganzen Misere die vollständig verfehlte Behandlung der Massen und der Arbeiter und insbesondere der Arbeiterführer, die unter dem Vorwande, nationale Politik zu treiben, ihre ganze Tätigkeit darauf richten, Unruhe und Unzufriedenheit in die Arbeiterschaft zu tragen.“ Und einmal in Fahrt, nahm Reusch anschließend die Politiker von SPD und Zentrum aufs Korn: „Ebenso wie die schwarzen und roten Brüder die Verhältnisse hinter der Front auf das allerungünstigste beeinflussen und uns das wirtschaftliche Durchhalten erschweren, werden sie schließlich durch ihr ewiges Friedensgerede und durch die unglückseligen Verhandlungen im Reichstag … erreichen, dass wir einen schmählichen Frieden schließen. Deutschland mag zu Grunde gehen, wenn nur die schwarze und rote Internationale triumphiert.“235 Ganz am Ende kommentiert er noch kurz General Groeners Abgang: Dieser sei „persönlich zweifellos ein prächtiger Mensch, der aber an seinem Idealismus und an der teilweisen Verkennung der wirtschaftlichen Verhältnisse scheiterte.“ Einzelheiten zu seinem Abtritt wollte er aber nur mündlich mitteilen.236
Dem General „Idealismus“ zu attestieren, war kein Kompliment. „Idealismus“ war für Reusch gleichbedeutend mit „Naivität“. „Realisten“ im Gegensatz dazu hielten, in Reuschs Weltsicht, an den extremen Annexionsforderungen fest und lehnten im Innern jegliche Zugeständnisse an die Gewerkschaften ab.
In beflissenem Ton pflichtete Wieland seinem mächtigen Unternehmerkollegen aus dem Ruhrgebiet bei: „Je höher die Löhne steigen, desto geringer wird die Leistung.“ Zu Reuschs Informationen über die Ernährung der Bergarbeiter meinte er: „Diese sind sogar in dieser Richtung bevorzugt und es ist daher umso unverantwortlicher, wenn sie so wenig leisten.“ Diese Tatsache sei in der Öffentlichkeit nicht bekannt. „Landauf wie landab ist die Ansicht verbreitet, dass überall die Minderleistung auf die mangelhafte Ernährung zurückzuführen sei.“237
Wieland revanchierte sich durch Stimmungsberichte aus Süddeutschland, die allerdings wenig beruhigend gewirkt haben dürften. Die „Missstimmung“ gegen Preußen wegen des Kohlemangels, der neuen Kriegsanleihe, aber auch wegen provozierender Äußerungen von Stinnes wachse ständig. Stinnes hatte angeblich eine ungeschickte Bemerkung über die „Ausschaltung der süddeutschen Industrie“ bei Kriegslieferungen gemacht.238 Reusch gelang es sicherlich, den Zorn seines württembergischen Kollegen zu dämpfen, als er sich Anfang November einen ganzen Tag Zeit nahm, um ihm die Werke der GHH in Oberhausen zu zeigen.239
Das Walzwerk Neu-Oberhausen war vermutlich nicht Teil des Besuchsprogramms. Denn wie schon im Sommer wurde dort in diesen Tagen der nächste erbitterte Arbeitskampf ausgetragen. Betriebsdirektor Dr. Ernst Lueg hatte für Sonntag, den 4. November 1917, Nachtarbeit angeordnet. Als der Arbeiter-Ausschuss seine Zustimmung verweigerte, kam es als Folge zu einem Produktionsausfall von 200 Tonnen Rohstahl für Granaten – für Lueg Anlass für eine bittere Klage über die schlimmen Folgen des Hilfsdienstgesetzes: „Im vergangenen Jahr, als noch kein Arbeiterausschuss eingesetzt war, haben die Arbeiter des Stahlwerks ohne jeden Einspruch an etwa 25 Sonntagen nachts gearbeitet.“240 Woltmann nahm sofort Kontakt auf mit dem Generalkommando, um die Einberufung streikender Arbeiter zu erreichen. Die Militärs zögerten jedoch, nachdem sie ihrerseits zwei Abgesandte des Arbeiterausschusses in Münster empfangen und eindringlich ermahnt hatten, und sandten einen Offizier nach Oberhausen. Ihm gegenüber vertrat Woltmann „nochmals scharf den Standpunkt, … dass eingezogen werden muss“.241 Er hatte zuvor von den dringend benötigten Facharbeitern und Maschinisten, die auf Drängen der Unternehmer vom Militärdienst freigestellt worden waren, „28 Mann aufgegeben“.242 Das Ersticken von Streiks durch Einziehung der Streikführer zum Militärdienst – das dürfte den Arbeitern ein Jahr später, als der Krieg zu Ende war, noch gut in Erinnerung gewesen sein!
Die Verbitterung in der Arbeiterschaft ließ sich im vierten Kriegswinter auch durch zusätzliche freiwillige Leistungen für die Wohlfahrtseinrichtungen des Konzerns nicht mehr besänftigen. Der Geschäftsbericht verzeichnete 11,7 Millionen Mark (499,70 Mark pro Kopf der Belegschaft) – in bereits inflationiertem Geld – für diesen Zweck. Reuschs Freund Wieland, der den GHH-Geschäftsbericht auch erhalten hatte, gratulierte allerdings ausschließlich zu dem „außerordentlichen Aufschwung des ganzen Unternehmens im letzten Kriegsjahr“.243
Träume von der Verteilung der Beute
Noch während des ganzen letzten Kriegsjahres ging das Gerangel um die nach einem Siegfrieden zu erwartende Kriegsbeute weiter. Deshalb kam auch für die Herren der Schwerindustrie bis zum Schluss ein Verzicht auf Annexionen in Nordfrankreich nicht in Frage. Was mögliche Schnäppchen in den besetzten Gebieten in Frankreich anging, so ließ sich Reusch selbst im Urlaub auf dem Katharinenhof von seinen Untergebenen auf dem Laufenden halten. Die von den preußischen Behörden erstellte Liste des französischen Besitzes ging im Juli 1917 per Eilboten an ihn ab.244 Ganz offensichtlich sollte die GHH sofort zur Stelle sein, falls es interessante Objekte gab.
Reuschs Hauptinteresse richtete sich auf einen der größten schwerindustriellen Konzerne in Lothringen, den Besitz der Familie de Wendel. Die Werke des Konzerns wurden sofort nach Kriegsbeginn von der deutschen Regierung beschlagnahmt. Im August 1917 wurde die Liquidation eingeleitet.245 Dabei setzten sich einflussreiche Regierungskreise, an der Spitze Staatssekretär Helfferich, für eine Beteiligung des Reiches mit 51 Prozent ein. Die im Stahlwerksverband zusammen geschlossenen Firmen strebten die Übernahme des Konzerns zu 100 Prozent durch Mitglieder ihres Kartells an. Dagegen wollte die Regierung auch weitere Interessenten, z.B. Rathenaus AEG, beteiligen.246 Reusch hatte schon früher verlangt, dass bei der Verteilung der Kriegsbeute vorrangig die Konzerne zum Zug kommen sollten, die über großen Grubenbesitz in der Normandie verfügten, da auch bei einem Sieg diese Gruben in Feindesland möglicherweise nicht zu halten sein würden. Dieses Thema kam jetzt beim Verein deutscher Eisenhüttenleute auf die Tagesordnung. Reusch beauftragte Woltmann und den Rohstoffexperten Kipper, an der Besprechung über den Wert der Normandie-Gruben im August 1917 teilzunehmen.247 Ende 1917 war noch nichts entschieden. Deshalb hoffte Reusch nach wie vor, dass eine Beteiligung der Regierung und anderer Firmen an der Liquidation von de Wendel vermieden werden könne.248
Am Rande der Generalversammlung des Vereins deutscher Eisenhüttenleute im Dezember 1917 sprach Woltmann, der anstelle des erkrankten Reusch die GHH vertrat, mit den führenden Ruhr-Industriellen das weitere Vorgehen ab. Eine Teilung des Grubenbesitzes von de Wendel sollte in jedem Fall vermieden und Klöckner mit seiner gegenüber der Regierung eher kompromissbereiten Haltung beiseite gedrängt werden.249 Man versteht vor diesem Hintergrund, dass der Verzicht auf Annexionen im Westen, gar der Verlust von Elsass-Lothringen, für die Schwerindustrie völlig inakzeptabel war. Auf dieser Generalversammlung des Vereins deutscher Eisenhüttenleute wurde deshalb die Notwendigkeit von Annexionen im Westen, besonders des Erzbeckens von Briey, erneut bekräftigt.250
Der Abschluss des Diktat-Friedens von Brest-Litowsk am 3. März 1918 nährte bei der Schwerindustrie ganz offensichtlich die Hoffnung, dass man den Kriegsgegnern im Westen nach dem Sieg derartige Bedingungen würde aufdrücken können. Im März 1918 schien die Übernahme von de Wendel in ein so konkretes Stadium zu treten, dass Reusch seinem Stellvertreter genaue Handlungsanweisungen für die nächste Sitzung des Stahlwerksverbandes gab: Zwar habe der zuständige Ausschuss des Reichstages die hundertprozentige Übernahme in den Besitz des Reiches gefordert. Sehr energisch sei dort auch verlangt worden, keine Mitglieder des Stahlwerksverbandes zum Kauf zuzulassen. Da die Regierung das Ansinnen des Reichstags jedoch rundum zurückgewiesen habe, rechnete Reusch aus dieser Ecke nicht mehr mit Einwendungen gegen den Verkauf. Größere Sorgen bereitete ihm die bayrische „Raumer-Gruppe“, der die Regierung von Elsass-Lothringen unbedingt den Zuschlag für das Hüttenwerk geben wolle. Mit der „Raumer-Gruppe“ war vermutlich das süddeutsche Bündnis von Siemens mit der MAN gemeint; dieses Bündnis zweier Giganten der verarbeitenden Industrie mit den liberalen Chefs v. Raumer und Rieppel muss für Reusch ein rotes Tuch gewesen sein. Dagegen wollte Reusch ein Bündnis im Stahlwerksverband schmieden, wobei ihm die Tatsache sehr gelegen kam, dass so wichtige Gestalten wie Vögler von Deutsch-Luxemburg und Hasslacher von den Rheinischen Stahlwerken sich von Woltmann bei der anstehenden Sitzung vertreten ließen. Da Woltmann sozusagen über drei Stimmen verfügte, war zu erwarten, dass sein Verhalten gegen Klöckners kompromissbereitere Einstellung den Ausschlag geben würde. Reusch ließ gegenüber seinem Stellvertreter keine Missverständnisse aufkommen. Er legte genau fest, welche Anträge er zu stellen und welche er abzulehnen hatte.251 Der Verkauf von de Wendel war noch Ende Oktober 1918 Gesprächsthema zwischen der Reichsregierung und den Vertretern der Schwerindustrie!252 Die im September angelaufene Auktion blieb aber am Kriegsende erfolglos, mangels Kaufinteressenten.253
Auch der Ulmer Industrielle Wieland, Reusch seit langem freundschaftlich verbunden, wollte zur Stelle sein, wenn die französische Industrie in Lothringen zum Verkauf stand. Er musste sich dabei aber ganz auf das Insider-Wissen seines Freundes aus der Schwerindustrie verlassen, wenn es galt, den Wert bestimmter Stahlwerke und Zechen einzuschätzen. Kellermann lieferte seinem Chef mehrseitige Gutachten, deren Ergebnisse Reusch in eine präzise Kaufempfehlung an Wieland einfließen ließ. Reusch wusste auch zu berichten, dass bei einem der Objekte die Rheinischen Stahlwerke bereits zugegriffen hatten.254
Die im Frühjahr 1918 noch sehr konkreten Pläne für die Kriegsbeute erledigten sich dann endgültig durch den deutschen Zusammenbruch. Die Unternehmer wussten spätestens Anfang Oktober, dass der Spuk zu Ende war. Zu diesem Zeitpunkt musste auch der Verein Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller (VdESI) zur Kenntnis nehmen, dass Deutschland den Krieg verloren hatte. Jetzt plötzlich informierte der Geschäftsführer Reichert die Vorstandsmitglieder, dass der Frieden „uns die Reichslande Elsass-Lothringen kosten“ könne und dass die Industriellen der Regierung jetzt „mit Rat und Tat zur Seite stehen“ müssten.255
Durchhalteparolen in den letzten Kriegswochen: Der Propaganda-Apparat der „Deutschen Vereinigung“
Schon vor 1914 war die „Deutsche Vereinigung“, in der Reusch sich als Mitglied des Reichsvorstandes und Vorsitzender der Ortsgruppe Oberhausen ganz besonders engagiert hatte, zu einer Art Dachverband für die „gelben“ Gewerkschaften geworden. In ihrem Arbeitsprogramm stand die Durchführung von Kursen für die in den Werkvereinen organisierten Arbeiter ganz im Mittelpunkt. Neben der vaterländischen Erziehung und der Immunisierung gegen demokratische oder gar sozialistische Irrlehren standen Fortbildungsthemen wie „Die Kriegspflichten der Hausfrau“.256 Zweifel an seiner politischen Einstellung ließ der GHH-Chef nie aufkommen. Bei der Vorstandssitzung im November 1915 „stimmt Generaldirektor Kommerzienrat Dr. Reusch den Ausführungen des Vorsitzenden über die demokratische Gefahr und die schwache Haltung der Regierung ihr gegenüber, die große Befürchtungen für die Zukunft erwecke, voll und ganz bei.“257 Wie stark Reusch in diesem nationalistischen Verband persönlich engagiert war, wird aus den ständigen, hartnäckigen Beitragsmahnungen an die Kollegen in der Schwerindustrie ersichtlich. Die Höhe der Beiträge aus der Industrie, die Reusch einsammelte, illustriert nebenbei auch, wie stark die Geldentwertung bereits in der Mitte des Krieges spürbar wurde.258 Reusch ließ auch nicht locker bei seinem Versuch, prominente Persönlichkeiten für den Reichsvorstand zu kooptieren. 1917 schlug er u. a. Springorum, Vögler und Kirdorf vor.259 Die Deutsche Vereinigung unterstützte während des ganzen Krieges die annexionistische Kriegszielpropaganda; bis ganz zum Ende im Herbst 1918 hielt sie am Ziel des „Siegfriedens“ fest. Paul Reusch schrieb noch im März 1918, wohl im Rausch des „Siegfriedens“ von Brest-Litowsk, in der Verbandszeitschrift „Deutsche Wacht“: „An dem endgültigen Sieg unserer Waffen ist heute nicht mehr zu zweifeln.“260
Wo die Deutsche Vereinigung politisch einzuordnen war, geht auch aus der Tatsache hervor, dass bei der Vorstandssitzung am 1. August 1917 in Düsseldorf der Generallandschaftsdirektor Kapp aus Königsberg, die Galionsfigur des Militärputsches gegen die Weimarer Republik drei Jahre später, in den Reichsvorstand kooptiert wurde.261 Kapp wurde einige Wochen später auch zum Stellvertretenden Vorsitzenden der neu gegründeten, extrem nationalistischen „Vaterlandspartei“ gewählt. Die Deutsche Vereinigung trat diesem Sammelbecken rechtsradikaler Kreise korporativ bei. Anders als Stinnes, Kirdorf, Hugenberg, aber auch Duisberg, Wilhelm v. Siemens und Borsig wurde Reusch persönlich anscheinend nicht Mitglied; jedenfalls finden sich in seinem Nachlass dafür keine Belege.262 Auch in dem marxistisch ausgerichteten Sammelband über die „bürgerlichen Parteien in Deutschland“, der penibel alle Vertreter des „Monopolkapitals“ auflistet, wird Reusch nicht erwähnt.263 Dafür erklärte er in diesen Tagen seinen Beitritt zum obskuren „Bund zur Bekämpfung fremden und Förderung deutschen Wesens“.264
In den letzten Kriegswochen und während der Revolutionsphase 1918/19 tat sich die Deutsche Vereinigung als Propagandazentrum der politischen Rechten hervor. Die Berliner Hauptgeschäftsstelle produzierte serienweise Flugblätter. Im September 1918 bestellte Reusch 10.000 Exemplare des zweiseitigen, eng beschriebenen Pamphlets „Haltet aus!“.265 Er bekannte sich damit zu einem Schriftstück, in dem das ganze Sammelsurium irrationaler, in sich teilweise widersprüchlicher nationalistischer Hetz-Parolen noch einmal ausgebreitet wurde. Erschreckend besonders das weltfremde Festhalten am Endsieg nach vier Jahren Stellungskrieg und drei Wochen, bevor Hindenburg und Ludendorff den Zusammenbruch der deutschen Armee eingestehen mussten und einen sofortigen Waffenstillstand forderten: „Unter dem schweren Druck des U-Boot-Krieges haben die Feinde alle ihre Kräfte an der Westfront eingesetzt, um ohne Rücksicht auf die Blutopfer den so lange schon vergeblich erstrebten Durchbruch durch unsere lebendige Eisenmauer zu erzwingen. Dank der unüberwindlichen Tapferkeit der Unseren sind sie abermals zuschanden geworden.“ Kleine Rückschläge nutzten „die Flaumacher“ jetzt zu pessimistischen Prognosen. „Sie wissen es natürlich besser als unsere großen Feldherren Hindenburg und Ludendorff. Unsere beiden Heerführer sind den feindlichen ebenso überlegen, wie unsere Kämpfer all dem bunten und krausen Gewimmel, das gegen uns zusammengeschleppt worden ist. … Das ungeheure Russland, das mehr als zwölf Millionen Streiter gegen uns ins Feld geschickt hat, ist endgültig aus dem Kampfe ausgeschaltet; Belgien, Rumänien und Serbien sind erledigt. Trotz der vielfachen Übermacht der Feinde ist unser Vaterland von den Schrecken des Krieges frei. Wir stehen heute tausendmal besser da, als in jenen Tagen, da die Russen bis vor Königsberg streiften. … Wir haben gesiegt und immer wieder gesiegt, und wir stehen siegreich tief in Feindesland.“ Deshalb müsse man den Siegesprognosen von Hindenburg und Ludendorff Vertrauen schenken. Sonst drohe Deutschland das Elend einer Besetzung durch die Feinde. „Wir wissen ja alle, was die Ostpreußen durchzumachen hatten, und wir kennen durch die Erzählungen unserer Feldgrauen das grauenhafte Schicksal der Franzosen, deren Wohnstätten zum Kriegsschauplatze geworden sind.“266 Trotz des „grauenhaften Schicksals der Franzosen“ in vier Besatzungs- und Kriegsjahren, verursacht durch den Einmarsch der deutschen Truppen, empörten sich die Verfasser darüber, dass bei Friedensverhandlungen Entschädigungsforderungen für die gigantischen Zerstörungen auf dem Tisch liegen würden: „Für unsere riesigen Kriegskosten und Kriegsverluste sollen wir keinen Pfennig Ersatz erhalten. Dagegen müssen wir, wenn es uns nicht gelingt, durch unsern Sieg den Vernichtungswillen der Feinde zu brechen, diesen ungeheure Kriegsentschädigungen zahlen.“267 Diesen Text ließ Reusch Mitte September 1918 in Oberhausen auf 10.000 Flugblättern verteilen. Bereits im Sommer 1917 war offenkundig gewesen, dass der unbeschränkte U-Boot-Krieg die erhoffte Wirkung verfehlt hatte. Die deutschen Offensiven vom Frühjahr und Sommer 1918 waren gescheitert. Diese militärischen Fehlschläge waren gut informierten Zeitgenossen wie dem Generaldirektor eines deutschen Großkonzerns zweifellos bekannt.
Die kriegsmüden Massen schätzten die Lage weitaus realistischer ein. Als in den Industriestädten Massenstreiks um sich griffen, war deshalb die Deutsche Vereinigung sofort im September 1918 mit einem weiteren Flugblatt zur Stelle, das von mehr als 40 Berufsverbänden und Werkvereinen, wohl durchweg aus dem Spektrum der gelben Gewerkschaften, unterzeichnet war. Auf zwei eng beschriebenen Seiten wurde den Arbeitern eingehämmert, dass die Streiks von ausländischen Agenten angestiftet seien, den Krieg verlängern und die Zufuhr von Lebensmitteln in die Städte verhindern würden. Die Hauptgeschäftsstelle der Deutschen Vereinigung schickte Reusch auf dessen Wunsch hin ein Exemplar und verband dies mit der Bitte an die Industrie, sich an den Druckkosten (5.578 Mark) zu beteiligen. In ganz Deutschland seien 518.000 Exemplare verteilt worden, wie viele davon in Oberhausen, ist nicht bekannt.268
Es wird wohl kaum jemand mehr die albernen Durchhalte-Parolen der „Deutschen Vereinigung“ geglaubt haben. Sie sollen zum Abschluss der Alltags-Wirklichkeit vor Reuschs Haustür in der Industriestadt Oberhausen gegenübergestellt werden. Die Menschen in Oberhausen konnten jeden Tag in der Zeitung lesen, wie desolat die Situation war und was sie im herannahenden fünften Kriegswinter zu erwarten hatten. Die nüchternen Bekanntmachungen des städtischen Nahrungsmittelamtes lassen erahnen, wie groß die Not war:
„In der Woche vom 7. bis 13. Oktober haben die … Bezugsscheine für Lebensmittel für die nachbezeichneten Mengen folgende Gültigkeit:
| Kartoffeln: | 7 Pfund (65 Pfg), |
| Butter: | 30 Gramm (30 Pfg), |
| Fett: | 30 Gramm Margarine (12 Pfg), |
| Zucker: | 125 Gramm, |
| Marmelade: | 100 Gramm Kunsthonig (15 Pfg). |
Nährmittel können in der laufenden Woche nicht zur Ausgabe gelangen, damit für die nächste fleischlose Woche eine Ausgabe von Nährmitteln stattfinden kann.
Ferner werden ohne Rationierung ausgegeben: Dörrgemüse, Gerstenkaffee, Atlas-Suppenwürze, Nährhefe, Speisesalz, Viehsalz, Lakto-Eipulver.
Fleisch und Fleischwaren werden in der laufenden Woche 200 Gramm … ausgegeben. Die Rüstungsarbeiter erhalten wieder die regelmäßige Wurstzulage.“269
Und selbst diese Rationen standen z.T. bald nur noch auf dem Papier: Zwei Wochen später gab es statt Butter nur noch Margarine, und es wurde die vierte fleischlose Woche proklamiert.270 Anfang Dezember würde es statt Butter und Fett nur noch insgesamt 55 Gramm „Feintalg“ geben.271
Die Bergleute waren am Ende ihrer Kraft. In einer von 800 Bergleuten besuchten Belegschaftsversammlung der Zeche Osterfeld Mitte Oktober wurde einstimmig die Resolution angenommen, „wonach die Belegschaft sich nur noch imstande fühlt, eine einfache Schicht zu verfahren infolge der unzureichenden Nahrungsmittelversorgung und der niedrigen Löhne, die von der Zeche Osterfeld gezahlt werden“. Dienstags und freitags wurden von den Bergleuten eineinhalb Schichten verlangt.272 In den unruhigen Krisenzeiten nach Kriegsende würde die Zeche Osterfeld keineswegs ein revolutionäres Zentrum sein – im Gegenteil! Aber selbst dort empfanden die Bergleute die immer neuen Belastungen in diesen letzten Kriegswochen als nicht mehr zumutbar. Zunächst aber schien ihnen keiner zuzuhören, bis deren angestauter Zorn dann im Dezember zum Ausbruch kam.
Eine der schlimmsten Folgen der Mangelernährung war die Anfälligkeit für die Grippe. Ein Medizin-Professor empfahl bei einem Vortrag in Oberhausen, da es Milch und Käse nicht mehr gab, in der Apotheke 100 Gramm Kalk zu kaufen. „Man löst diesen in 6 Liter Wasser auf und nimmt zu jeder Mahlzeit zwei Esslöffel voll, kleine Kinder die Hälfte.“273 Ob diese Empfehlung wohl viele vor der Grippe bewahrt hat? In der zweiten Oktoberhälfte erkrankten immer mehr Menschen; es wurde eine stark um sich greifende Epidemie. Die Schulen wurden für zwei Wochen geschlossen. In Sterkrade mussten Lehrerinnen und Lehrer mit den gesunden Kindern in dieser Zeit Bucheckern sammeln, um damit zu Hause dann die karge Kost zu ergänzen.274 Trotzdem starben immer mehr Menschen an den Folgen der Grippe, allein in Oberhausen bis zum Abebben der Epidemie im November pro Woche jeweils mehr als hundert275; die Todesanzeigen für noch recht junge Menschen („nach kurzer schwerer Krankheit“) häuften sich. Am letzten Oktobersonntag gab es in Oberhausen 30 Beerdigungen.276
In dieser Situation wurde immer noch versucht, den Menschen die Spargroschen für die Kriegsfinanzierung aus der Tasche zu ziehen. Alles, was Rang und Namen hatte in Oberhausen, u. a. Oberbürgermeister Havenstein und GHH-Chef Paul Reusch, unterschrieb einen Aufruf zur Zeichnung von Kriegsanleihen, der mit pathetischen Durchhalteparolen getränkt war: „Unser Volk und Land steht vor dem letzten und schwersten Gang in diesem gewaltigen Kriege. Amerika und England haben heimtückisch fast die ganze Erde in den Kampf gegen uns gezwungen. Deutschland steht vor seiner Schicksalsstunde. … Unsere Westfront kann von unseren Gegnern trotz aller Anstürme nicht durchbrochen werden.“277
Zur Erinnerung: Paul Reusch hatte seine privat erworbenen Kriegsanleihen schon zwei Jahre vorher beim Kauf des Schlosses Katharinenhof wieder abgestoßen.