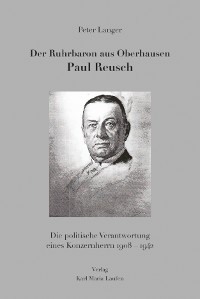Kitabı oku: «Der Ruhrbaron aus Oberhausen Paul Reusch», sayfa 18
Militäreinsatz im Ruhrgebiet
Als Mitglied der Nationalversammlung hielt sich Reuschs württembergischer Kollege Wieland ab Februar 1919 im ruhigen Weimar auf. „Streng vertraulich“ informierte er Reusch auf Kopfbogen der „Verfassunggebenden deutschen Nationalversammlung“ über die Pläne der Reichsregierung. Reuschs Briefe aus dem streikgeplagten Ruhrrevier hatte er als „Notschrei“ verstanden und darauf sofort Erkundigungen bei der Reichsregierung eingeholt. „Nun kann ich Ihnen die erfreuliche Mitteilung machen, dass die Regierung energische Maßnahmen treffen und mit 12.000 Mann zuverlässiger Truppen zur Niederwerfung der Unruhen in Düsseldorf und im Ruhrgebiet vorgehen wird.“109
Reusch eröffnete seinen Antwortbrief mit einem „Herzlichen Dank!“. Er hielt es für falsch, dass überhaupt mit der Streikleitung in Essen verhandelt wurde. Dies habe nur zu einer „für uns außerordentlich unliebsamen Verzögerung“ geführt. Die Stärke der im Ruhrgebiet zum Einsatz kommenden Truppen fand er gut. „Diese Truppenmassen sind aber auch unbedingt notwendig.“ Er begründete dies mit den Berichten aus den GHH-Betrieben, die er als Anlage hinzufügte. „Sie werden sich immerhin aus diesen Berichten ein kleines Bild machen können, wie es hier zugegangen ist und noch zugeht. Die Regierung hat dadurch schwer gesündigt, dass sie nicht schon vor mehr als Monatsfrist hier eingegriffen hat.“ Der Brief endete mit dem Stoßseufzer: „Die Regierungstruppen stehen bereits hier in nächster Nähe. Ich werde die erste Granate, die hier einschlägt, als Erlöser begrüßen, der uns von dem Druck, der nun seit Wochen und Monaten auf uns lastet, befreit.“110
Drei Tage später wurde er ungeduldig, weil die Truppen immer noch nicht in Oberhausen eingerückt waren: „Sie stehen wenige Kilometer von hier entfernt und dürfen vorläufig nicht weiter marschieren, weil die Regierung anscheinend immer noch mit den ,Herren Spartakisten’ verhandelt.“ Auf mehreren Seiten gab Reusch dann eine sehr plastische Schilderung einiger Vorkommnisse unter der Herrschaft „der Spartakisten“ zur Zeit des Generalstreiks. Reusch war kein Augenzeuge dieser Vorkommnisse; manches wird vermutlich sehr aufgebauscht sein. Wichtig ist hier jedoch nicht der objektive Wahrheitswert seiner Schilderung, sondern die subjektive Wahrnehmung. Reusch weiß von zwei beschlagnahmten Autos zu berichten, wovon eines dann in Essen zum Kauf angeboten wurde. Die Lebensmittelrationen hätten erneut reduziert werden müssen. „Der A.- und S.-Rat hat auf die Vorräte die Hand gelegt, um seine Kampftruppen zu ernähren; infolgedessen versucht jeder im Schleichhandel zu erwerben, was er bekommen kann.“ In einer Kantine, wo täglich 100 Beamte essen, wurde ein Rind requiriert; der Kantinenwirt konnte es aber am nächsten Tag wieder zurückkaufen. Sechs bewaffnete Begleiter eines Demonstrationszuges durchsuchten das Werksgasthaus der GHH nach Waffen und ließen sich bei dieser Gelegenheit auch den Weinkeller zeigen. Richtig zählen konnten sie nicht: Statt der tatsächlich vorhandenen 29.000 Flaschen im Wert von ca. 200.000 Mark stellten sie nur einen Bestand von 17.000 Flaschen fest, die sie dann aber unter Beschlag nehmen wollten, um sie an die Bevölkerung zu verteilen. „Der Verwalter verlangte, dass die Beschlagnahme durch Unterschrift des Vorstandes des A.- und S.-Rates schriftlich ausgesprochen wird.“ Als sie diese Bescheinigung nicht beibringen konnten, verlangten sie wenigstens ein paar Tausend Mark, sonst würden sie am nächsten Tag mit einem Demonstrationszug erscheinen, den Keller plündern und das Haus demolieren. Offenbar machten „die Spartakisten“ ihre Drohung nicht wahr. Reusch legte die Schilderung der Ereignisse einem flammenden Appell an die bürgerlichen Abgeordneten zugrunde: „Diese Dinge geschehen, während die Regierungstruppen wenige Kilometer von hier entfernt stehen. Warum räumt die Regierung, der ja auch mehrere Ihrer Fraktionskollegen angehören, nicht endlich einmal mit den Arbeiter- und Soldatenräten auf? Wenn Ihre Fraktionskollegen und die Regierungsmitglieder aus dem Zentrum dieses Gebot der Stunde nicht durchsetzen können, dann ist es Pflicht der bürgerlichen Reichsminister schleunigst aus der Regierung auszutreten. Ziehen die Herren nicht diese Konsequenzen, so schließe ich und mit mir wohl eine großer Teil des deutschen Volkes daraus, dass die bürgerlichen Minister an ihren Ministersesseln kleben. Sie sind dann als Revolutionsgewinnler genau so zu verurteilen, wie viele Andere, die in den letzten Monaten ihre persönlichen Vorteile zu wahren suchten.“111 Dies war sehr dick aufgetragen, wenn man bedenkt, dass zur gleichen Zeit der Kommunalwahlkampf ohne größere Störungen ablief, die Veranstaltungen der bürgerlichen Parteien offenbar nicht behindert wurden und dass die Wähler am 2. März ungehindert ihre Stimme abgeben konnten.
Für Reusch waren die geschilderten Ereignisse, bei denen, wohl gemerkt, kein Mensch zu Schaden kam, so ungeheuerlich, dass er jegliche Verhandlungen mit den Arbeiter- und Soldatenräten ablehnte. Wegen des von den „Spartakisten“ in den Werken ausgeübten Terrors verlangte er von der Regierung „rücksichtslos durchzugreifen“. Beim Einmarsch ins westliche Ruhrgebiet sei Widerstand von den revolutionären Gruppen nur in Hamborn und in Düsseldorf zu erwarten. Überall sonst „werden sie ausreißen und ihre Haut so schnell als möglich in Sicherheit bringen“. Bei der Mehrheit der Arbeiter herrsche eine „maßlose Wut … gegen die Spartakisten … und gegen die Regierung“, weil sie sich „wochenlang vollständig im Stich gelassen“ fühlten. Dieser letztere Brief ging nicht an den gemäßigten Liberalen Wieland, sondern an den deutschnationalen Scharfmacher Hugenberg.112 Wo Reusch sich im politischen Spektrum einordnete, zeigte er auch wenige Tage später, als er Hugenberg für seine Rede in der Nationalversammlung in überschwänglichem Stil beglückwünschte.113
Die Nationalversammlung wurde in diesen Tagen mit ähnlichen Berichten über die dramatische Lage in den Ruhrgebietsstädten überschüttet. Inzwischen war Noske als Kriegsminister mit Sondervollmachten ausgestattet, verfügte aber angeblich nicht über genügend zuverlässige Truppen.114 Für den Einmarsch im westlichen Ruhrgebiet und schließlich auch in Oberhausen reichte es aber. Nach Reuschs Informationen war der Einmarsch der Truppen im westlichen Ruhrgebiet „verhältnismäßig unblutig verlaufen“. Noch bevor diese Truppen Oberhausen erreichten, wollte er sichergestellt wissen, dass die Soldaten in der Nähe blieben, um „jederzeit sofort eingreifen [zu] können, falls Spartakus sich wieder rührt“. Versprechungen und Zugeständnisse der Regierung an streikende Arbeiter dürfe es nicht geben, denn: „Wenn ein ungezogenes Kind sieht, dass es durch seine Ungezogenheit etwas erreicht, dann wird es niemals artig werden.“115
Kurz nach der Kommunalwahl, am 6. März 1919, rückte die „Brigade Gerstenberg“, aus Hamborn kommend, in Oberhausen ein. Die Truppe bestand aus „mehreren Kompanien Infanterie, Artillerie, Pionieren und einer Minenwerfer-Abteilung“ und hatte „außer Maschinengewehren usw. schwere Geschütze“. Es gab nur einen Auftrag für die Soldaten: „Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung“, worunter auch verstanden wurde, „den Arbeitswilligen die Arbeitsmöglichkeit zu erhalten oder zu verschaffen“.116 Brauchte es dazu Minenwerfer und schwere Geschütze? Die Brigade Gerstenberg war Anfang Februar mit der Reichsexekution in Bremen beauftragt worden; sie richtete dort ein Blutbad an.117 Unmittelbar bevor sie nach Oberhausen kam, wurde die Truppe in Hamborn gegen demonstrierende Bergleute – u.a. auch Arbeiter aus den GHH-Zechen Sterkrade und Hugo – eingesetzt und walzte dort jeden Widerstand durch Einsatz von Artillerie nieder. Danach marschierten Teile der Truppe nach Oberhausen weiter.118 Die Freischärler begannen sofort mit Hausdurchsuchungen und der Beschlagnahmung von Waffen. Wie die in den folgenden Tagen mehrfach wiederholten Anzeigen vermuten lassen, war diese Suche jedoch nicht sehr ergiebig.119
Nachdem die Brigade Gerstenberg in Reuschs Sinne in Oberhausen „aufgeräumt“ hatte, beklagte sich der Konzern-Chef nur noch über die vielen „Zugeständnisse, die von den Massen der Regierung abgepresst werden“. Wie er sich den Umgang mit den Arbeitermassen vorstellte, machte er am Beispiel der Arbeitlosenfürsorge klar. Die Kapazitäten seiner Werke seien bei weitem nicht ausgelastet, weil die Arbeitskräfte fehlten. Er könne „viele Tausende von Leuten beschäftigen, die aber trotz der hohen Löhne, die wir heute zahlen, einfach nicht zu haben sind.“ Der Grund dafür sei die „von der Revolutionsregierung eingeführte Arbeitslosenfürsorge, die ihre jetzige Gestalt ja wohl lediglich dem Umstande zu verdanken hat, dass die herrschenden Parteien Stimmenfang betreiben wollten. Nun sollte es aber genug sein des grausamen Spiels: Die lächerlichen Aufrufe der Reichsregierung und ihre Ermahnungen an die Arbeiterschaft üben doch nicht die geringste Wirkung aus. Wenn die Arbeitslosenfürsorge in der bisherigen Weise beibehalten wird, dann gehen wir sicher dem Staatsbankrott entgegen.“ Reusch sah im Ruhrrevier 100.000 Arbeitsplätze, die sofort besetzt werden könnten. Voraussetzung, „um die vielen Faulenzer, die heute auf der Straße herumliegen, zur Arbeit heranzuholen, [sei] die Aufhebung der Arbeitslosenfürsorge. Das klingt vielleicht radikal, ist aber der einzige Weg zur Lösung der vorhandenen Schwierigkeiten. … Also Arbeit ist vorhanden; es fehlt nur an der Arbeitswilligkeit der Menschen.“120
Ob die 100.000 freien Arbeitsplätze im Ruhrgebiet tatsächlich zur Verfügung standen, kann an dieser Stelle nicht beurteilt werden. Sicher aber ist, dass in Deutschland generell durch die Demobilisierung ein Millionenheer von Arbeitslosen einer geringen Zahl von Arbeitsplätzen gegenüberstand. Weil dies vorhersehbar war, hatte der Rat der Volksbeauftragten schon am 13. November 1918 die Arbeitslosenfürsorge durch Verordnung eingeführt. Die neue Regierung musste versuchen, das Elend der von der Front zurückkehrenden Soldaten und ihrer Familien zu lindern, auch wenn dies teilweise unerfüllbare Ansprüche weckte, die von manchen Gruppen, vor allem von jungen Männern, in zunehmend dreister Form geltend gemacht wurden. Trotz vieler Mängel bei der praktischen Umsetzung, die in der Neufassung vom 15. Januar 1919 teilweise korrigiert wurden, trug deshalb das Dekret über die Arbeitslosenfürsorge in den Wintermonaten 1918/19 zweifellos zur Entspannung der sozialen Lage bei.121 Reusch war an keiner der Verhandlungen mit den Gewerkschaften über tarifliche Fragen beteiligt. Die ganze Richtung der sozialpolitischen Maßnahmen seit der Revolution passte ihm nicht. Er gehörte zu den Unternehmern, die versuchen würden, die sozialen Errungenschaften der Revolution bei nächster Gelegenheit wieder zu beseitigen.
Der Generalstreik im April 1919
Nach dem im Februar gescheiterten Generalstreik verschwand das Thema Sozialisierung nicht von der Tagesordnung. Die Reichsregierung ergriff jetzt die Initiative und brachte ein eigenes Konzept in die Nationalversammlung ein. Die Agitation linker Gruppen in der Arbeiterschaft schob gleichzeitig das Thema Arbeitszeitverkürzung wieder in den Vordergrund. Die Syndikalisten in Hamborn und die Kommunisten im Essener Bezirk forderten jetzt auf den Zechen die Sechs-Stunden-Schicht und stießen damit bei den Arbeitermassen auf große Resonanz.
In der zweiten Märzhälfte nahm der Druck von unten auch auf den GHH-Zechen wieder zu, was Reusch sofort wieder zum Anlass nahm, in Telegrammen an das Generalkommando in Münster und an die Reichsregierung nach dem Militär zu rufen: „Nachdem im Hamborner Bezirk am Montag dem 17. März die Belegschaft der dortigen Zechen die Ausfahrt nach 6-stündiger Schicht erzwungen hat, ist heute auch die Belegschaft unserer dem Hamborner Bezirk benachbarten Zeche Sterkrade nach 6 Stunden ausgefahren, trotzdem gestern noch der Arbeiterausschuss erklärte, dass die Belegschaft dieser Zeche sich der Hamborner Bewegung nicht anschließen werde. Falls nicht seitens der zuständigen Stellen energische Maßnahmen ergriffen werden, besteht die Gefahr, dass sich die Bewegung in kürzester Zeit auf das ganze Industrierevier ausdehnt.“ Im Telegramm an Ministerpräsident Scheidemann formulierte Reusch den letzten Satz noch etwas drastischer und fügte einen weiteren Satz hinzu: Er verlangte auch von der Reichsregierung „energische Maßnahmen“, da sonst die Gefahr bestehe, „dass die von den radikalsten Elementen ausgehende Bewegung auf das ganze Industrierevier übergreift. Wir dürfen wohl der Erwartung Ausdruck geben, dass die Reichsregierung ihrerseits Maßnahmen ergreift, welche die Gefahren, die dem gesamten deutschen Wirtschaftsleben drohen, abwenden.“122
Schon einen Tag später – Reusch war jetzt selbst in Berlin – erreichte ihn ein Telegramm aus Oberhausen, das eher Entspannung signalisierte: Verglichen mit dem Vortag sei die Lage auf der Zeche Sterkrade „heute günstiger“: Statt der 297 Bergleute, die am Vortag „vorzeitig ausgefahren“ seien, waren es am 20. März nur noch 157. Auf der Zeche Vondern hätten „drei führende verständige Arbeiterausschussmitglieder ihr Amt niedergelegt, weil sie mit den radikalen Mitgliedern des Ausschusses nicht zusammenarbeiten wollen“. Das Telegramm schließt mit dem Satz: „Auf den übrigen Schachtanlagen alles ruhig.“123 Die Regierung sah denn auch zu diesem Zeitpunkt keine Veranlassung für die Entsendung von Truppen. Ein Grund dafür war sicher auch, dass sie „massenhaft“ ähnliche Hilferufe erhielt, wie Wieland seinem Korrespondenzpartner Reusch zum wiederholten Male schrieb. Der liberale Abgeordnete aus Württemberg sang nun ein Loblied auf Noske: „Soviel steht fest, und Noske hat dies schon wiederholt bewiesen, dass er gewillt ist, energisch zuzufassen.“ Leider würden die Behörden vor Ort nicht überall mitspielen; sie hätten sich in Baden kürzlich erneut auf Verhandlungen mit „den Spartakisten“ eingelassen. „Man sieht eben, wie außerordentlich schwierig es ist, die in der Revolution entstandenen Zustände wieder in geregelte Bahnen zu lenken.“ Wieland war aber Realist genug, um zu wissen, dass man in der angespannten Situation alle Provokationen vermeiden musste. Deshalb war er gegen die Abschaffung der Arbeitslosenfürsorge – dem von Reusch empfohlenen Mittel, um „den Faulenzern“ Beine zu machen – zum jetzigen Zeitpunkt, auch wenn er grundsätzlich diesem Schritt einiges abgewinnen konnte. „Diese Radikalkur jetzt anzuwenden, ist meines Erachtens ein Ding der Unmöglichkeit, denn es hieße dem jetzt neuerdings mit Waffengewalt … niedergeworfenen Bolschewismus mächtig auf die Beine helfen.“ Wieland erkannte auch an, dass in den aktuellen Sozialisierungsverhandlungen für die Arbeiter „etwas Greifbares“ herauskommen musste. Deshalb sprach er sich, wie Reusch in einem früheren Brief, für eine Gewinnbeteiligung der Arbeiter durch Belegschaftsaktien aus. Scharf kritisierte er das taktisch sehr ungeschickte Auftreten von Vögler und Hugenberg bei der Sozialisierungsdebatte in der Nationalversammlung. Er meinte auch, dass man – wenn schon – nicht nur den Absatz, sondern auch die Erzeugung der Kohle sozialisieren müsse.124
Reusch widersprach an dieser Stelle vehement. „Ich bitte Sie dringend, sich von diesen Ideen frei zu machen und auf Ihre Fraktionskollegen dahingehend einzuwirken, dass sich das Reich auf die Sozialisierung des Absatzes beschränkt.“ Er war jetzt auch strikt gegen eine Gewinnbeteiligung der Arbeiter. Das würde die Unzufriedenheit auf die Dauer nur vergrößern, da der Einzelne nicht viel zu erwarten hätte. Zu den Lohnstreitigkeiten kämen dann die Streitigkeiten über die Gewinnbeteiligung hinzu. Die Konzernleitung käme „schließlich aus den Verhandlungen mit den Arbeitern und aus den Unruhen überhaupt nicht mehr heraus.“ Was die Sechs-Stunden-Schicht anging, konnte er zwar – nicht ohne Stolz – berichten, dass der kurze Streik auf der Zeche Sterkrade „durch energisches Vorgehen und verständiges Eingreifen des Arbeiterausschusses“ beendet worden sei. Aber er rechnete mit neuen Unruhen und bedauerte deshalb sehr, dass die Truppen schon wieder abgezogen waren. Die aus den Gefängnissen entlassenen Führer der linksradikalen Gruppen seien schon wieder dabei „zu wühlen“. „Wenn sie heute die sechsstündige Schicht erzwungen haben, dann werden sie morgen wieder neue Forderungen stellen und erzwingen und auf diese Weise allmählich aber zielbewusst das ganze wirtschaftliche Leben lahmlegen.“ Die Regierung habe diese Gefahr besonders für das westliche Industriegebiet leider nicht genügend im Auge.125
Reusch blieb also bei seiner im Grunde ganz einfachen Strategie: Keinerlei neue Zugeständnisse an die Arbeiter, Zurückdrehen der bereits erreichten sozialen Errungenschaften und rigoroser Einsatz des Militärs gegen Unruhestifter.
Seine Werksleiter dagegen bemühten sich im direkten Kontakt mit den Arbeitern wenigstens um einen verbindlichen Ton. Sie wussten auch, dass sie bei den ganz konkreten Fragen der Arbeitsbedingungen Zugeständnisse machen mussten. So fand Direktor Ernst Lueg sehr freundliche Formulierungen, als er zu Beginn der Sitzung des Arbeiterausschusses im Walzwerk Neu-Oberhausen die wiedergewählten Mitglieder begrüßte. In der Sache jedoch blieb er hart: Obwohl die Erhöhung des Kohlepreises große „Missstimmung hervorgerufen“ hatte, ließ er sich nicht auf eine Senkung ein, da „die Hütte“ schon jetzt bei jeder Tonne Kohle, die sie für die Arbeiter heranschaffte, 16 Mark Verlust mache. Bei der von der Belegschaft erhofften Lieferung von Lebensmitteln aus Holland konnte er nichts tun. Eine Bezahlung der wegen des Streiks im Bergbau ausgefallenen Schichten lehnte er ab. Schließlich hielt er dem Ausschuss eine Tabelle mit genauen Zahlen vor, wonach die Produktivität in seinem Werk auf weniger als ein Drittel der Leistung von 1915 gesunken sei. Die Arbeitervertreter blieben trotz allem höflich und zurückhaltend. Ihr Sprecher Oberdries betrachtete jedoch vor allem die Frage des Kohlepreises nicht als erledigt. „Wenn wir wieder geordnete Verhältnisse haben, werden wir auf unsere Wünsche zurückkommen.“126
In der Sitzung des neu gewählten Arbeiterausschusses im Werk Sterkrade ging es wenige Tage später fast ausschließlich um Lohnfragen, vor allem bei den spezialisierten Anstreichern und den Brückenbauern. Direktor Wedemeyer verhandelte zäh, aber auch geduldig und stimmte am Ende Lohnerhöhungen für bestimmte Gruppen zu. Zu einer Konfrontation kam es auch dann nicht, als sich Wedemeyer zu einem kurzen Stoßseufzer über die allzu zu große Nachgiebigkeit in anderen Firmen hinreißen ließ: „Leider zahlen ja manche Werke unbedenklich alles, was verlangt wird. Die betreffenden Unternehmer versündigen sich dadurch nicht nur an der Volkswirtschaft, sondern auch an den Arbeitern selbst.“ Ein nur bei dieser Sitzung anwesender Arbeiter aus dem Brückenbau konterte trocken: „Wir verlangen ja nichts Unbilliges. Wir wollen nur soviel haben, um uns nähren und kleiden zu können.“127
Die im Walzwerk Neu-Oberhausen geäußerte Sehnsucht nach „geordneten Verhältnissen“ ging zunächst nicht in Erfüllung. Bereits am 1. April 1919 wurden die Verhältnisse wieder höchst ungeordnet, als eine von der „Neunerkommission“ einberufene Delegiertenkonferenz der Bergarbeiter beschloss, erneut den Generalstreik auszurufen – ein Beschluss, der nur deshalb möglich wurde, weil die sozialdemokratisch orientierten Vertreter im Februar aus der „Neunerkommission“ ausgetreten waren. Mit dem Generalstreik sollten u. a. die folgenden Forderungen durchgesetzt werden: Sofortige Einführung der Sechsstundenschicht für Untertagearbeiter bei vollem Lohnausgleich; 25% Lohnerhöhung; Anerkennung des Rätesystems; Freilassung aller politischen Gefangenen; Bildung einer revolutionären Arbeiterwehr; Auflösung der Freikorps; Aufnahme diplomatischer Beziehungen zur Sowjetrepublik; Entwaffnung der Polizei; Bezahlung der Streikschichten.128 Die Bewegung der Bergarbeiter war zu diesem Zeitpunkt „nicht nur dem Einfluss der Gewerkschaften und der SPD, sondern auch der besonneneren Kommunisten entglitten“.129 Die großen Bergarbeiterverbände distanzierten sich denn auch von diesem Aufruf.
Vielleicht deshalb begannen die Streiks auf den Oberhausener Zechen erst mit Verzögerung: Am 2. April zunächst auf den Zechen Jacobi und Sterkrade und bei Concordia auf Schacht II und III. Einen Tag später waren alle GHH-Zechen (außer Osterfeld130) im Ausstand. Die Regierung verhängte den Belagerungszustand; General Watter gab dies in großen Zeitungsanzeigen bekannt.131 Reusch war in den ersten Apriltagen in Holland, reiste dann direkt nach Berlin und kommentierte die Vorgänge von dort aus. Bemerkenswert sei, dass von dem „General“-Streik nur die Kohlegruben, nicht aber die Stahlwerke betroffen seien. Wenn nur „die Regierung festbleibt“, würden auch die Bergarbeiter in Kürze die Arbeit wieder aufnehmen. 95% der Belegschaft seien arbeitswillig. „Die Leute wurden jedoch in den letzten Tagen durch Agitatoren, welche aus Berlin angereist kamen, derartig verhetzt, dass sie nicht mehr in den Händen der besonnenen Führer waren.“ Hauptzielscheibe seiner Kritik an den Berliner Politikern war dieses Mal Scheidemann. „Dieser Mann“ würde Deutschland unweigerlich „zugrunde richten“. In einem direkten Appell an den Abgeordneten der Nationalversammlung meinte er: „Wenn Sie schon einen Sozialdemokraten als Ministerpräsidenten haben müssen, dann machen Sie wenigstens Noske dazu.“ Ganz so bedrohlich schätzte der GHH-Chef aber die Lage wohl doch nicht ein, denn er wollte in Kürze einen zweiwöchigen Urlaub auf seinem Katharinenhof bei Backnang in Württemberg antreten.132
Der Zechenverband platzierte riesige Anzeigen in die Zeitungen, um die Bevölkerung mit apokalyptischen „Warnungen“ in seinem Sinne „aufzuklären“.133 Der Belagerungszustand und der öffentliche Druck schien die Bergarbeiter in Oberhausen wenig zu beeindrucken: Am 11. April waren alle Oberhausener Zechen im Ausstand.134 Damit war aber der Höhepunkt erreicht; es wurde geschätzt, dass 75% aller Bergarbeiter des Ruhrgebiets um die Monatsmitte streikten; in der zweiten Aprilhälfte flaute die Streikwelle überall ab. Für die Oberhausener Zechen wurde am 22. April gemeldet, dass alle Bergleute wieder angefahren seien.135
Die Unterbrechung der Kohleförderung zog zwangsläufig Produktionseinschränkungen in den anderen Betrieben der GHH nach sich. Im Werk Sterkrade war dies einziges Thema einer Sondersitzung des Arbeiterausschusses, wobei von den Arbeitern die volle Bezahlung der Streikschichten verlangt wurde, da die Sterkrader Arbeiter „mit Ausnahme eines verschwindenden Prozentsatzes gegen den Streik“ seien. Die Werksleitung machte natürlich keine derartigen Zusagen.136 In der Sitzung des Arbeiterausschusses der Eisenhütte Oberhausen war von keinen derartigen Produktionseinschränkungen die Rede. Es wurde lediglich kurz über die angebliche Beschäftigung von streikenden Bergleuten auf der Hütte gesprochen. Direktor Schmidt versprach, dies zu unterbinden, sobald derartige Fälle bekannt würden. Überwiegend ging es bei dieser Sitzung um Lohnfragen und andere Details der Arbeitsbedingungen, wobei sich die Direktoren – ganz anders als ihre Kollegen Wedemeyer und Lueg – wenig kompromissbereit verhielten. Dies mochte seine Ursache in der angespannten Atmosphäre des großen Bergarbeiterstreiks haben, wurde aber der disziplinierten Haltung der Hüttenarbeiter nicht gerecht. Auffallend ist auch der mehrfache Hinweis, dass Streitfragen der Hauptverwaltung vorgelegt werden mussten.137 Im Werk Sterkrade ging es während des „Generalstreiks“ u. a. auch um die Einführung einzelner Urlaubstage für die Arbeiter. Ein bei der Sitzung anwesender Gewerkschaftssekretär brachte dieses Thema zur Sprache. Direktor Wedemeyer wich erschrocken aus: Diese Frage müsse er erst Reusch persönlich vortragen.138 Man darf also annehmen, dass Reusch über die Situation in den einzelnen Werken gut informiert war.
Das überraschend schnelle Abflauen des Massenstreiks in der zweiten Aprilhälfte war sicherlich auch ein Erfolg des Verhandlungsgeschicks, mit dem der neu eingesetzte Reichskommissars Severing an die Sache heranging. Reusch aber blieb stur bei seiner Linie, dass mit den Streikenden nicht verhandelt werden dürfe. Der Generalstreik sei schon „auf dem besten Wege [gewesen] abzuflauen“, als der Reichskommissar wieder „Unruhe in die Belegschaft“ gebracht habe. „Hätte die Regierung jede weitere Verhandlung mit den Streikenden abgelehnt, so hätten sicher alle Bergleute am Dienstag die Arbeit wieder aufgenommen.“ Aus dem Brief sprach auch der Ärger über die lästigen Streikfolgen, von denen Reusch ganz persönlich betroffen war: Er wollte über Ostern Urlaub auf seinem schwäbischen Schloss Katharinenhof machen; wegen des Kohlemangels war es aber ungewiss, ob überhaupt Züge nach Süddeutschland fahren würden.139
Als Reichskommissar Severing für das ganze Ruhrgebiet das Ende des Streiks bekanntgab, mussten sich die Initiatoren im Grunde eingestehen, dass sie keines der vollmundig verkündeten Ziele erreicht hatten. Aus der Sicht der Reichsregierung konnte über die politischen Forderungen überhaupt nicht verhandelt werden; für das Ziel einer weiteren Arbeitszeitverkürzung würde sich die Regierung aber mit aller Kraft einsetzen.140
In der Zwischenzeit hatten die Meldungen von den blutigen Kämpfen in München den Bergarbeiterstreik, der in Oberhausen glücklicherweise unblutig verlief, von den Titelseiten verdrängt. Das grausame Blutbad in der bayrischen Hauptstadt trug zweifellos dazu bei, dass sich „in weiten Kreisen der Bergarbeiterschaft … eine tief reichende Erbitterung“141 breit machte. Das sah Reusch, hier übrigens im Gleichklang mit seinem württembergischen Gesprächspartner Wieland, natürlich ganz anders. Wieland lobte Noske in den höchsten Tönen, weil es ihm gelungen war, die Aufstände im Ruhrgebiet, in Halle, Berlin und Magdeburg gleichzeitig niederzuschlagen. Als Kontrast zeichnete er „das tieftraurige Bild Bayerns“. Vor dem Eingreifen der von der Reichsregierung entsandten Truppen „spotteten [die Zustände in München] jeglicher Beschreibung.“ Die „Pöbelherrschaft“ sei so weit gegangen, „die Frauen für vogelfrei zu erklären“.142 Reusch bekräftigte diese Einschätzung: „Noske ist bis jetzt der Einzige, der etwas positives geleistet hat. Seine Schaffung der Freikorps war eine Tat, die uns vor dem vollständigen Untergang rettete.“ Selbst eine „Diktatur Noske“ hielt er für erwägenswert, allerdings nur für den von ihm für unwahrscheinlich gehaltenen Fall des Einmarsches der Truppen der Siegermächte.143
Nach dem Generalstreik im April zogen die Truppen nicht so schnell ab wie Anfang März. In den GHH-Betrieben wurden nach der Streikwelle vom April Freikorps-Soldaten stationiert, bis zum Mai das Freikorps Gabcke und danach das Freikorps Severin. Woltmann hielt seinen Chef auf dem Laufenden. In engem Kontakt mit den Freikorpsführern konnte er sicherstellen, dass die Truppen für mehrere Wochen in den GHH-Werken stationiert blieben.144 Als im Juni 1919 die Wellen wegen der Versailler Friedensbedingungen hochschlugen, befürchtete Reusch schon den Einmarsch der Franzosen ins Ruhrgebiet und als Folge den Abzug der Freikorps. Für diesen Fall sollte Woltmann die betriebliche „Schutzwache“ sofort wieder aufrüsten. „Die Auswahl der Leute muss in der sorgfältigsten Weise erfolgen, damit wir dieser unter allen Umständen sicher sind.“145 Mit den Soldaten im Rücken konnte Woltmann im Sommer einen Streik der Lokführer sehr schnell brechen. In seinem Bericht an Reusch betont Woltmann jedoch allein die Unterstützung in der Belegschaft: „Als ich des Rückhaltes der Arbeiterschaft sicher war, ging ich sehr scharf gegen die ausständigen Lokführer vor.“ Reusch vermerkte handschriftlich seinen Dank „für Ihr energisches Vorgehen“.146 Die Dokumente geben keine konkrete Auskunft darüber, welcher Art dieses „energische Vorgehen“ war.
Die Niederschlagung der April-Streiks wird allgemein als Ende der Revolution angesehen. In der Tat macht es Sinn, an dieser Stelle eine Zäsur zu setzen, da ab Mai 1919 die erhitzten Diskussionen um den Versailler Friedensvertrag alle anderen politischen Themen in den Hintergrund drängten. Die sozialen und wirtschaftlichen Brandherde jedoch schwelten weiter, auch wenn aus der Revolution eine Lohnbewegung geworden war. Die stärkste Position hatten dabei die Bergarbeiter und die Eisenbahner, konnten sie doch mit einem Streik in kurzer Zeit große Teile des Wirtschaftslebens lahmlegen. Diese Probleme wurden von Männern wie Reusch pauschal der Republik angelastet. Sie weigerten sich zu sehen, dass die führenden Männer der Weimarer Republik die unlösbaren Probleme durchweg von ihren Vorgängern im Kaiserreich geerbt hatten. „Es war die politische Führung und die Bürokratie des alten Regimes, deren Versagen die Verstümmelung der Staatsfinanzen und die Zerrüttung des sozialen Systems erst ermöglicht hatte. Insofern erwuchs der infame Vergleich zugunsten des alten Regimes, dessen Kurswert proportional zum Versagen Weimars stieg, aus einer Mischung von Nostalgie, Illusion und unverhohlener Boshaftigkeit.“147
Als Ergebnis der Untersuchungen kann für Reuschs Rolle in der Revolutionsperiode Folgendes festgehalten werden:
- Reusch vermied fast jegliches Engagement außerhalb der Betriebe seines Konzerns. Lediglich intern äußerte er sich, dann allerdings sehr massiv, zu politischen Fragen.
- In den Betrieben seines Konzerns sorgte er dafür, dass nur die Zugeständnisse gemacht wurden, die absolut unvermeidlich waren. Er erkannte nicht, dass die gemäßigten Arbeitervertreter spürbare Verbesserungen erreichen mussten, um zu verhindern, dass große Teile der Arbeiterschaft ins Lager der Radikalen abwanderten.
- Für Streiks fehlte ihm natürlich jedes Verständnis. In seinen Hilferufen an die Reichsregierung übertrieb er die Auswirkungen der mit den Streiks bisweilen verbundenen Unruhen manchmal in grotesker Weise.