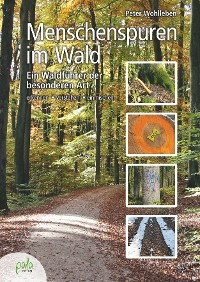Kitabı oku: «Menschenspuren im Wald», sayfa 2
Plenterwald: die urwaldähnlichste Wirtschaftsform
Wenn Sie durch einen Wald spazieren, in dem kleine und große, dicke und dünne Bäume aller Altersgruppen und Durchmesser innig gemischt auftreten, dann sehen Sie einen Plenterwald. Er ist die urwaldnächste Wirtschaftsform. Bäume jeglicher Größe stehen bunt gemischt zusammen und bilden eine pflanzliche Sozialgemeinschaft. In der Regel stehen hier heimische Baumarten wie Buchen, Weißtannen und Eichen, allenfalls gelegentlich durch einzelne Douglasien, Fichten oder Kiefern ergänzt. Einen herkömmlichen Forst in einen Plenterwald zu überführen, dauert etwa 100 Jahre. Anschließend verändert sich das Waldgefüge über viele Jahrhunderte nicht mehr – ganz so wie in einem Urwald. Und doch ist der Plenterwald eine Kunstform. Im Gegensatz zum Urwald fehlt ihm Totholz, selbst wenn der eine oder andere Baum hier sein Leben zu Ende leben darf und dann verrottet. Das meiste Holz soll schließlich geerntet und teuer verkauft werden. Aus diesem Grund fehlen auch ganz alte Exemplare, die ja meist im Inneren schon Pilzbefall aufweisen und dann wirtschaftlich wertlos werden.

Kleine und große Nadelbäume bunt gemischt – so kann im Alpenraum ein Plenterwald aussehen.
Die gesamte Biomasse beträgt in einem Plenterwald höchstens die Hälfte des wilden Vorbilds, sodass es in ihm viel heller ist (weniger Bäume = mehr Licht am Boden). Für manche Urwaldarten unter Käfern und Spinnen ist er dadurch kein geeigneter Lebensraum mehr. Dennoch – ökologischer kann man nicht wirtschaften, und daher sind Plenterwälder, durchsetzt mit Schutzgebieten, die sinnvollste und schonendste Form der Forstwirtschaft. Leider sind sie hierzulande nur auf wenigen Prozent der Waldfläche zu finden.

Spuren auf dem Boden lesen
Waldboden ist etwas Kostbares. Er entstand während der Eiszeiten und wurde durch das Schmirgeln der Gletscher, durch Frosteinwirkung und das Verblasen von Staub durch Stürme zu einem lockeren, schwammartigen Gebilde. Durch unzählige Poren dringt Luft metertief hinab und ermöglicht eine noch nicht ansatzweise erforschte Artenvielfalt von Tieren, Bakterien und Pilzen. Zugleich versickert in den zarten Kanälchen jeder noch so heftige Regenguss und wird wie in einem Tank gespeichert. Anschließend können sich die Bäume mit ihren Wurzeln daran bedienen und manch trockene Sommerperiode überstehen, ohne zu verdursten. Solche Böden können Sie sogar erspüren, denn auf ihnen läuft es sich weich und federnd.
In den meisten Fällen sind die Waldböden jedoch nicht mehr im Originalzustand. Gleich mit der Rückkehr der Wälder nach der letzten Eiszeit vor rund 10 000 Jahren machten sich unsere Vorfahren daran, die Bäume wieder abzuholzen. Der Lebensstandard war gering, die Bevölkerungszahl im deutschsprachigen Raum erreichte kaum 50 000 Einwohner (ein Mensch pro zehn Quadratkilometer), sodass die Auswirkungen kaum spürbar waren. Doch bereits vor der Zeitenwende um Christi Geburt rodeten Kelten und später Römer ganze Höhenzüge. Mit den Wirren der Völkerwanderung konnte sich der Wald wieder erholen und verlorenes Terrain zurückerobern, doch dann ging es steil bergab. Um 1800 waren fast sämtliche Ebenen und die meisten Mittelgebirge kahl, lediglich in Hochlagen und in abgelegenen Winkeln, die sich nicht für die Landwirtschaft eigneten, überlebten klägliche Restwälder. Danach setzte die geregelte Forstwirtschaft ein, und so konnten die Bäume zurückkehren – ein Trend, der bis heute anhält.

Lockerer Humus wirkt im Waldboden wie ein Schwamm und ermöglicht vielfältiges Bodenleben.
Die wechselvolle Geschichte führte dazu, dass die meisten Böden auch heute noch Spuren menschlicher Aktivitäten aufweisen und in ihrer Funktion massiv gestört sind. Der Grund ist die erwähnte schwammartige Struktur. Dieser »Bodenschwamm« ist viel empfindlicher als ein Haushaltsschwamm. Denn während Letzterer sich nach dem Zusammendrücken rasch wieder aufrichtet, kann das ein Waldboden nicht. Nie mehr. Erst wenn die nächste Eiszeit über ihn hinweggeht, wird das Gefüge wieder locker und leistungsfähig werden. Durch seine Empfindlichkeit ist der Boden wie ein großes Archiv. Er speichert all unsere Aktivitäten für sehr lange Zeit in sich, verändert sich mit jedem Eingriff dauerhaft und es lässt sich noch nach Generationen wie ein offenes Buch in ihm lesen.

Noch Jahrzehnte später sind die verrottenden Reisigwälle als Folgen der Kahlschläge zu erkennen.
Folgen der intensiven Bodenbearbeitung
In vielen jüngeren Wäldern können Sie flache, humusreiche Wälle sehen. Sie ziehen sich schnurgerade über die Flächen und sind baumfrei. Ursache ist eine dramatische Änderung der Forstwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Zunehmend wurden Maschinen nicht nur auf landwirtschaftlichen Flächen, sondern auch zur gezielten Veränderung von Waldböden eingesetzt. Was konnte man nicht alles mit den neuen Traktoren, Baggern und Raupen bewegen? Sie passten hervorragend zur damals aktuellen Kahlschlagswirtschaft und halfen, sie zur Perfektion zu treiben.
Waren alle Bäume beseitigt worden, dann herrschte zunächst ein Chaos. Überall lagen Baumkronen herum, die eine planmäßige Bepflanzung der Fläche erschwerten. Kein Problem – eine schwere Planierraupe wurde herbeigeschafft und deren Schild durch eine riesige Gabel ersetzt. Mit dieser räumte das Gerät die Fläche blitzblank sauber, indem es den sogenannten Schlagabraum, also Äste, Stammteile und Wurzelstöcke, auf lange Reihen zusammenschob. Dazwischen war nun alles glatt wie ein Salatbeet und bereit für neue Setzlinge aus der Baumschule. Ich selbst durfte das Verfahren noch während der Ausbildung erleben, und obwohl schon damals die daraus resultierenden Bodenschäden bekannt waren, haben sich meine Lehrförster keine Gedanken darüber gemacht. Im Gegensatz zum Harvestereinsatz (mehr dazu ab Seite 34), bei dem »nur« 50 Prozent des Bodens verändert werden, waren es bei solchen Einsätzen 100 Prozent. Bis heute sind diese ehemaligen Wälle mit Schlagabraum zu erkennen, selbst wenn dieser schon zu Humus geworden ist (siehe Foto auf Seite 26).
Doch das war noch nicht alles. Um überall Fichten pflanzen zu können, musste so mancher Boden entwässert werden. Auf solchen Feuchtstandorten wären zwar Erlen, Eschen oder Ahorn die bessere Wahl gewesen, doch statt die Baumwahl dem Boden anzupassen, machte man es häufig umgekehrt.
Fichten vertragen keine Staunässe im Erdreich, und daher forderten die Förster große Bagger an. Sie zogen kreuz und quer Entwässerungsgräben, um alles trockenzulegen. Der Erfolg war mäßig: Schon ein bis zwei Meter neben dem Graben wurde der Boden wieder nass, die Fichte bekam auf diesen Parzellen in späteren Jahren erhebliche Probleme durch nasse »Füße«. Der hässliche Nebeneffekt war, dass der Boden nun nach Holzernte und Schlagräumung zum dritten Mal komplett befahren wurde. Schade – so blieb garantiert kein Fleckchen unzerstört. Scheinbar haben manche Kollegen immer noch nichts hinzugelernt, denn in letzter Zeit lebt diese Art der Bodenbehandlung wieder auf.

Für die wasserscheue Fichte wurden hier eigens Entwässerungsgräben gebaggert.
Ein letzter, immer noch weit verbreiteter Eingriff ist das Grubbern. Dabei wird mit einem Traktor ein zinkenbewehrtes Gerät über den Boden geschleift, um ihn aufzureißen. Anders könnten Buchen- oder Tannensamen nicht keimen, so die Meinung vieler Förster. Die dicke Laubschicht aus dem letzten Herbst hindere die zarten Wurzeln daran, den Boden zu erreichen. Und wie, bitteschön, hat das der Wald seit Jahrmillionen ohne Menschen hinbekommen?
Natürlich geht es auch ohne die Hilfe des Menschen, aber vielleicht nicht ganz so gleichmäßig über jeden Quadratmeter verteilt. Wo der Urwald kleine Gruppen, quasi Baumkindergärten, vorsieht, da soll ein Rasen aus Keimlingen ohne jede Lücke entstehen. Der Nebeneffekt des Grubberns ist jedoch eine Beschädigung des Oberbodens. Schädlich ist nicht nur das Gewicht der schweren Maschinen, sondern auch das Aufreißen der empfindlichen Humusschicht mit ihren lichtscheuen Bewohnern, die nun unsanft das Licht der Sonne erblicken. Nebenbei baut sich die organische Substanz des Bodens rascher ab – mit all den negativen Folgen für den Nährstoff- und Wasserhaushalt des Waldes.
Fahrspuren schwerer Forstmaschinen
Schlammige, teilweise über 50 Zentimeter tiefe Fahrspuren schwerer Forstmaschinen regen viele Waldbesucher auf – mich auch. Waldwirtschaft ist nun einmal kein Naturschutz, und irgendwie muss das Holz an die Wege transportiert werden. Doch warum wird dann nicht wenigstens auf besseres Wetter gewartet, etwa Trockenheit oder starken Frost? Es sind die Sägewerke und Holzkäufer, die eine Lieferung rund ums Jahr verlangen. Die Lagerkapazitäten in den Werken, die nur unnötig Zinsen kosten, wurden auf wenige Wochen Vorlauf heruntergeschraubt und es wurde auf Just-in time-Produktion umgestellt. So gesehen befindet sich das Sägewerkslager heutzutage im Wald, und dort wird bei jeder Wetterlage abtransportiert, weil sonst die Bänder stillstehen. Und Forstbetrieben, die da nicht mitspielen möchten, wird damit gedroht, dass sie auf ihrer Ware sitzen bleiben werden. Davon abgesehen, gibt es durch den Klimawandel immer seltener gefrorene Wege, und die Verlagerung des Holzeinschlags in die Sommermonate ist aus Vogelschutzgründen problematisch – schließlich sind in etlichen Baumkronen belegte Nester.

Solche tiefen Fahrspuren gehören leider häufig zur modernen Forstwirtschaft.

Während hier ein Grundbruch eintritt, …
Die Forstindustrie hat auf die Proteste gegen die tiefen Fahrspuren reagiert: Die Reifen der Maschinen werden immer breiter, sodass der Druck pro Quadratzentimeter sinkt. Dadurch verursachen sie weniger Spuren, zudem bleiben die Schneisen länger und besser befahrbar. Dem Waldboden nützt das leider kaum etwas, ganz im Gegenteil: Je breiter die Reifen, desto größer ist die Tiefenwirkung im Boden – bis zu zwei Meter. Das gesamte schwammartige Gefüge, von Milliarden Kleinstlebewesen bevölkert, wird innerhalb von Sekunden zerquetscht und wie mit einer Rüttelplatte verdichtet. Die Poren verschwinden, das Bodenleben erstickt. Zudem verliert das Erdreich seine Wasserspeicherfähigkeit, die sich in den Fahrspuren um bis zu 95 Prozent reduziert. Starke Regenfälle versickern nicht mehr, sondern laufen oberirdisch in die Bäche ab und sorgen in den Tälern für häufigere Hochwasser. Das wertvolle Nass fehlt den Bäumen in Trockenperioden, in denen sie sich normalerweise an den Wasserreserven im Untergrund bedienen. Tief kommen sie mit ihren Wurzeln ohnehin nicht mehr, weil diese ebenfalls in der sauerstoffarmen Verdichtungszone absterben.

… ist hier später kaum etwas zu sehen. Die Verdichtungsschäden in der Tiefe sind dennoch ähnlich.
Die Schwere der Schäden lässt sich anhand des Spurenbilds abschätzen. Können Sie nur schwache Reifenspuren erkennen, dann war der Boden zum Zeitpunkt des Befahrens wenigstens unter rein mechanischen Gesichtspunkten tragfähig. Das ist bei trockenem oder sehr frostigem Wetter der Fall. Haben sich die Reifen dagegen stärker eingedrückt, sodass durchgehende »Gleise« erkennbar sind, dann spricht man von einer plastischen Verformung. Ganz ungünstig ist der sogenannte Grundbruch, der bei Maschineneinsätzen nach längeren Regenperioden auftritt (siehe Abbildung auf Seite 30, oben). Hier wird die natürliche Bodenschichtung durchbrochen, und es kommt zu seitlichen Aufwölbungen neben der Spur. Auch wenn die letztere Variante die brutalste ist, so sind doch vor allem die nicht sichtbaren Schäden in der Tiefe entscheidend. Und die entstehen selbst bei schwach ausgeprägter Spurbildung, wenn auch nicht ganz so stark.
Bei lehmhaltigen Böden (z. B. Braunerden) können Sie das mit einem Spaten selbst überprüfen: Während bei intakten Böden auch in 20 Zentimeter Tiefe ein hellbraunes, krümeliges Gefüge zu sehen ist, beginnt hier bei geschädigtem Erdreich eine Todeszone. Sie zeigt sich durch eine graue Farbe, durchsetzt mit Rostflecken. Hier herrscht Sauerstoff- und Wassermangel, bei dem alles Leben erstickt und verdurstet.
Diese Verdichtungen werden durch eine Armada modernster Maschinen verursacht, von denen ich Ihnen auf den folgenden Seiten ein paar vorstellen möchte. Zunächst schauen wir uns jedoch die Rückegassen (siehe Foto auf Seite 32) an, weil sie mittlerweile die entscheidende Infrastruktur im Wald sind.

Unter der Rückegasse ist der Boden irreparabel verdichtet.
Verdichtungen in Rückegassen
Von den meisten Waldwegen in ebener Lage zweigen in regelmäßigen Abständen Schneisen mit Fahrspuren ab. Dies sind keine Wege, sondern sogenannte Rückegassen. Als »Rücken« wird der Holztransport aus dem Baumbestand an den nächsten befestigten Weg bezeichnet, doch das ist nur ein Teilaspekt solcher Linien. Auf ihnen fahren zunehmend Erntemaschinen (Harvester), die verschiedene Arbeiten der Waldarbeiter übernehmen. Sie besitzen ebenso wie die anschließend anrollenden Rückefahrzeuge (Forwarder) Kranarme, die etwa neun Meter Reichweite haben. Damit sie nun jeden Baum erreichen können, dürfen die Gassen maximal 20 Meter auseinanderliegen. Bei einer Breite von mindestens vier Metern bleibt dann dazwischen ein Streifen von 16 Metern mit Bäumen, die der Greifer alle erfassen kann. Dies bedeutet, dass 20 Prozent des Bodens direkt befahren und zerstört werden. Doch da die Verdichtungen durch Seitendruck im Untergrund noch eineinhalb bis zwei Meter nach links und rechts hinausragen, kommen wir schon auf bis zu 40 Prozent Schäden.
Vielleicht haben Sie Lust, beim nächsten Waldspaziergang einmal einen Test zu machen: Messen Sie mit Ihren Schritten die Entfernung von Gasse zu Gasse ab. Ich kann mich selten zurückhalten und kontrolliere das aus Neugier häufig: Meist sind es weniger als 20 Meter, oft sogar kaum zehn Meter. Im Durchschnitt dürften es 50 Prozent geschädigter Waldboden sein, den eine einzige Durchforstung mit Maschinen zurücklässt. Nachhaltigkeit sieht anders aus, doch gegenüber dem Einsatz von Waldarbeitern lassen sich so bis zu zehn Euro pro Kubikmeter Holz einsparen. Die Kollateralschäden durch ein anschließend schlechteres Baumwachstum (unter anderem wegen des Wassermangels) liegen locker beim Doppelten, doch das fließt in keine Bilanz mit ein.
Wie könnte ein Kompromiss aussehen? In meinem Revier hat die Gemeinde Hümmel den Gassenabstand auf mindestens 40 Meter erhöht; im Durchschnitt liegt er bei über 50 Meter. Und weil hier nun der Greifarm nicht mehr an alles Holz heranreicht, muss ein Pferd die weiter entfernten Stämme vorliefern. Doch selbst dieses Verfahren bedeutet einen gewissen Anteil geschädigter Böden. Wäre es nicht besser, gar keine Gassen mehr zu haben? Das ist auch eine betriebswirtschaftliche Frage, denn je größer die Entfernung bis zum nächsten Weg, desto teurer sind die Rückekosten. Ohne Gassen müsste alles mittels Seilwinde oder per Pferd über weite Strecken gezogen werden, was die Leistung pro Stunde deutlich herabsetzte. Aktuell ist es bei ökologisch geführten Forstbetrieben Konsens, dass ein 40-Meter-Abstand nicht unterschritten werden sollte.
Noch viel wichtiger ist es, dauerhaft dieselben Gassen zu benutzen. Wird alle paar Jahre (oder Jahrzehnte) eine andere Trasse gewählt, dann ist der Wald irgendwann komplett befahren. Genauso muss darauf geachtet werden, dass die Maschinen bei der Arbeit die Spur nicht verlassen. Wie oft geschieht es, dass die Fahrer an einen Stamm nicht heranreichen und dann einfach fünf oder zehn Meter zwischen die Bäume fahren, um das Holz doch noch ernten zu können. Solch eine Praxis verursacht zusätzliche Verdichtungen und weitere Schäden (mehr dazu auf Seite 81). Abhilfe schafft eine Konventionalstrafe, die pro angefangene 10-Meter-Abweichung von der Gasse 100 Euro kostet. Diese Karte habe ich in meinem Revier bisher zweimal ziehen müssen, und die betreffenden Traktorfahrer konnten anschließend ihren Hut nehmen.
Erosion des Waldbodens durch Harvester und Forwarder
Ein Harvester ist eine Vollerntemaschine, die Bäume fällen und aufarbeiten kann. Ihr Greifarm ist dazu mit einer Motorsäge ausgestattet sowie mit Zangen, die den Baum packen und nach dem Absägen durch Messer ziehen. Dadurch werden die Äste abgetrennt, der Stamm kann dann in die gewünschten Längen zerteilt und an der Rückegasse abgelegt werden. Der betriebswirtschaftliche Vorteil liegt in der Geschwindigkeit. Wo vormals zwölf Waldarbeiter Hand anlegen mussten, reicht nun ein einzelner Harvester mit Fahrer. Da die Maschine mit starken Scheinwerfern bestückt ist, kann sie im Mehrschichtbetrieb auch nachts betrieben werden.
Um den Stamm durch das Aggregat zu schieben, sind an diesem Stachelwalzen montiert. Sie werden ans Holz gedrückt und drehen sich dann, sodass der Baum vorwärts rückt. Die Abdrücke dieser Walzen können Sie in dem aufgearbeiteten Holz am Wegesrand sehen – die Stämme sehen aus wie mit Schmucknarben verziert.

Schneller und billiger auf Kosten der Umwelt: der Harvester.

In den Spuren des Harvesters rauschen bei Regen die Niederschläge ins Tal und nehmen den Waldboden dabei mit.
Mittlerweile gibt es sogar Hangharvester, die sich einfach abseilen. Dazu wird ein starker Baum oberhalb des Wegs gesucht, an dem das Drahtseil befestigt wird. Hat der Baum Glück, dann werden Gurte zur Druckminderung verwendet, obwohl auch so die Rinde erheblich beschädigt wird. So gesichert, kann sich die Maschine mittels der eingebauten Winde selbst in Richtung Tal ablassen und später auch wieder heraufziehen. Ich bedauere diese Entwicklung sehr, denn gerade im Hang verursachen die Fahrspuren eine starke Bodenerosion. Das Regenwasser läuft in den Rillen ungebremst bergab und reißt dabei jede Menge Erde unwiederbringlich mit. Forwarder und Harvester bilden in der Regel ein Gespann. Hat die Erntemaschine alle Bäume gefällt und in handliche Teilstücke zersägt, dann rollt der Forwarder über dieselben Rückegassen und sammelt das Holz ein. Dadurch steigt das Fahrzeuggewicht auf bis zu 30 Tonnen an. Die Fahrspuren werden nochmals deutlich vertieft und vor allem überdeckt. Der Abdruck des Reifenprofils stammt daher bei abgeschlossener Holzernte immer vom Forwarder. Ist es besonders nass und schlammig, dann werden häufig Ketten oder Bänder auf die Räder gezogen, um die Haftung zu erhöhen und den Bodendruck etwas zu reduzieren. Die Spuren wirken dann wie ein durchgehacktes Beet, erscheinen aber zumindest optisch ein wenig harmloser, da sie nicht so tief gehen.

Mit aufgezogenen Bändern auf den Rädern kann der Forwarder auch diesen Hang befahren.
Unterwegs mit 1 PS
Wenn ich durch den Wald streife und von Ferne ein kleines Glöckchen bimmeln höre, dann freue ich mich. Meist ist dazu noch ein unverständliches Gebrabbel zu hören, wie etwa »Jöö – hüü – hee«. Kurz darauf knackt und kracht es ein wenig, und ein Rückepferd mit Besitzer bricht aus dem Unterholz, im Schlepptau einen Baumstamm. Solche Gespanne arbeiten schon seit Jahrtausenden in den Wäldern, und man kommt sich wie in einem Freilichtmuseum vor, wo für Besucher alte Arbeitsverfahren demonstriert werden. Doch auch oder gerade heute hat das Rückepferd seine Berechtigung im Wald, denn es arbeitet sehr schonend. Die zu ziehenden Stämme werden meist in Teile geschnitten, um das Gewicht zu verringern. Zudem lässt sich mit fünf Meter langem Kurzholz besser rangieren als mit 20 Meter Langholz. Steht eine Gruppe junger Bäume im Weg, so geht das Pferd einfach darum herum, anstatt wie eine Maschine hindurchzuwalzen. Ähnlich geht es im Slalom um große Bäume, sodass ein Anstoßen der Stämme und Rindenverletzungen vermieden werden. Es ist immer wieder eine Freude zu sehen, dass nach Pferdeeinsätzen praktisch keine Schäden im Wald zu finden sind.

Wie seit Jahrtausenden können Pferde auch heute noch sinnvoll in der Forstwirtschaft arbeiten.
Bis zum nächsten Waldweg ist es aber in der Regel doch zu weit – würde man die gesamte Strecke durch die Tiere erledigen lassen, dann bestünde ein Tagwerk nur aus wenigen Stämmen. Daher macht man Kompromisse und setzt auf eine Kombination von Pferd und Forwarder. Im Gegensatz zu einem reinen Maschineneinsatz wird der Abstand der Rückegassen von 20 Meter auf 40 bis 60 Meter erhöht, der Anteil befahrener Böden so von 50 Prozent auf unter 20 Prozent gedrückt. Und weil der Forwarder nur zehn Meter von der Gasse aus in den Bestand greifen kann, liefert ihm das Pferd die Hölzer, an die er nicht heranreicht.
Von Pferden vorgeliefertes Holz erkennen Sie an der Rückegasse daran, dass es hier zwar ordentlich liegt, aber noch frische Maschinenspuren fehlen. Ist es dann später mit dem Forwarder an den Waldweg transportiert worden, lässt es sich nicht mehr nachvollziehen, ob Tiere an der Arbeit beteiligt waren. Es sei denn, Sie pirschen noch einmal zwischen die Bäume zurück und schauen, ob es Abdrücke besonders großer Pferdehufe gibt. Die schweren Kaltblüter, die teilweise doppelt so viel wiegen wie ein Reitpferd, haben wirklich enorm große Füße. Sie sind ebenso wie die unteren Beinbereiche von dicken, langen Haaren bedeckt, die verhindern, dass sich die Tiere beim Gang durch Brombeeren und Reisig verletzen.

Vom Pferd vorgeliefertes Holz wartet an der Gasse auf den Forwarder.
Gibt es irgendetwas, das gegen den Einsatz von Pferden spricht? Für die Anhänger schwerster Maschinen auf jeden Fall. Da wäre zunächst das Argument der Verfügbarkeit. Gibt es überhaupt genügend Pferderücker? Dieser Berufsstand scheint vom Aussterben bedroht, denn wer möchte schon an 365 Tagen im Jahr für die Tiere da sein, sie füttern, misten und mit ihnen bei Wind und Wetter arbeiten? Die Bezahlung ist lediglich akzeptabel, reich wird davon niemand. Das Pferd muss mühsam ausgebildet werden, bis es nach einigen Jahren endlich voll mitarbeitet. Und damit landen Pferderücker nach Ansicht vieler Förster in der Nostalgieecke, aus der man sie lediglich zur Publikumsbelustigung bei Waldtagen wieder hervorholt.

Der Hufabdruck, den der große Fuß des Kaltblüters hinterlässt, geht nicht tief in den Boden und ist nach wenigen Jahren wieder zu lockerer Erde geworden.
Tatsächlich ist es so, dass viele Halter schwerer Arbeitspferde nur zu gern mit ihren Tieren im Wald arbeiten würden. Doch da sie kaum Aufträge bekommen, bieten etliche im Sommer Kutschfahrten an. Und da auch dies nicht ausreicht, muss ein normaler Job das Geld bringen, wodurch das Holzrücken zum Wochenendhobby wird.
Die Interessengemeinschaft Zugpferde (IGZ) vermittelt auf Anfrage gerne Adressen, sodass die Ausrede mancher Waldbewirtschafter, es gäbe keine ortsnahen Rückepferde, nicht gelten kann.
Das zweite Argument betrifft die Kosten. Und ja, es stimmt: Pferde sind tatsächlich teurer als Harvester, zumal das Holz vor dem Rücken von Waldarbeitern, also von Hand, aufgearbeitet werden muss (ein Harvester legt das Holz gleich an der Gasse ab, da gibt es nichts mehr vorzuliefern). Das macht pro Kubikmeter Holz bis zu fünf Euro an zusätzlichen Kosten. Teurer sind Pferde deswegen aber noch lange nicht, denn die Bodenschäden kann man gegenrechnen. Der gestörte Wasserhaushalt des Bodens kostet allein über den verminderten Holzzuwachs der Bäume langfristig mindestens 20 Euro pro Kubikmeter, die den Kosten des Harvesters zugeschlagen werden müssen. Unter dem Strich und auf die Dauer schneidet das Gespann Waldarbeiter/Pferd dadurch wesentlich besser ab. Hinzu kommen die vermiedenen Schäden an den Bäumen und ihrem Nachwuchs, die sicher noch einmal die gleiche Ersparnis bringen. Nicht zuletzt ist es so, dass nur durch Handarbeit ein echter Plenterwald mit seinem Strukturreichtum zu erzielen ist. Warum Maschinen das nicht können, verrate ich Ihnen ab Seite 69.
Das letzte Argument der forstlichen Hardliner bezieht sich auf die Leistung. Pferde könnten niemals all das Holz bewegen, was jährlich auf den Markt kommt. Dafür wäre ihre Arbeitsleistung viel zu gering. Um das gesamte Holz geht es ja auch gar nicht, aber doch um deutlich mehr, als heute mit den Vierbeinern aus dem Wald gezogen wird. Natürlich sind Pferden mengenmäßig Grenzen gesetzt, aber wo ein oder zwei nicht reichen, setzt man eben einfach mehr ein. Und damit landen wir wieder beim ersten Argument: Wenn die Nachfrage wächst, dann steigt auch das Angebot der vielen Pferdehalter, die nur auf ihre Chance warten.
Und die Pferde warten ebenso. Man sieht ihnen bei der Arbeit an, wie gerne sie das Holz rücken. Meist sind es zwei, von denen jeweils eins Pause hat. Und dieses pausierende Pferd ist oft regelrecht beleidigt, scharrt mit den Hufen, um endlich wieder zu den Stämmen gehen zu dürfen. Zwingen könnte man es kaum, denn es wird lediglich mit einer losen Verbindungsleine durch leichtes Zupfen, mehr noch durch Worte, gelenkt.

Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.