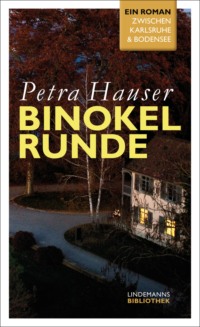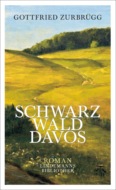Kitabı oku: «Binokelrunde»

Petra Hauser
Binokelrunde
Roman

In memoriam
Hedy und Willy Hauser
Ihnen verdanke ich
meine Kenntnisse des Binokelspiels,
seiner Regeln, seiner Finessen
und seiner spirituellen Kraft.
 Petra Hauser wurde 1950 in Karlsruhe geboren. Sie hat Germanistik und Anglistik studiert und als Lehrerin gearbeitet. 2010 erschien ihr Debüt-Roman „Das Glück ist aus Glas“, der bereits in der 5. Auflage vorliegt. Er gehört zu den meistverkauften Titeln der Region. 2011 veröffentlichte sie die Novelle „Falsche Wimpern“ und 2013 die Fortsetzung ihres Karlsruhe-Romans, „Die Tage vor uns“.
Petra Hauser wurde 1950 in Karlsruhe geboren. Sie hat Germanistik und Anglistik studiert und als Lehrerin gearbeitet. 2010 erschien ihr Debüt-Roman „Das Glück ist aus Glas“, der bereits in der 5. Auflage vorliegt. Er gehört zu den meistverkauften Titeln der Region. 2011 veröffentlichte sie die Novelle „Falsche Wimpern“ und 2013 die Fortsetzung ihres Karlsruhe-Romans, „Die Tage vor uns“.
Es war mir nicht bewusst, was für eine heilende Wirkung
vom Erzählen ausgehen kann. Der Abstand, den man
beim Erinnern gewinnt, gibt eine erstaunliche Einsicht in
Zusammenhänge, die aus der Nähe nicht sichtbar sind.
Erster Teil
1
Der Schuss, der Blitz und der Donner kamen gleichzeitig.
So schien es mir jedenfalls.
Ich sah Frau Welty dort stehen, sie sah aus wie Lots Frau, zur Salzsäule erstarrt. Ich dachte, wenn das ein Schuss war, wenn er sie getroffen hat, dann wird sie jetzt umsinken. Ich werde zu ihr eilen und werde sie stützen, meinen Arm in ihren Nacken legen, sie wird mich anschauen, mit brechendem Blick, mir etwas zuflüstern, ein dünner Blutfaden wird aus ihrem Mundwinkel sickern. Ich werde „Eudora“ stammeln, „Bitte nicht! Bitte bleiben Sie hier bei mir, endlich bei mir ...“ und ihr Blick wird sich im Leeren verlieren, schließlich erstarren. Ihr Körper wird erschlaffen, ihre Züge sich auflösen, das Blut aus ihrem Gesicht verschwinden. In wenigen Sekunden wird sich dieses schöne, rosige, fleischige Gesicht in eine Maske verwandeln. Und dieser Augenblick wird der letzte Höhepunkt in meinem Leben gewesen sein. Ihr Körper wird noch warm sein, alle Versprechungen heucheln, die ein warmer Köper geben kann, ihr Haar wird noch duften und glänzen und ich werde mich danach sehnen hineinzugreifen.
Es kann natürlich so nicht gewesen sein. All das hätte doch zu lange gedauert. Außerdem sah ich im Blitz den Mann. Er wandte mir seinen Rücken zu. An seiner Haltung konnte ich erkennen, dass er den Schuss abgegeben haben musste. Ich sah seinen rechten Arm nicht, den hielt er vor sich ausgestreckt. Die Finger seiner linken Hand waren wie Krallen abgespreizt.
Und ich sah Herrn Melser, er lehnte sich weit aus dem offenen Küchenfenster, so dass ich kurz dachte, der Schuss könnte ihn getroffen haben.
Diese beiden Gestalten, Frau Welty in ihrem Regenumhang mit der Kapuze, die sie sich tief ins Gesicht hineingezogen hatte, und Herr Melser in seinem Jogginganzug mit Kapuze sahen einander so ähnlich! So ähnlich, das dachte ich.
Dann drehte der Mann sich um und blickte mich an, denn ich stand ja nur fünf Meter entfernt von ihm vor dem Haus von Frau Winkelmann, war gerade auf dem Rückweg. Er erschrak, ließ etwas fallen, die Waffe natürlich, wie ich erst später feststellte, er zuckte zurück, zuckte, als er mich ansah und vielleicht erkannte, zuckte zurück, so dachte ich, und heiß durchströmte mich das Gefühl, er könnte mich gemeint haben, mich in meiner Schöffeljacke, deren Kapuze ich übergestülpt hatte. Aber warum, dachte ich, warum mich und im selben Augenblick sagte eine Stimme in mir, ja natürlich, du warst gemeint!
Da rannte er weg, die Straße entlang, Regentropfen spritzten auf aus den Pfützen, er rannte und rannte, bog am Ende unserer Straße nach rechts ab, in Richtung Park, in Richtung Bach.
Dass Frau Welty mich nicht wahrgenommen hat, nicht sofort, kam daher, dass ich direkt vor der alten Fichte stand und meine Silhouette mit ihr verschmolz. Herrn Melser konnte sie nicht bemerken, er war hinter ihr, und im Getöse des Donners ertranken alle anderen Geräusche. Frau Welty sprang auf die Straße, erstaunlich behände für ihre Größe und ihre ... wie soll ich das nennen? Sie ist eine Rubensgestalt, das trifft es am besten. Sie bückte sich, nahm die Waffe an sich, drehte sich um nach allen Seiten. Herr Melser hatte den Fensterflügel schnell geschlossen, aber ich war damals schon sicher, dass er sie beobachtete. Jetzt nahm sie mich wahr, denn ich hatte mich auf sie zubewegt, instinktiv, ich wollte ihr helfen, ihr beistehen. Sie blieb stehen und wandte den Kopf, um die davoneilende Gestalt mit ihren Blicken verfolgen zu können.
Als ich neben sie trat, flüsterte sie: „Ach, Herr Kohl, Sie!“
Es war etwas wie Erleichterung in ihrem Blick und ein Flehen. Sie presste die Lippen aufeinander, drückte die Waffe an ihre Brust und stammelte: „Bitte!“
Ich packte sie am Arm und zog sie zu unserem Hauseingang, da stand Howard. Er drückte sich an die Hauswand, er hasste Regen. Ich klemmte ihn unter meinen Arm und schob Frau Welty weiter zum Eingang hin, schloss auf und wir gingen hinauf in den ersten Stock, wo Frau Weltys Tür offen stand. Eudora war immer noch wie in Trance. Ich nahm ihr die Waffe ab, zog ihr das Regencape aus und sorgte dafür, dass sie sich in ihrer Küche auf einen Stuhl setzte. Ich wusste ja, wo ihr Bad war, griff mir schnell zwei Handtücher, die neben dem Waschbecken hingen, das eine reichte ich Frau Welty, das andere wickelte ich um Howard, der sich widerstandslos von mir abtrocknen ließ.
So begann die Geschichte, die ich erzählen will.
2
Trotz des verheerenden Wetters war das ein guter Tag für mich gewesen. Ich hatte gelesen und ein bisschen Musik gehört: „Michelle, my belle, I need to make you see, oh, what you mean to me ...“ Die Beatles! Erinnerungen hatte ich zugelassen. Wie ein altes Weib mich an früher erinnert, an damals, an die einzige Zeit, die sich zu erinnern lohnt in meinem Leben, so hatte ich mir erlaubt, es zu sehen an diesem Tag. Und ich hatte mir noch etwas anderes erlaubt. Endlich! Ich hatte mir erlaubt, mein Leben als sinnvoll zu betrachten. Insgesamt und immer noch. Ein Gefühl der Behaglichkeit hatte sich eingestellt.
„Count your blessings!“ ist eines der Mottos auf einem Poster, das in meiner Toilette hängt. David hatte es mir aus USA mitgebracht bei einem seiner letzten Besuche. Mein Cousin – zweiten Grades – David, der letzte meiner Blutsverwandten, der im Januar nach langer Krankheit weit weg von mir verstarb. „Count your blessings!“ Das hatte ich getan, ich hatte das Gute in meinem Leben betrachtet. Die Tatsache, dass ich einen Platz eingenommen hatte in der Gesellschaft, eine Zeit lang mein Rädchen gedreht hatte in der großen Maschinerie unserer Welt. Dass ich die Liebe kennengelernt hatte. Dass ich Freunde hatte. Dass ich immer noch nützlich sein konnte für andere Menschen. Dass jeder Tag mir immer noch Erkenntnisse bringen kann, über die ich froh bin. Und dass es immer noch die Möglichkeit gibt, Eudora Welty zu sehen, was auch bedeutet, dass es immer noch die Möglichkeit gibt, ihr näherzukommen, herauszufinden, wie sie über mich denkt, ob es vielleicht irgendwo in ihrem Herzen ein Fenster gibt, das sie bereit wäre, mir zu öffnen.
Frauen spielten immer eine wichtige – soll ich sagen „dominierende“? – Rolle in meinem Leben. Überall, wo ich mich länger aufhielt, fand ich nach kurzer Zeit ein weibliches Wesen, das mir gefiel und das ich anerkennend betrachtete und von dem ich hoffte, es würde auch mich gerne sehen, mit Wohlwollen betrachten, sich darauf freuen, in einer der jeweiligen Situation angemessenen Weise in Kontakt zu treten mit mir. Für ein Gespräch, für einen Spaziergang, für ein Glas Wein, einen Cappuccino. Interesse aneinander haben, auch einander in Erwägung ziehen, ernst und ehrenhaft, das war es, was ich wollte, was mir gefiel, was in mir eine Spannung entstehen ließ, die etwas mit Lebensfreude, mit Lust zu leben zu tun hat. Man könnte meinen, es war klar, dass ich auch hier wieder eine solche Frau finden würde. Irgendeine. Aber es ist anders. Eudora Welty ist eine ganz besondere Frau. Sie ist für mich das Modell der Frau schlechthin. Sie ist Beatrice so ähnlich, wie es noch nie eine andere Frau, die ich in den vielen Jahren seit damals getroffen habe, war. So könnte Beatrice heute aussehen. Im Wesen ähnelt Frau Welty Beatrice allerdings nicht. Um Frau Welty ist eine Art von Melancholie, von Traurigkeit, die hätte Beatrice niemals zugelassen. Beatrice konnte eigentlich nicht lächeln, sie lachte sofort, sie gluckste, so als ob in ihr ein Gebrodel von Fröhlichkeit wäre, das sich mit Macht nach draußen schaffen wollte; sie kicherte, kakelte ihr kullerndes, tremolierendes Gelächter ungeniert in die Welt hinaus, mit einer unglaublichen Unbekümmertheit und absoluten Unabhängigkeit vom Urteil aller Anwesenden. Sie konnte auch bei traurigen Anlässen lachen, sicher auch bei einer Beerdigung, wenn es etwas gab, das sie erheiterte, irgendein Detail. Aber das geht schon wieder zu weit, das ist schon wieder Phantasie. Ich war niemals auf einer Beerdigung mit Beatrice. Wir hatten immerhin nur sechs Wochen. Genau genommen hatten wir 45 gemeinsame Tage. Jener Tag also, dessen Abend nicht nur mein Leben entscheidend veränderte, war ein guter Tag für mich gewesen. Ich wagte, mein Leben, das vergangene und das gegenwärtige, als sinnvoll anzunehmen. Ohne schlechtes Gewissen, ohne Ressentiment. Hatte mich gelöst von dem, was mein Vater mich gelehrt und mir auferlegt hatte, als er mir immer wieder und oft so umständlich, dass es mir körperliche Schmerzen bereitete, erklärte, dass unser einziger Sinn es sei, uns fortzupflanzen, Kinder zu zeugen und großzuziehen, das sei die eigentliche Aufgabe aller göttlichen Geschöpfe, die Erde zu bevölkern und damit dem Heilsplan des Herrn zur Erfüllung zu verhelfen.
Mein Vater war auf eine naive Art fromm. Was in der Bibel stand, war nicht verhandelbar für ihn. Seid fruchtbar und mehret euch! Daran gab es nichts zu deuteln. Dieser Satz war Gesetz für ihn. In meiner Pubertät gab es eine Zeit, da diskutierte ich mit ihm. Manchmal wurde ich aggressiv und laut dabei. Wir hatten einen jungen Religionslehrer, der alles, was in der Bibel stand, relativierte, historisch einordnete, literarisch interpretierte. Das war für die meisten von uns ein großes Erlebnis. Zum ersten Mal begriffen wir die Unabhängigkeit des Geistes, es entstand eine Idee dessen, was man als aufgeklärter Mensch des 20. Jahrhunderts unter Seele verstehen konnte. Geist, der es wagt, das nicht Beweisbare in sein Kalkül einzubeziehen. Infiziert von dem, was ich da erfuhr, trat ich gegen meinen Vater an. Er erlaubte mir diese „Irrwege“, hoffte aber, dass ich bald wieder zurückkehren möge auf den rechten Pfad des göttlichen Heilsplans, um mein Heil nicht ganz und gar zu verwirken. Er zwang mich nicht. Mein Vater hat mich zu nichts gezwungen. Er war immer die Güte selbst und seine Liebe zu mir war unerschütterlich. Deshalb fiel es mir auch so schwer, mich von ihm zu lösen. All jene meiner Altersgenossen, die einen autoritären Vater hatten, der sie mit Sprüchen wie: „Solange du die Füße unter meinen Tisch streckst, bestimme ich, was du tust!“ quälte, schafften es mühelos, sich abzunabeln und ein eigenes, selbstbestimmtes Leben zu führen. Mir gelang es nicht. Auch nicht nach Vaters Tod. Da wurden seine Erwartungen an mich zu einer Art Vermächtnis. Nur die Tatsache, dass es mir trotz echter Bemühungen nicht gelang, mich fortzupflanzen, weil es nicht an mir lag, weil ich nur mit einer schweren Sünde noch eine Chance hätte schaffen können, erleichterte mein Schuldgefühl. Ich hätte mich von Marina scheiden lassen müssen. Wie wäre das möglich gewesen? Sie war mir treu, sie hing an mir, ich war alles, was sie hatte. Und Vater mochte sie. Er begrüßte meine Wahl. Marina war eine Mischung aus Mädchenhaftigkeit, Unschuld, Zurückhaltung und Zartheit; das verstand mein Vater unter Weiblichkeit. Das hatte er mir unter die Haut erzogen. Obwohl meine Mutter ...
All das, diese vielschichtigen Erinnerungen hatte der Schuss ausgelöst in mir – und nicht nur in mir, wie sich bald herausstellen sollte. Zurück also zum Geschehen jener Gewitternacht. Nachdem sich Frau Welty ein bisschen abgetrocknet hatte, richtete sie ihre schönen graublauen Augen auf mich und sagte:
„Was machen wir nun mit der Waffe?“
„Ich nehme an, wir müssen die Polizei verständigen.“
„Nein!“, schrie sie auf. Und gleich darauf, so als ob sie diesen Schrei zurücknehmen wolle, sagte sie noch einmal sehr bestimmt:
„Nein! Bitte, bitte nicht, Herr Kohl.“
Ich konnte nichts erwidern. Alles, was ich eingewandt hätte, wäre riskant gewesen, hätte mich nämlich aus Eudoras Nähe geschleudert, weiter weg, als ich es bisher gewesen war. Deshalb sagte ich nach ganz kurzem Überlegen:
„Ich werde sie fortschaffen.“
„Mein Gott, wie wollen Sie das denn tun?“
„Ich werde sie irgendwo ins Wasser werfen. Es ist ja nichts passiert, nicht wahr?“
Ich wollte sagen, kennen Sie den Mann? Ich wollte fragen, warum wollen Sie ihn schützen? Was wollte er? Wollte er auf sie schießen? Warum? Ich wollte das wirklich fragen. Aber ich konnte nicht.
Also nahm ich die Waffe, steckte sie in meine Jacke und verließ Frau Welty. Oben in meiner Wohnung verpackte ich die Waffe ganz schnell in mehrere Lagen Zeitungspapier, dann ging ich hinaus in den Regen. Das Gewitter hatte sich verzogen, und das viele Wasser platschte noch heftiger herab als zuvor. Ich eilte in das Vogelschutzgebiet hinterm Bahndamm. Beim Wehr, das geöffnet war, warf ich das Paket ins Wasser. Zuvor hatte ich mich umgesehen wie ein Dieb, aber niemand war so verrückt wie ich, zu dieser Zeit, bei diesem Wetter dorthin zu gehen.
Ich hielt die Gefahr für gebannt.
Zu Hause duschte ich und zog meinen Jogginganzug an. Ich sah auf die Uhr. Inzwischen war es Mitternacht.
Als ich mich vor meinen Fernsehapparat gesetzt hatte, um mich mit irgendetwas abzulenken, hörte ich ein zaghaftes Klopfen an der Tür. Es war Frau Welty. Ich bat sie herein.
„Ich will Ihnen etwas erklären, Herr Kohl“, sagte sie.
„Nein, das müssen Sie nicht“, erwiderte ich. An dieser Reaktion kann jeder vernünftige Mensch erkennen, wie es um mich stand. Ich war – kann man das noch sein mit 67 Jahren? –, ich war verliebt! Ich war so fasziniert von dieser Frau, lange schon, ich lechzte danach, etwas zu tun, um ihre Aufmerksamkeit zu verdienen.
„Wir vergessen einfach, was passiert ist.“
„Oh Herr Kohl, danke, danke. Vielen, vielen Dank!“
Die Überschwänglichkeit der Dankesbezeugungen riefen ein ganz sanftes Unbehagen in mir aus. Dieses Gefühl der Enttäuschung, die man hat, wenn sich jemand, den wir bewundern, nicht so benimmt, wie wir es gerne hätten.
Wir standen auf und gingen hinaus. Bevor sie aus der Tür schlüpfte, drehte sie sich zu mir um, und plötzlich umarmte sie mich heftig. Ich spürte ihre Wärme, ich roch ihr Parfum und ich roch sie, ihre Haare, ihre Haut. Ich schlang meine Arme um sie und spürte etwas, von dem ich geglaubt hatte, dass es endlich vorbei wäre.
Ich fühlte mich wie damals, als Beatrice mit mir tanzte. „Michel, Michel, I need to make you see, oh what you mean to me“, sang Beatrice damals in mein Ohr und ihr Atem drang in meine Ohrmuschel, ich begehrte sie und sie konnte es fühlen und sie presste sich trotzdem an mich, schreckte nicht zurück wie meine Tanzstundendamen, wenn sie entdecken konnten, was passiert, wenn sie einen Mann in ihren Bann ziehen. Beatrice gab mir das Gefühl, dass Begehren nichts „Sündiges“ war, sondern etwas ganz Natürliches, das in der Luft schwebt wie ein Vogel und sich dann auf die Menschen setzt und Besitz ergreift von ihnen. Kurze Zeit später lagen wir in Beatrices Zelt nebeneinander und küssten uns. Das war unsere erste Liebesnacht im Sommer 1965 in Morgat, Bretagne, Atlantik. Riesenwellen, Teerflecken auf der Badehose und Distelnadeln in der Fußsohle, Sand in allem, was man dabei hatte, in den Schuhen, in den Büchern, zwischen den Borsten der Zahnbürste. Jeder Kuss schmeckte nach Salz. Wenn sich meine Finger hinter Beatrices Ohren verirrten, sammelte sich Sand unter meinen Fingernägeln. Ich war so glücklich in diesen 45 Tagen, dass sich danach sehr schnell die Vorstellung von Maßlosigkeit formte. Von einem Zuviel auf einmal. Ein Für-immer-genug-Gefühl. Maßlos glücklich waren wir. Wenn wir miteinander schliefen, waren wir absolut eins. Wir atmeten im selben Takt, jede Bewegung geschah gemeinsam und wir fühlten es, wenn sich der Höhepunkt des anderen ankündigte und konnten aufeinander warten, um ihn gemeinsam zu erleben. Unsere Erschöpfung dauerte gleichlang, unsere Begierde keimte zur gleichen Zeit wieder auf, wir erforschten den Körper des anderen mit den Händen, mit den Zungen, unsere Neugier, unsere Unersättlichkeit war dieselbe.
Ich wusste so viel und so wenig von Frauen, bis ich Beatrice traf, dass diese Zeit, die wir miteinander hatten, vollkommen unvergleichlich war. Viel später erst relativierte sich manches. Wer hatte Beatrice das alles gelehrt? Robert? Oder hatte sie schon andere – Liebhaber, was für ein unschönes Wort – vor ihm gehabt? Erwachsene Kerle, die sich an ihr erfreuten, sie ausbeuteten, sie sich zu Willen machten, ihr erklärten, wie ihr Körper funktionierte, ohne Interesse an ihrer Seele? Denn das wusste sie, sie wusste Bescheid über ihren Körper und über meinen. Zumindest wusste sie alles, um unsere Liebesnächte, jede einzelne, zu magischen Nächten zu machen. Sie lockte mich auch am Tag, gab mir das Gefühl, dass ich so perfekt war, dass sie mich einfach lieben müsste. Meine Schultern lobte sie, meinen kleinen Arsch, sie benutzte dieses Unwort so, dass es in eine Hymne gepasst hätte, meine Lippen, meine Nase, meine Haare, damals schon spärlich, meine Ohren, die groß sind, aber anliegen. Sie setzte sich neben mich, um eines meiner Ohren betrachten zu können, dabei umschloss sie mich mit ihren Schenkeln, einen Schenkel legte sie mir auf den Schoß und so spürte sie – ach, es hat alles keinen Sinn, es ist vorbei, es wird sich nicht wiederholen lassen, natürlich nicht! Und ich will das auch nicht. Ich will nicht Beatrice suchen in Frau Welty. Darum geht es nicht. Es ist nur einfach so, Männer, ich glaube, alle Männer, sprechen auf einen besonderen Typus Frau auf besondere Weise an, suchen diesen Typus immer wieder. In jeder Frau suchen sie die eine einzige, die sie meinen.
Langer Rede kurzer Sinn, ich war verrückt an diesem Abend, weil ich mich erinnerte, wie verrückt ich damals nach Beatrice gewesen war, weil Frau Welty mich an Beatrice erinnerte, mit Beatrice verschmolz, und sich in meinem von Verpflichtungen, Hoffnungen und Sorgen entleerten Gehirn, in meiner ausgetrockneten Seele, in meinem immer noch lebendigen Körper etwas regte, das der Hoffnung auf Glück eines jungen Mannes glich. Ich wurde Frau Weltys Komplize ohne zu wissen, um was es ging. Und ich stellte mich darauf ein zu warten, so lange, bis sie mir eine Erklärung für ihre Handlungsweise geben würde.
3
Wir wohnen an einem Wendehammer. Drei Häuser stehen im U um das erweiterte Sackende unserer Straße. In unserem Haus wohnen im Erdgeschoss die Melsers, im ersten OG Frau Welty, unterm Dach wohne ich. Gegenüber befindet sich das Haus der alten Frau Winkelmann. Sie lebt dort mit wechselnden Polinnen, die sie betreuen. Zwischen diesen beiden Häusern steht das Haus der Löwes. Es ist das stattlichste Haus, ein breit angelegter, einstöckiger Atriumsbau, umgeben von einem wunderbaren Garten. Die Kinder der Löwes sind erwachsen und weit weg. Auch Herr Professor Löwe ist fast nie da; er hat einen Lehrstuhl für Photogrammetrie und viele Projekte in gebirgigen Zonen der Erde, wo die Luft klar und dünn ist; er hält dort nach den Satelliten Ausschau, die für sein Institut Daten produzieren. So haben wir uns das zusammengereimt aus gelegentlichen Artikeln in unserer lokalen Zeitung. Dann und wann taucht er auf mit einer Gruppe von Leuten, meist sind es nur Männer, Fremde, Wissenschaftler, die sein Haus besetzen, d.h. seine Frau muss diese Leute beherbergen, bekochen, dabei schön und charmant sein. Danach braucht sie mehrere Tage Erholung, regelmäßig taucht sie bei Frau Winkelmann auf, schüttet der alten Dame ihr Herz aus, gelegentlich waren diese Psychohygienesitzungen schon so dringend, dass auch meine Anwesenheit bei Frau Winkelmann Frau Löwe nicht davon abhielt, loszuheulen. Ich verziehe mich in solchen Momenten so schnell ich kann, aber schaffe es selten schnell genug, um nicht doch noch das Wesentliche mitzubekommen: Herr Löwe ist ein widerlicher Macho, der seine Frau ausnutzt und sie erpresst mit dem Hinweis darauf, dass er, sollte sie daran denken, sich von ihm zu trennen, um ein eigenes Leben zu beginnen, dafür sorgen werde, dass sie „arbeiten“ müsse, und das hieße dann putzen gehen, da sie nämlich nichts gelernt hat. Frau Winkelmann richtet Frau Löwe immer wieder auf, so dass sie, wenn ihre Kinder kommen, stark genug ist, die Wahrheit vor ihnen zu verbergen, und alles beim Alten bleibt. Aber Frau Winkelmann braucht auch ab und zu mich, um ihrerseits Psychohygiene zu betreiben. Auch Frau Winkelmann hat Kinder in der Ferne. Ihre Söhne sind viel beschäftigte Männer, die man natürlich mit so etwas nicht belästigen kann, und zu ihren Schwiegertöchtern bzw. den wechselnden Freundinnen des einen Sohnes, hat sie ein distanziertes Verhältnis. Auch zu den Enkeln hat sie inzwischen den Kontakt weitgehend verloren. In den anderen Häusern unserer Straße, die weit voneinander entfernt stehen, umgeben von Gärten mit hohen Tuja- oder Kirschlorbeerhecken wohnen lauter gutbürgerliche Familien meist mittleren Alters, Beamte und Ähnliches, scheue Exemplare der Schicht, die vor allem darauf schaut, das Eigene zu hegen und zu pflegen und gegen jeden möglichen Angriff von außen zu schützen. Ich kenne ihre Namen nicht, kenne nur einige Gesichter und die Fahrzeuge, die auf der Straße geparkt sind. Man nickt einander zu aus Höflichkeit, weil man sich schließlich doch ab und zu begegnet und deshalb nicht so tun kann, als ob man nicht zumindest wüsste, wo der andere wohnt. Bis auf diese drei enger stehenden Häuser am Wendehammer handelt es sich also um eine überschaubare und zugleich undurchschaubare Nachbarschaft.
Nach dem Gewitter am Samstagabend war die Luft am Sonntag rein und frisch. Ich holte Pip schon früh um neun Uhr bei Frau Winkelmann und begab mich auf einen langen Spaziergang mit ihm.
Auf meinem Heimweg landete ich, ohne es zu wollen, am Wehr. Ich sah in das aufgewühlte Wasser hinein, wahrscheinlich suchte ich nach dem Zeitungspapierknäuel. Natürlich in der Hoffnung, es nicht zu finden. Und ich sah es auch tatsächlich nicht. Aber ich sah etwas anderes. Ein Bündel Lumpen. Das hatte sich am Sockel des Wehrs verfangen, wie um sich zu mokieren über die Menschen, die auf ein Wehr vertrauen, so kam es mir vor.
Seit ich an das Schicksal glaube, bin ich ruhiger geworden. Ich fühle mich nicht gezwungen, hin und her zu überlegen, was zu tun wäre. Ich handle, wenn überhaupt, aus dem Bauch heraus. Ich sah diese Lumpen mit einem schnellen Blick und schaute sofort wieder weg. Geht mich doch nichts an, dachte ich.
Ich ging nach Hause, brachte Pip zu Frau Winkelmann zurück, die an ihrem Gartenfenster saß, auf ihr Frühstück wartete und hinaussah, die Vögel beobachtete, das Eichhörnchen, die kleine Katze von Frau Löwe, die sich putzte, die ganze Pracht ihres frühsommerlichen, frisch beregneten, eingewachsenen Gartens. Die polnische Pflegerin, ich glaube sie heißt Agnieszka – ich gebe mir Mühe, mir die jeweiligen Namen zu merken, aber schaffe es meist erst, ihn richtig auszusprechen, wenn schon die nächste da ist –, telefonierte und es ging um etwas Wichtiges, sie konnte nicht wie sonst den Apparat an ihr Ohr klemmen und dabei noch die Geschirrspülmaschine ausräumen oder den Boden fegen. Sie umkrampfte den Hörer mit beiden Händen und kauschelte und wauschelte in ihn hinein, so dass sowohl Frau Winkelmann als auch Pip – und ich auch – uns abwandten, weil wir das Gefühl hatten, allzu sehr in ihr Intimleben einbezogen zu werden. Ich machte einige Handbewegungen, bedeutete Frau Winkelmann damit einfach, dass ich später noch einmal wiederkommen würde, und schloss leise die Tür hinter mir.
Der Sonntag verlief wie jeder Sonntag für mich. Ebenso der Montag und der Dienstag. Frau Welty sah ich nicht.
4
Frau Welty heißt eigentlich nicht so. Sie heißt Frau Welle. Und ihr Vorname ist auch nicht Eudora, sondern Dora. Das erste Buch, das ich hier in dieser Wohnung las, war ein Roman der amerikanischen Autorin Eudora Welty. Er fiel mir in die Hände, als ich meine Bücher aus den Kartons nahm und in die Regale einsortierte. Ich konnte mich nicht daran erinnern, ihn gekauft oder geschenkt bekommen zu haben. Dass er Marina gehört hatte, war unwahrscheinlich, denn sie las keine Bücher. Es erscheint mir so, als habe dieser Roman sich bei mir eingeschlichen, um eine Bedeutung zu haben für mich. Marinas Tod lag sechs Monate zurück, und ich war immer noch gedanklich unentwegt mit dem Mysterium des Sterbens beschäftigt, auch mit dem Sterben und Tod meines Vaters, viele Jahre zuvor. Eudora Weltys Roman half mir, über den Rand des Sterbens hinauszusehen. Welty Welle. Wortspielerei. Dazu war ich nach der Lektüre fähig. Ein Schritt aus der Erstarrung der Trauer war mir gelungen.
So kam es also, dass ich meine Nachbarin insgeheim Frau Welty nannte. Dora Welle steht an ihrem Klingelschild. Vielleicht zwang mich auch das, dieses Fast-schon EUdora ihres Vornamens dazu.
Phantasie. Ja, ich habe Phantasie. Wenig, zu wenig sicherlich nicht. Viel oder zu viel, wer will das so bewerten? Es passiert unwillkürlich, dass sich etwas verlängert in einen Raum außerhalb der sichtbaren Realität. Manchmal wächst die Realität in das Gedachte hinein, manchmal entwickelt sie sich anders oder ist schon anders gewesen.
Die Lumpen schwebten immer wieder vor meinem inneren Auge vorbei. Hin und her, hingen fest am Sockel des Wehrs und bewegten sich doch. Irgendwann sah ich eine Hand, einen Schuh, sah ein Büschel Haare. Verrückt! Dachte ich. Er war doch der Angreifer. Er hatte geschossen! Warum also sollte er nun dort im Wasser liegen mit dem Gesicht nach unten?
Mittwochabend ist Binokel-Abend. An diesem Abend treffe ich mich schon seit mehr als 15 Jahren mit drei weiteren Männern im Feldbergeck, das ist eine kleine Kneipe, in der man bisher alle Anwesenden nur schemenhaft durch die Rauchschwaden sehen konnte. Inzwischen drücken sich die Raucher unter ein behelfsmäßig angebrachtes Vordach und drinnen ist es totenstill. Wir sind quasi allein. Günter Haller ist 71, ledig, ehemaliger Bankangestellter, hatte es bis zum Filialleiter gebracht. Zwei Brüder und deren Kinder geben ihm familiären Rückhalt und das Gefühl, ab und zu gebraucht zu werden. Er hilft einigen alten Bekannten bei ihren Steuererklärungen. Damit füllt er seine Zeit aus, wenn er nicht gerade damit beschäftigt ist, irgendeiner Frau nachzujagen, was eine ganze Reihe von Nebeneffekten mit sich bringt; Friseurbesuche, Fahrten zu Fabrikoutlets für Designeranzüge und Streifzüge durch die Autohäuser der Stadt und Umgebung, weil ihm sein alter BMW nicht mehr schnittig genug erscheint.
Murkel Sonnenberg, der eigentlich Ulrich heißt, von seiner Frau aber Murkel genannt wird, was wir natürlich mit Vergnügen sofort aufgriffen, ist 73. Er war als Kaufmann in einer großen Maschinenfabrik tätig. Miriam und er haben drei Töchter und sieben Enkel, das füllt ihr Leben aus. Sie wohnen in einem kleinen Reihenhaus mit Gärtchen, beides halten sie gemeinsam in Ordnung. Putzen, Waschen, Kochen, Einkaufen, sie erledigen alles gemeinsam. Unser Binokel-Abend ist der einzige Ausrutscher in seiner zweisam geteilten Existenz.
Lutz Fromm ist der Jüngste von uns. Er ist 57, geschieden und arbeitslos. Er war Ingenieur und hat seinen Job verloren, weil er Spielschulden machte und zu viel trank. Um seine Schulden kümmert sich Günter. Er führt das Konto von Lutz und teilt ihm eine Art Taschengeld zu. Beim Binokelspiel ist unser aller Leidenschaft gleich. Auch Lutz’ Spielleidenschaft ist nicht größer als unsere. Günter sagt, es sei für ihn eine Art „Kalibrierungstherapie“. Lutz ist ein armer Kerl, ein Pessimist, der unsere edelsten menschlichen Impulse zum Aufblühen bringt, um ihn aus seinem schwarzen Loch zu ziehen, weil wir alle fürchten, sein Mangel an Lebensfreude könnte ihn eines Tages ganz abstürzen lassen.
Man sagt, Männer tratschen nicht. Aber das stimmt natürlich nicht. Nur weil sie es mit unbewegtem Gesicht, in lässiger Haltung, wie nebenher und ohne die Stimme zu modellieren tun, meint man, es sei etwas anderes. Es sei Philosophie, Politik, ernsthaft, realistisch, wertfrei. Aber es ist Tratsch. Einen Unterschied gibt es vielleicht zwischen dem männlichen und dem weiblichen Tratsch. Der weibliche Tratsch ist fruchtbar und mehrt sich. Der männliche ist sich selbst genug.
Ich erzählte also am Mittwoch, was passiert war.
„Weißt du was, Michel, manchmal kommst du mir vor wie ein Pennäler. Deine Dora Maar ist eine richtige Obsession für dich. Wenn du – sagen wir mal – zehn Jahre jünger wärst, würde ich sagen, leg’ sie flach, dann hast du sie endlich aus dem Kopf.“ Günter hat viele Liebschaften gehabt, wenn man ihm Glauben schenken kann. Ob darunter auch eine wirkliche Liebesgeschichte war, wissen wir nicht. 15 Jahre Binokelspiel hat uns aneinandergeschweißt, dennoch gibt es noch manches zu offenbaren. Das ist ein schönes Gefühl. Man glaubt, man habe noch viele Jahre vor sich, das Schicksal habe sich die Zeit, die es für uns vorsieht, eingeteilt, denkt man, und viele ungelüftete Geheimnisse erscheinen wie eine Garantie auf viele noch zu erlebende Jahre.
Günter ist also der Sexexperte in unserer Runde.
„Th!“, stieß Lutz aus. „Zehn Jahre!“ Günter vermutet, dass seine Frau ihn verlassen hat, weil es „im Bett nicht stimmte zwischen ihnen“, so drückt er sich aus. Natürlich sind nicht immer alle vier anwesend, und natürlich wird immer sofort ausführlich über den gerade Abwesenden geredet. So spinnen wir uns das zusammen, was wir nicht wissen, fügen die Bilder, die wir voneinander haben, aneinander und ergänzen sie in den Raum des Möglichen. Ganz unter uns! Höchstens Ulrichs Frau, Miriam, könnte in alles eingeweiht sein.