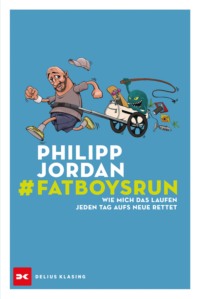Kitabı oku: «#Fatboysrun»

PHILIPP JORDAN
# FATBOYSRUN
WIE MICH DAS LAUFEN JEDEN TAG AUFS NEUE RETTET
DELIUS KLASING VERLAG


INHALT
PROLOG
#01 THIS IS THE END
#02 SKATE OR DIE!
#03 ES GEHT LOS!
#04 WRITING MY NAME IN GRAFFITI ON THE WALL
#05 ALLES HAT EINEN ANFANG!
#06 KREBS SUCKS!
#07 HIGHTERKEIT
DAS MEHR-MONSTER
#08 DAS ERSTE MAL
#09 FILM OHNE RISS
#10 JOHAN CRUYFF HATTE RECHT
#11 GRENZEN SPRENGEN MIT ROMAN
#12 ’S PFERDLE RIECHT DE STALL
#13 MIT 1.000 TEDDYBÄREN UM DIE WELT
#14 FUCK YOU, BESENWAGEN!
#15 FATBOYSRUN
EPILOG
PROLOG: DER KLEINE MANN UND DAS MEHR
»As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster.«
Dieser Satz stammt nicht von mir. Er stammt von Ray Liottas Figur Henry Hill aus dem Film Good Fellas des Regisseurs Martin Scorsese. Ich wollte nie ein Gangster sein, aber andere haben in mir den Gangster gesehen.
Es gab Zeiten, da fühlte ich mich ähnlich verfolgt wie Henry Hill am Schluss des Films. Das war am Ende meiner aktiven Graffitizeit. Ich bekam einen Anruf eines befreundeten Sprühers. Er wurde auf frischer Tat ertappt. Geschickterweise hatte er ein Adressbuch bei sich, in dem meine Telefonnummer notiert war. Was daneben stand: mein Klarname und mein illegaler Sprühername. Bingo. Panik! Wenig später fand eine Hausdurchsuchung bei einem weiteren Bekannten statt, der im Drogenhandel aktiv war und dessen gesamte Wohnung von mir mit Sprühlack veredelt war – schön verziert mit meinem Sprühernamen. Dazu fanden die Beamten dort einen Stapel Fotos einiger meiner Graffitiwerke und nahmen sie mit. Noch mehr Panik!
Man war mir auf der Spur, ich war im Fadenkreuz der Ermittler. Bei einigen anderen Sprühern fanden Hausdurchsuchungen statt, und immer wurde auch explizit nach mir gefragt. Einer wurde sogar aus dem Unterricht abgeholt, verhört und gefragt, ob er Philipp Jordan kenne. Ob er wisse, unter welchem Pseudonym der sein Unwesen triebe? Keine Panik mehr. Die wurde nun abgelöst durch eine ausgewachsene Paranoia! Ich fühlte mich wie Karlsruhes Gangster Nummer eins. Und dann wurde ich tatsächlich von der Polizei aufgegriffen. Mit ein paar anderen Malern (so nennen wir Sprüher uns untereinander) spazierte ich auf einer Gleisanlage herum und wir hatten die Rucksäcke voller Sprühdosen. Nachweisen konnte man uns nichts, aber meine Paranoia befand sich dadurch auf einem absoluten Höhepunkt. Das mochte sicher auch mit dem exorbitanten Konsum von Cannabis in jener Zeit zu tun haben. Doch überraschenderweise wurde mir nie der Prozess gemacht, und eine Hausdurchsuchung gab es auch nie. Dafür litt ich monatelang, ich fühlte mich ständig verfolgt, jeder Polizist dieses Landes war in jener Zeit hinter mir her.
Vor wenigen Jahren wurde ich für dieses Gefühl der ständigen Verfolgung überraschend entschädigt. Von der Polizei höchstpersönlich. Mir wurde ein Flugblatt zugespielt, das das Landeskriminalamt für besorgte Eltern und Lehrer veröffentlicht hatte. Es sollte den Adressaten dabei helfen, zu erkennen, ob ihr Kind beziehungsweise Schüler dem Graffitivirus erlegen war, gleichzeitig war es eine Warnung vor den zivil- und strafrechtlichen Folgen. Auf der Vorderseite des Faltblattes war ein Foto eines Charakters – so nennt man Figuren in der Graffitiwelt – von mir zu sehen. Auf seiner Wollmütze stand mein Sprayername. Also der Name, den ich illegalerweise auch auf Züge und Mauern gemalt hatte. Ich erzählte meinem Vater davon – er ist Anwalt, sein Spezialgebiet ist Urheberrecht. Er klärte mich auf: All meine illegalen Aktivitäten waren kurz zuvor verjährt. Yes. Unautorisierte Nutzung meines Bildes durch die Polizei. 1.500 Euro bitte! Chi-ching! Nie hat mich eine eingehende Zahlung so erfreut.
Im Gegensatz zu dem Mafiaprotagonisten Henry Hill war ich also nie ein richtiger Gangster, dennoch beginne ich meine Geschichte mit diesem Zitat. Warum? Weil ich mich extrem als Gangster gefühlt habe. Andere haben oft den extremen Typen in mir gesehen, mich für verrückt gehalten, manchmal sogar für kriminell. Das ist etwas, was sich wie ein roter Faden durch mein ganzes Leben zieht. Es hat eine Weile gedauert, bis ich diesen roten Faden entdeckt habe. Denn wenn ich sage, dass ich in fast allem ein wenig anders bin, oder gesehen werde, als der Rest, dann meine ich das nicht nur im positiven Sinn. Ich bin kein Superheld, ich verfüge nicht über eine einzigartige Gabe, ich bin auch nicht der Außenseiter, der es am Ende allen zeigt, aber eines ist sicher: Ich habe in den Augen vieler Menschen einen Hang zum Extremen. Anstatt als Kind mal eine Comicfigur zu zeichnen, zeichnete ich massenweise Comichefte mit selbst erdachten Helden, verbrachte Tage und Nächte damit, kopierte die Hefte bei meinem Vater im Büro und verkaufte sie in der Schule. Wenn andere sich mit einem Kinobesuch am Tag zufrieden gaben, ging ich 3-mal ins Lichtspielhaus, führte über das Gesehene Buch, fertigte für jeden Film eine Rezension an und rief später einen der erfolgreichsten deutschen Film-Podcasts ins Leben.
Auch als Maler reichte mir nicht ein einzelner auf Leinwand gemalter Teddy. Nein, ich malte weit über 1.000 Teddybilder, machte eine Installation daraus und tourte mit ihr um die Welt. Ob Enthaltsamkeit oder Konsum, für mich gab es immer nur das Maximum. Bei einem All-you-can-eat-Buffet ist bei mir Nomen auch Omen. Da wird »all« reingestopft, was ich »eaten« kann, bis mich die saure Kotze am Gaumen kitzelt, nur um dann wieder am Jahresanfang drei Wochen lediglich von Wasser und Brühe zu leben. Das nennt man Heilfasten, und mittlerweile ist das total hip.
Auch im Konsum berauschender Mittel war ich extrem. Nichts und niemals oder alles und immer. In meiner Jugend interessierte mich Alkohol und Rausch überhaupt nicht, ich machte daraus regelrecht eine Religion. Ich nannte das Ganze »Reason Movement«, und mein toller Verein hatte ganze zwei Mitglieder. Meinen Freund Jonas und mich. Vielleicht lag das an den Regeln: Man durfte nicht trinken, nicht rauchen, kein Fleisch essen, und selbst One-Night-Stands waren verboten. Es muss an meiner unendlichen Kulanz gelegen haben, dass es überhaupt ein zweites Mitglied geben durfte, denn Jonas wehrte sich vehement gegen die One-Night-Stand-Regel – und brach sie auch regelmäßig. Später habe ich eine Reise ins andere Extrem genommen und mich wegen meines Drogenkonsums oft zitternd und schwitzend über einer Kloschüssel wiedergefunden, um das letzte bisschen Flüssigkeit in Form von bitterer Galle ins Abwasser zu spucken. Warum konnte ich nicht gemäßigt konsumieren? Warum musste es erst der komplette Verzicht sein – und später der ungezügelte Konsum?
Viele Menschen schüttelten schon den Kopf über mich und mein Verhalten, von manchen erntete ich aber auch Bewunderung. Augenscheinlich polarisiere ich. Vermutlich ist mein Motor anders getaktet. Ich habe Ausdauer wie ein Duracell-Häschen. Ich kann reden wie ein Wasserfall. Insofern bin ich oft extrem in meinem Sein und Tun. Ich mag die Bezeichnung »extrem« eigentlich überhaupt nicht, auch wenn sie manchmal den Nagel auf den Kopf zu treffen scheint. Ich ziehe eine andere Formulierung vor: Ich kann mich mit absoluter Leidenschaft und Hingabe in Sachen verlieren. Oder mich auch gern mal kopfüber hineinstürzen – mit Anlauf und hochgekrempelten Ärmeln. Wenn ich an etwas Gefallen finde, kann ich einen schier unstillbaren Durst entwickeln. Das kann in völlig verschiedene Richtungen gehen und entweder sehr willkommene Früchte tragen oder mich ins Unheil stürzen. Eines Tages entdeckte ich das Laufen. Ich entdeckte es wieder. Wieder, weil ich als Kind schon mit meinem Vater und meinem Bruder lief. Aber als Jugendlicher gibt es nichts Uncooleres, als das zu tun, was der eigene Vater tut. Auf einmal war da etwas, das eigentlich die ganze Zeit vor meiner Nase war, das wie die Antwort auf alle meine Fragen wirkte: das Laufen. Das Ultralaufen. Auch hier ist das »Mehr« Programm. Hier schaffe ich es endlich, meinen Motor an seine Grenzen zu bringen. Hier kann ich endlich ein inneres Gleichgewicht finden. Ich war schon immer süchtig nach mehr. Nach vielem Suchen habe ich mein perfektes Mehr gefunden.
Denn:
»As far back as I can remember,
I always wanted: MEHR!«
#01

Da ist er also. Der letzte Tag. Die letzte Etappe. Wie an jedem Morgen der vergangenen 14 Tage, packe ich auch heute meine große Tasche und zurre sie auf dem Ziehwagen fest, den ich mir um die Hüfte schnalle. Es hat etwas Festliches. Wir sind eine Einheit geworden, dieser Ziehwagen und ich. Wir haben uns kennengelernt. Miteinander leben gelernt. Ab und zu hatten wir auch Differenzen, aber ich hätte es nie ohne ihn geschafft. Er ohne mich übrigens noch viel weniger. Fast 700 Kilometer lang dauerte unsere Freundschaft, und jetzt ist es Zeit für unser letztes Rendezvous. 700 Kilometer zu Fuß, von Utrecht bis nach Karlsruhe. Von meinem neuen Zuhause zu meinem ehemaligen Zuhause. »Home2Home« habe ich die Aktion getauft. Und das Ganze für einen guten Zweck.
Wenn ich die Zeit fünf Jahre zurückspule, ist das alles absolut surreal. Hätte man dem auf der Couch hängenden Fettsack von damals erzählt, er würde mal zwei Wochen lang jeden Tag fast nur laufen, hätte er laut gelacht. Und wäre wahrscheinlich schon allein dadurch ins Schwitzen geraten. Ich, ausgerechnet ich! Ich war zwar immer ein bewegungsfreudiges Kerlchen, aber ich war auch nie ein Athlet. Ich war nie, auch nicht ein einziges Mal, irgendwo Erster. Ich war nie dieser disziplinierte und ehrgeizige Sportstyp. Und nach der Geburt unserer Kinder bin ich zudem geschwollen! Am ganzen Körper! Als ob ich meiner Frau den Schwangerschaftsbauch nicht gegönnt hätte. Ich musste wohl auch einen haben. Ich hatte mich beinahe aufgegeben. Ein Marathon? Nie im Leben! Und jetzt stehe ich hier am Ende dieses selbst gemachten Laufabenteuers. Am Ende dieser völlig verrückten Challenge, von der ich nie wusste, ob ich mich da nicht völlig übernommen hatte.
Es ist ein großer Moment für mich, dennoch bin ich seltsam verhalten und nur ein wenig aufgeregt. 37 Kilometer liegen noch vor mir, in 37 Kilometern erreiche ich das Ziel, den Ludwigsplatz im Herzen Karlsruhes. Die heutige Etappe ist eine kurze Etappe, am Tag zuvor lief ich sogar nur 25 Kilometer. Ich wäre am liebsten bis Karlsruhe durchgelaufen, aber ich hatte mich für heute mit meinem Trainer und Podcast-Partner Michael Arend verabredet. Er ist extra mitten in der Nacht aufgestanden und aus dem Allgäu hergefahren, um mich ein Stück auf dem Rad begleiten zu können. Er hat großen Anteil daran, dass ich es ohne Probleme bis hierhin geschafft habe. Intervalltrainings mit Umfängen bis zu 21 Kilometern. Mit Ziehwagen. Einen Kilometer schnell, einen Kilometer gemütlich. An anderen Tagen fünf Stunden am Stück mit voll bepacktem Wagen in ruhigem Tempo laufen. Der alte Folterknecht! Aber wie bei einem bösartigen Nachhilfelehrer, der einen stundenlang Mathe büffeln lässt, während die anderen Kids draußen spielen, ist man im Nachhinein dankbar.
Der gestrige Tag war todlangweilig. Germersheim ist eine Kleinstadt in der Pfalz. Sie schafft den Spagat zwischen Idyll und Arsch der Welt vorbildlich. Da ich recht früh ankam, habe ich die Stadt ausführlich erkundigt. Ein paar Supermärkte, Restaurants und ein paar kleinere Geschäfte. Das war’s. Womit Germersheim allerdings wirklich hoch punktet, ist die Anzahl der Eisdielen. Drei an der Zahl, alle in 15 Minuten erlaufbar. Eine hat sogar eine eigene Karte für Spaghettieis. Achtung, Spoiler: Bis auf die klassische Variante ähnelt optisch keine Kreation einem regulären Pastagericht. Über den Tag verteilt testete ich alle Eisdielen, und ich bewegte mich nahe an der Kotzgrenze.
Das Hotel, in dem ich die Nacht verbracht habe, ist in den 70er-Jahren stehen geblieben. Vielleicht funktionierte schon damals das in den Bettkasten eingebaute Radio nicht. Jetzt gibt es auf jeden Fall keinen einzigen Ton von sich. Auf dem Tisch steht tatsächlich ein Aschenbecher. Es scheint, als hätte dieser seine Daseinsberechtigung, denn die kleine Tischdecke hat ein Brandloch. Vielleicht stammt die Decke aber auch aus den 70ern. Vom Style her würde es passen. Auf der Kommode steht ein altes Telefon. Scheinbar nur zur Zierde, denn auch das funktioniert nicht mehr. In der Dusche fehlt eine der vier Schiebetüren, und das Handtuch ist ein knallbuntes Handtuch mit einem Comicaufdruck. Meine Vermutung: Hier hat man schon lange aufgegeben, den Anschein eines echten Hotels wahren zu wollen. Auf meiner Reise habe ich sowieso die verrücktesten Unterkünfte besucht. Das passiert, wenn man die Hotels am selben Tag des Bezugs noch schnell auf seiner Karten-App aussucht und keinen Blick auf Rezensionen im Netz wirft. Aber wer 60 Kilometer durch die Hitze gelaufen ist, stellt keine hohen Ansprüche, der empfindet jedes Bett als puren Luxus.

HITZESCHLACHT
VON UTRECHT NACH KARLSRUHE, UND DIE SONNE HATTE SELTEN MITLEID MIT MIR.

MAJESTÄTISCHE KULISSE
LAUFEN MIT ZIEHWAGEN AM RHEIN BEI BONN.
Ich checke aus und suche auf meiner App den geschicktesten Weg Richtung Rheinbrücke. Ich laufe durch das noch verschlafene Germersheim. Noch verschlafener als tags zuvor. Morgenstund hat Gold im Mund. Es wird wieder ein heißer Sommertag. Bis auf einen Regentag hatte ich nur solche Tage. Okay, es gab doch Unterschiede: Entweder es war heiß und trocken, oder es war schwülheiß. Eigentlich absolut kein Laufwetter, aber ich laufe lieber in der Hitze als in der Kälte.
Dennoch bin ich während des Runs früh aufgestanden, um die ersten 20 Kilometer noch vor dem großen Hitzeeinbruch hinter mich zu bringen. Warum mach ich das zu Hause nie?
Als ich die Rheinbrücke überquere, liegt eine Blindschleiche vor mir auf dem Weg. Ich mache ein Foto und gebe mir Mühe, sie so gefährlich wie nur möglich erscheinen zu lassen. Aber meine Fotografie-Skills machen aus dieser Echse ohne Beine keine gefährliche Schlange. Schade. Auf meiner Reise zu Fuß bekam ich viele Tiere zu Gesicht. Das sonderbarste war wohl das Knäuel aus Wiesel und Ratte. Die Ratte habe ich erkannt, und zumindest glaube ich, dass da auch ein Wiesel beteiligt war. Ich wäre beinahe drüber gestolpert und habe irgendetwas gerufen vor Schreck. Wenn es denn ein Wiesel war, bin ich mir ziemlich sicher, dass das Wiesel die Ratte verspeisen wollte und nicht andersherum. Ich werde nie Sicherheit darüber erlangen, welche felligen Wesen da Tango getanzt haben, denn bevor ich das Knäuel fotografieren konnte, war dieses im tiefen Gras verschwunden.
Auf der anderen Rheinseite laufe ich auf einem Schotterweg direkt am Fluss. Der Rhein und ich sind inzwischen dicke Freunde geworden. Ich darf ihn bestimmt duzen. In den vielen Stunden, die wir zusammen verbracht haben, ist er mir nie auf die Nerven gegangen. Viele Laufkollegen warnten mich vorher, dass so ein langer Lauf zu monoton sei. Zu wenig Abwechslung. Zermürbend. Das empfand ich nie so. Er hat mich eher geerdet. Logo, es gab viele langweilige Passagen. Und wenn man Distanzen um die 60 Kilometer in der Hitze läuft, kann man auch mal genervt sein. Aber nie war der Rhein selbst mein Feind. Auf den Geist gingen mir andere Dinge, wie dieses lange Lastenschiff, das immer konstant neben mir her fuhr. Stalken die mich? Oder diese Autos, die teils nur wenige Meter neben mir vorbeirasten und statt einer frischen Brise nur stinkende heiße Luft in mein Gesicht bliesen. Der Rhein hingegen hatte eher etwas Tröstendes. Denn auch in schweren Momenten wusste ich, dass er mich nach Karlsruhe führen wird. Er floss neben mir her und war gleichzeitig schon am Ziel. Wie jemand, der einen bei einem Lauf begleitet und ab und zu berichtet, wie es im Zielbereich aussieht.

ENDLOSE FELDWEGE
DER LETZTE TAG DES »HOME2HOME«-RUNS IN DER SCHÖNEN PFALZ.

DAHEIM!
ICH BIN AM KARLSRUHER SCHLOSS, SPIELPLATZ MEINER JUGEND.
Ich bin fast am Ziel. Bilde ich mir das nur ein, oder riecht die Luft nach meiner Jugend? Wenn man von Holland bis runter nach Süddeutschland läuft, erlebt man natürlich nicht nur einen landschaftlichen Wandel, sondern auch einen sprachlichen. Holländisch, Niederrheinisch, Kölsch, Hessisch, Mannheimerisch, Pfälzisch und schlussendlich der badische Dialekt der Karlsruher. Die Übergänge sind oft fließend. In Germersheim war ich sprachlich sehr nah an der Heimat, und nun spitze ich die Ohren, wenn ich Spaziergänger überhole, um ein paar Worte des hiesigen Dialektes aufzuschnappen. Ich habe den nie wirklich gesprochen. Meine Mutter kommt aus dem hohen Norden, und mein Vater ist als Kind oft umgezogen. Wir sprachen zu Hause hochdeutsch. Karlsruherisch hat etwas Vulgäres, doch wenn ich es höre, fühlt es sich vertraut an, dann fühle ich mich heimisch.
Der GPS-Track auf meiner App, dem ich immer stur gefolgt bin, führt mich heute über einen Schotterweg auf eine Art Deich. Immer wieder Bauarbeiten, die mein Vorankommen bremsen. Der Ziehwagen macht kurze Kletterpartien im Sand oft zu einem Kraftakt. Sagte ich eben noch, wir wären Freunde? Nun, jetzt hab ich große Lust, diesen Freund in die Walachei zu feuern. Im hohen Bogen.
Irgendwo lese ich, dass ich wohl in der Nähe von Liedolsheim bin. Das berührt mich emotional. Liedolsheim ist nämlich der erste Ort, der eine direkte Verbindung zu meiner Kindheit herstellt. Hier wohnte einer meiner Klassenkameraden, bei ihm habe ich auch mal übernachtet. Er hatte diesen total neumodischen Schlüsselanhänger, der piepte, wenn man pfiff. Wir haben stundenlang diesen bescheuerten Schlüssel versteckt und den jeweils anderen wieder suchen lassen. Those were the days … ohne Smartphones.
Jetzt fühlt sich das Ziel sehr nah an. Ich sehe ein Reh unten im hohen Gras beim Fluss. Ich fotografiere es, merke aber gleich, dass die Fotos, wie so oft, nichts taugen. Wann kommt endlich mal jemand mit einem ausfahrbaren Teleobjektiv für Smartphones um die Ecke? Der Deich, auf dem ich laufe, macht das Laufen immer mehr zur Tortur, andauernd unterbrechen Baustellen mein Vorankommen. Ich telefoniere mit Michael, und wir diskutieren, ob es Alternativen gibt, die nicht direkt am Rhein entlangführen. Es gibt sie. Es gibt einen Weg, der direkt zum Karlsruher Schloss führt. Wie mit dem Lineal gezogen. Es hätte nicht besser kommen können. Typisch Karlsruhe. Es ist die jüngste Stadt Deutschlands und wie auf dem Reißbrett entworfen. Die Innenstadt gleicht einem Fächer, wobei alle Straßen zum Schloss führen. Dass ich durch den Wildpark – so heißt der Wald hinter dem Karlsruher Schloss – direkt in den Schlosspark laufen werde, versetzt mich in eine feierliche Stimmung. Der Schlossgarten, Herz und Erholungsgebiet der Stadt, hat mir viele Stunden meiner Jugend versüßt. Einst einer der wichtigsten Skatespots, später der ideale Platz zum Chillen, Frisbee spielen oder Freunde treffen. Und jetzt, viele Jahre später, Kulisse für meinen selbst gebackenen Zieleinlauf. Aber noch ist es nicht so weit. Ich muss noch über 20 Kilometer laufen.
Ich treffe endlich Michael. Er kommt mir mit dem Fahrrad entgegen. Es ist das erste Mal, dass wir uns persönlich treffen. Wir haben schon so viele Podcasts miteinander aufgenommen, telefoniert, geskypt und gechattet, aber jetzt sehen wir uns endlich mal leibhaftig. Michael hat mich über längere Zeit mit Trainingsplänen versorgt, meine Daten ausgewertet und sogar den GPS-Track für die gesamten 700 Kilometer gebastelt. Nun begleitet er mich ins Ziel. Auf dem Papier passen Michael und ich eigentlich so gar nicht zusammen. Er ehemaliger Soldat, ich Künstler. Er gewinnt immer wieder Trail-Wettkämpfe, wie zum Beispiel den Zugspitz Ultra oder den Joker Trail, den er gleich 4-mal gewann. Ich wiederum fühle mich schon als Sieger, wenn ich innerhalb der offiziellen Cut-offs das Ziel erreiche, ohne zu sterben. Er konservativ und ich eher die Kategorie linksgrün versiffter Gutmensch. Und trotzdem verstehen wir uns super und respektieren uns. Das kann ich zumindest von meiner Seite aus sagen, und ich glaube, Gleiches gilt für ihn. Leider ist das in den heutigen Zeiten ja nicht mehr selbstverständlich. Und jetzt radelt er neben mir her, und wir unterhalten uns. So viele Menschen haben mich auf meiner Reise unterstützt, und Michael tut dies auf dem letzten Stück. Irgendwie passt gerade alles. Fahrradbegleitung hat etwas sehr Angenehmes. Im Gegensatz zu einer laufenden Begleitung hat deroder diejenige immer eine ruhige und somit beruhigende Stimme und erinnert einen durch eigenes Schnaufen nicht ständig daran, dass man ja selbst gerade läuft. Wie positiv sich das auswirkt, merkte ich, als mich Nane – eine Podcast-Hörerin, die mich vor Düsseldorf abpasste, locker 30 Kilometer mit dem Rad begleitete.
Michael und ich unterhalten uns über Gott und die Welt. Ich frage ihn ein bisschen zu seiner Soldatenvergangenheit aus und erzähle von meinen letzten 650 Kilometern. Ich bin selber erstaunt, wie einfach es eigentlich war. Ich habe zwar gelitten wie ein Hund, mich durch die Hitze gekämpft und hatte auch wirkliche Tiefpunkte, aber die richtig großen Probleme blieben aus. Keine Verletzung, keine Krämpfe. Nicht mal eine Blase hatte ich. Worüber ich am meisten erstaunt bin: Ich hatte nicht ein einziges Mal Muskelkater oder steife Beine. Drei Jahre zuvor konnte ich nach meinem ersten Marathon eine halbe Woche kaum laufen und nur rückwärts – und nicht wirklich graziös – die Treppe runtergehen. Nach meinem ersten Ultramarathon war ein Aufstehen ohne lappenhaftes Gequengel nicht drin. Aber scheinbar haben die vielen Kilometer, die ich seitdem zurückgelegt habe, und Michaels unbarmherziger Trainingsplan doch Früchte getragen. Und da auch immer noch ein Quäntchen Glück dazu gehört, muss ich den Laufgöttern wohl auch danken.
Die Motivation hat mich glücklicherweise auch nie verlassen. Jeden Morgen freute ich mich auf die Tagesetappe, ohne den nötigen Respekt zu verlieren. Ich konnte die Sehenswürdigkeiten, die die Landschaft und Städte zu bieten hatten, genießen. Lustigerweise war ich am meisten von dem Touristen-Hot-Spot-Numero-uno enttäuscht, der Loreley. Ein langweiliger Fels, der dem Drachenfels oder dem Siebengebirge nicht das Wasser reichen kann und trotzdem Busse voller Japaner anzieht.
Ich erfreute mich an den Menschen, die mich begleiteten, und an denen, die ich am Wegesrand kennenlernte. Viele nette Gespräche mit Podcast-Hörern und Freunden. Unzählige Small Talks mit Bäckereifachverkäuferinnen und Tankstellenbesitzern. Wie oft sieht man schon einen nass geschwitzten Freak, der mit einem seltsamen Ziehwagen um die Hüfte in der Mittagshitze hereinspaziert kommt und zwei Liter Apfelschorle kauft! Apfelschorle war sowieso mein Hauptnahrungsmittel. Es ist isotonisch und schmeckt wesentlich besser als die ganzen künstlichen Sportgetränke und Gels, derer ich mich schon nach etwa 100 Kilometern entledigt hatte. Ich werde wohl nie wieder im Leben eine Apfelsaftschorle trinken können, ohne dabei an meinen Lauf zu denken.

ZIELGERADE!
NACH 700 KILOMETERN NUR NOCH EIN PAAR SCHRITTE AUF DER KARLSRUHER WALDSTRASSE.

MICROPHONE CHECKER
EIN KURZES INTERVIEW FÜR DIE LOKALNACHRICHTEN.
Eine weitere Konstante war der allabendliche Besuch beim Italiener. Habe ich ein einziges Mal nicht Salat und Pasta zum Abendessen gegessen? Ah, da waren die Spätzle mit Pilzen – zählt auch als Pasta-Gericht! »Never change a running system«, sagen die Informatiker. Das mit dem »Running System« ist prima auf uns Läufer übertragbar.
Noch grob zehn Kilometer bis Karlsruhe. Michael macht immer wieder Fotos. Ich habe mich für 12 Uhr mit einem Kamerateam von BadenTV am Zielpunkt verabredet. Ansonsten wird das Empfangskomitee überschaubar sein, zwei Bekannte haben sich angemeldet. Auf Facebook habe ich zwar bekannt gegeben, dass ich irgendwann zwischen 11:30 und 13 Uhr ankomme, aber ich erwarte keinen großen Ansturm. Weder meine Eltern noch meine Frau und Kinder können kommen. Mir ist das ja irgendwie recht. Ich war von Anfang an in der doofen Lage, dass ich einerseits so viel Aufmerksamkeit wie möglich für den guten Zweck generieren musste, andererseits aber auch nicht die Pferde scheu machen wollte, nur um dann nach einer Woche aufgeben zu müssen. Ich bin zwar zuvor mal 80 und 100 Kilometer am Stück gelaufen, aber knapp 700 Kilometer in zwei Wochen mit Ziehwagen? Das war absolutes Neuland für mich. Auch wenn man bestens trainiert ist, bleiben immer gewisse Zweifel, und wer lädt sich schon gern ein großes Publikum ein, das einem beim Scheitern zuguckt? Ich hatte mehrere Radiointerviews gegeben, musste aber feststellen, dass durch diese Auftritte kaum Spendengelder generiert wurden. Fast der gesamte Betrag kam durch Freunde und Podcast-Hörer zustande. Ich hoffe ein wenig drauf, dass über BadenTV noch ein paar Euros ins Haus flattern.
Und dann geht es plötzlich viel zu schnell. Ich sehe am Ende des Wegs durch einen Parkeingang das vertraute helle Gelb des Karlsruher Schlosses blitzen. Ups, da habe ich mich wohl ein wenig in der Zeit vertan.
Den Leuten vom Fernsehen habe ich mich erst in einer halben Stunde angekündigt. Ich zücke mein Handy und kommuniziere die Lage. Und dann laufe ich auf einmal im Schlossgarten. Das ist Heimat, Westentasche, Jugend. Das ist absolute Vertrautheit. Ich spüre, dass ich auf einmal doch völlig erregt bin. Meinen Körper durchströmt Adrenalin. Ich laufe planlose Schlangenlinien, und mein Ziehwagen kippt fröhlich hin und her. So viele Wege gibts hier aber auch nicht, also laufe ich irgendwann einfach quer übers Gras. Dann rechts durch das Tor in Richtung Bundesverfassungsgericht. An dessen Treppen habe ich als Kind unzählige Stunden in der Sommerhitze geskatet. Diesen hellroten Steinboden habe ich mehrfach unfreiwillig geküsst. 100 Meter weiter habe ich meine erste Watsche kassiert, weil ich jemanden falsch angeguckt habe. Jahre später habe ich den Schläger kennengelernt, dann aus den Augen verloren, und als ich ihn irgendwann wieder traf, war er Zuhälter. C’est la vie.
Ich befinde mich gerade in einem seltsamen Tunnel. Eine Mischung aus einer Reise zurück in der Zeit und einer Ehrenrunde im Stadion. Das Wachpersonal des Bundesverfassungsgerichts, der Schotter unter meinen Füßen, die Geräusche der Stadt. All das, was mir bewusst macht, dass ich jetzt wirklich da angekommen bin, wo ich die letzten knapp 700 Kilometer hinwollte, hat die gleiche Wirkung auf mich wie eine jubelnde Menge bei der Zielankunft eines Marathons. Und auf einmal bin ich auf der Waldstraße, die direkt Kurs auf den Ludwigsplatz im Herzen der Stadt nimmt.
Kunsthalle links, dann der US-Shop rechts. Hier habe ich mir als junger Spross mal eine Tarnhose gekauft. Ein Stück weiter rechts ein Schuhladen und daneben eine Burgerkette. Hier hab ich meinen allerersten Hamburger gegessen. Damals war es noch ein Burger King, inzwischen ist es ein McDonald’s.
Dann kommt der Moment, in dem ich die Kaiserstraße überquere. Die Hauptschlagader der Stadt. Das hier war mal der Ku’damm, ach, was rede ich, die Fifth Avenue meiner Kindheit. Dort herrscht ein wildes Treiben. Menschen beim Shopping, Straßenbahnen, die sich mit schrillem Klingeln einen Weg bahnen. Ich erinnere mich an meine täglichen Fahrten mit der Bahn als Schüler. Unzählige Stunden, morgens zwischen Zeitung lesenden Pendlern in Anzügen, mittags zwischen nach Schweiß stinkenden, besoffenen Proleten, Kindern und seufzenden Rentnern. Und dann ist er auf einmal direkt vor mir: der Ludwigsplatz. Mein Ziel. Das Ende. Ich laufe langsam aus, weiß nicht, wann ich stehen bleiben soll. Es gibt ja keine Ziellinie. Ich habe fertig! Yeah! Keine Sau hier. Doch, weiter hinten erhebt sich ein alter Schulfreund aus einem Sitz. Und dann gesellt sich noch ein Studienkollege meiner Frau zu uns, der das Ganze wohl auf Facebook verfolgt hatte. Ach Mist, ich habe das TV-Team ganz vergessen. Der Warnanruf von mir vorhin kam wohl zu spät. Die wollten doch unbedingt meine Ankunft filmen! Pech. Suse, die Frau von Colling, einem meiner besten Freunde, kommt auch. Ich darf heute bei ihnen schlafen. »Three is a crowd«, hier ist ja richtig was los! Und jetzt kommt das Fernsehteam an. Ich soll für die Aufnahmen noch einmal ins nicht vorhandene Ziel laufen. Mit Ziehwagen und gespielter Freude. Ich mache das mit. Fake News! So schnell geht das. Ich gebe ein kurzes Interview, und sie verabschieden sich wieder. Irgendwann stehen nur noch Suse, Micha und ich da. Wir beschließen, zu gehen.
Das war’s dann wohl. Es fühlt sich seltsam an. Da habe ich zwei Wochen lang gebangt, ob ich diesen Moment erleben werde, und trotzdem bleibt die erwartete Freude, die überschwängliche Freude, aus. Ich muss an Rafael Fuchsgrubers Worte denken. Er schickte mir, nachdem er mich zwei Tage lang begleitet hatte, eine Nachricht, in der er mir riet, ich solle den Moment genießen, wenn mir bewusst würde, es geschafft zu haben. Man würde das oft vergessen. Ich gebe ja mein Bestes, aber komme dann irgendwann zu dem Schluss, dass ich das alles erst mal verarbeiten muss. Ist wie mit dem Abitur. Jedes Mal, wenn ich als junger Schüler Abiturienten feiern sah, wurde ich neidisch und stellte mir vor, wie unglaublich groß meine Freude sein würde, wenn ich diese Scheißschule endlich hinter mich gebracht hätte. Aber es ist wohl irgendwie menschlich, dass man sich dann sofort auf das nächste Ziel fokussiert, sich die nächste Sorge schafft. Mit etwas Abstand ist mir klar geworden, dass ich diesen Zielmoment, diese erwartete Freude, schon viel früher gespürt habe: Es war bei Bad Godesberg, als ich kurz vor dem Campingplatz die Landesgrenze zur Pfalz überquerte. Da wusste ich zum ersten Mal: Du kannst das schaffen! Da hatte ich das einzige mal Pipi in den Augen. Dasselbe Pipi, das man auch beim ersten Marathon-Finish in den Augen hat. Da kam schon einiges zusammen. Mit dem Blick aufs Siebengebirge saß ich vor meinem Zelt auf dem Campingplatz und musste an meine Kindheit denken. Und daran, wie wir dort mit meinen Großeltern zum Drachenfels gewandert sind.