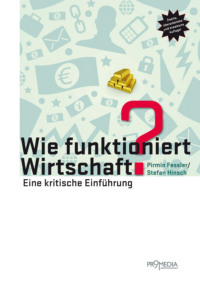Kitabı oku: «Wie funktioniert Wirtschaft?»

© 2013 Promedia Druck- und Verlagsgesellschaft m.b.H., Wien
Lektorat: Gregor Kneussel
Cover: Gisela Scheubmayr
ISBN: 978-3-85371-816-2
(ISBN der gedruckten Ausgabe: 978-3-85371-362-4)
Fordern Sie unsere Kataloge an:
Promedia Verlag
Wickenburggasse 5/12
A-1080 Wien
E-Mail: promedia@mediashop.at
Internet: www.mediashop.at
Inhalt
Die Autoren
Einleitung
1. Woher wir wissen, was sieben Milliarden Menschen brauchen oder zumindest kaufen wollen
Markt
Homo œconomicus
Externalitäten
Konkurrenz
Transparenz und asymmetrische Information
Soziale Gerechtigkeit
Der Wohlfahrtsstaat
Freiheit und Unternehmertum
Informationsdefizit der Planwirtschaft
Principal-Agent-Probleme
Und? Wer koordiniert jetzt die Wirtschaft?
2. Geld sind Zahlen in Büchern von Banken und die Schulden von jemand anderem
Geld als Recheneinheit
Geld als Mittel zum Konsumtransfer über die Zeit
Der Zusammenhang zwischen Zins und Geld
Zinskritik
Die Neutralität des Geldes
Inflation und Deflation
Oder ist Geld doch nicht neutral?
Das Geld auf unserem Konto sind die Schulden von jemand anderem: Geldbasis und Kreditschöpfung
Der Goldstandard
3. Finanzmärkte verteilen Kapital und Einkommen und werden manchmal gerettet
Kreditvergabe und Bankensystem
Geldmarkt
Kapitalmarkt
Von Credit Default Swaps, Optionen und Verbriefungen
Hochfrequenzhandel und Cross-Border-Leasing
Die Effizientmarkthypothese
Liberalisierung der Finanzmärkte
Amoklauf
4. Warum die Wirtschaft wächst und wer etwas davon hat
Was wächst?
Die Wachstumsrate
Seit wann gibt es Wirtschaftswachstum?
Wachstumstheorie
Wachstumspfad
Muss die Wirtschaft wachsen?
Wachstum und Verteilung
5. Warum die Wirtschaft manchmal schrumpft
Der klassische Liberalismus und das saysche Gesetz
Arbeitslosigkeit, Lohnhöhen und flexible Arbeitsmärkte
Krise als Strafe für das Abweichen vom freien Markt
Keynes und die Gesamtnachfrage
Zu viel gespart: Die Wirtschaft aus dem Gleichgewicht
Stabilität schafft Risiko: Ein Bürohaus in Warschau
Konjunkturpolitik
Der keynesianische Multiplikator
»Crowding out« und »ricardianische Äquivalenz« – liberale Kritik
Staatsschulden, Überschuldung, und warum sich Deutschland praktisch unbegrenzt Geld leihen kann
Wenn Staatsschulden reduziert werden müssen
Die Zentralbank: Konjunktur und Geldpolitik
Rezession und Deflationsgefahr
Deflation und Schuldendeflation
Möglichkeiten der Notenbank – kurzfristige Zinssätze und die Notenbank als »Kreditgeber letzter Instanz«
Und wenn das nicht reicht? Langfristige Zinsen und »Quantitative Easing«
Und wenn das auch nicht reicht? Die Grenzen der Geldpolitik in einer Wirtschaftskrise
Nicht nur der Zinssatz zählt: Geldpolitik und staatliche Regulierung
Wachstumsschwäche seit den 1970er Jahren
Krise seit 2007
6. Warum internationaler Handel notwendig ist und welche Gefahren damit verbunden sind
Ein Tal in Tirol
Freihandel und Protektionismus
Handel und die Vorteile der Massenproduktion
Agglomerationseffekte
Kostenvorteile und Entwicklungssackgassen
Wie Handelsströme lenken? Methoden des Protektionismus
Probleme beim Eingreifen des Staates
Freier Handel – hohes Wachstum?
7. Wie ein Wechselkurs entsteht, welche Auswirkungen das hat und warum Zahlungsbilanzkrisen hin und wieder die Wirtschaft zerstören
Die Zahlungsbilanz
Die Zahlungsbilanz und der Wechselkurs
Sparen und Investieren
Wodurch wird ein Wechselkurs bestimmt?
Auswirkungen von Auf- und Abwertungen
»Never find a raw material« – die holländische Krankheit
Fixe und flexible Wechselkurse
Also fixe Wechselkurse? Das ist auch nicht so einfach
Fallbeispiel Eurozone
Zahlungsbilanzkrisen
»Our money – your problem« – die Weltreservewährung
8. So klein die Welt, so groß die Unterschiede
Globalisierung und Konvergenz – kleinere Welt, kleinere Unterschiede?
Sinkende Masseneinkommen
Marktmacht
Verteilung und Krise
Staat, Steuern und Verteilung
Die Verteilung von Vermögen
Verteilung und Demokratie
Auswahlbibliografie
Weitere E-Books von Promedia
Die Autoren
Pirmin Fessler, geboren 1980 in Bregenz, Vorarlberg. Studium der Volkswirtschaftslehre an der Universität Wien, arbeitet als Ökonom in der Abteilung für volkswirtschaftliche Analysen der Österreichischen Nationalbank und ist Mitglied des Household Finance and Consumption Network der Europäischen Zentralbank.
Die in dem Buch vertretenen Meinungen sind ausschließlich jene der Autoren und nicht jene der Österreichischen Nationalbank bzw. des Eurosystems.
Stefan Hinsch, geboren 1976 in Wien, Studium der Geografie und Wirtschaftskunde, sowie der Geschichte, arbeitet als Mittelschullehrer in Wien, langjährige Erfahrung in der Erwachsenenbildung.
Einleitung
Warum ein Buch Wie funktioniert Wirtschaft? Über Wirtschaft und ihre Grundlagen gibt es bereits unzählige Bücher: tonnenweise Betriebswirtschaft, hunderte Meter Steuerspartipps und ultimative Management-Modelle. Seit 2008 sind zahlreiche Bücher über die Finanz- und Wirtschaftskrise erschienen, einige davon mit durchaus guten Analysen.
Natürlich gibt es auch Einführungen in die Volkswirtschaftslehre zur Genüge. Diese zeichnen sich allerdings meist dadurch aus, dass VWL-Studierenden volkswirtschaftliche Theorie und Modellbildung im Telefonbuchformat vermittelt wird. Für die Frage »Wie funktioniert Wirtschaft?« ist aber nicht alles davon notwendig und manches wahrscheinlich sogar hinderlich. Viele potenzielle Leserinnen und Leser werden auch durch den mathematischen Apparat abgeschreckt, der volkswirtschaftliche Theorie häufig begleitet.
Nach dem Beginn der Krise 2007/2008 wurden eine Reihe von Darstellungen der Volkswirtschaftslehre in allgemein verständlicher Form veröffentlicht. Den meisten fehlt dabei allerdings der kritische Blickwinkel, oder sie schreiben eine »Geschichte der Volkswirtschaftslehre« oder der »großen Ökonomen«, anstatt zu erklären, »wie Wirtschaft funktioniert«. Genau diesem Mangel soll dieses Buch abhelfen. Es wird dabei kein Anspruch auf Vollständigkeit erhoben, aber doch auf einen umfassenden Überblick. Wir hoffen, dass dieser Text sich als unmittelbar nützlich erweist, etwa für Studierende der Geschichte, die eine Einführung in die Konjunkturtheorie benötigen, wenn sie sich mit der Zwischenkriegszeit beschäftigen, oder für LehrerInnen der Geografie und Wirtschaftskunde, welche die Zusammenhänge der Außenwirtschaft nachlesen möchten. Wir glauben aber auch, dass Grundlagen der Wirtschaftskunde gesellschaftlich relevant sind.
Heute ist der öffentliche Diskurs über Wirtschaft nämlich merkwürdig verzerrt: Auf der einen Seite erscheint das Funktionieren von Wirtschaft ausschließlich dem Reich der Expertinnen und Experten zugehörig. Ihre Entscheidungen sind für die Öffentlichkeit nicht nachvollziehbar, müssen aber befolgt werden, sonst droht – wie uns gesagt wird – Schlimmes. Auf der anderen Seite gibt es eine Reihe trivialer Stehsätze einer neoliberal ausgerichteten Volkswirtschaftslehre. Diese sind griffig, aber häufig problematisch. Geboten werden etwa Maximen wie »Der Staat kann nicht wirtschaften«, »Liberalisierungen verbessern das Marktergebnis« oder »Wir dürfen nicht mehr ausgeben als wir einnehmen, denn Schulden gehen auf Kosten künftiger Generationen«. Solche Aussagen sind nicht notwendigerweise falsch, immer aber zu einfach und lassen sich im Allgemeinen auch nicht aus volkswirtschaftlicher Theorie herleiten.
»Wie funktioniert Wirtschaft?« liefert Erklärungen, mit denen die herrschende Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik besser verstanden und hinterfragt werden können. Das Buch liefert Argumente, mit denen Leserinnen und Leser diesen trivialen Stehsätzen begegnen können.
Wir beschäftigen uns dabei nicht mit neuen Formeln zu den Problemen der Weltwirtschaft. Dieser Text nennt sich »kritische Einführung«, bleibt aber immer an den so genannten Mainstream der Volkswirtschaftslehre und damit an den vorherrschenden Diskurs über Wirtschaft anschlussfähig – auch und gerade wenn wir dessen Argumente und Positionen angreifen. Wir verwenden auch oft seine Sprache und seine Beispiele. Tatsächlich gibt es eine ganze Reihe alternativer Strömungen der Wirtschaftswissenschaft, aber sie sind alle in Nischen zurückgedrängt. Nach der weit gehenden Selbstauflösung marxistischer Theorie ist der Mainstream das einzige umfassende und kohärente Theoriegebäude über das Funktionieren von Wirtschaft; an diesem muss man sich abarbeiten, sonst droht die Gefahr, in esoterischen Geheimlehren zu versinken.
Dieses Buch ist kein wissenschaftliches. Wir verzichten auf detaillierte Quellenangaben und sind uns dessen bewusst, dass die hier referierten und nicht strikt voneinander getrennten Fakten, Ideen, Ansichten und Meinungen nicht allein die unseren sind. Im Gegenteil beinhaltet dieses Buch ein breites Spektrum aus volkswirtschaftlicher Theorie, ist aber auch versetzt mit Erkenntnissen anderer Sozialwissenschaften und durchwegs auch mit persönlichen Meinungen. Alles ist der Maxime untergeordnet, daraus ein einfach verständliches Substrat zu bilden.
Mit der Weltwirtschaft ändert sich auch die Wirtschaftskunde und es wechseln die Themen, die faszinieren. Die große Weltwirtschaftskrise, die 2007 begonnen hat, gebietet einen relativ großen Teil zur Krisentheorie sowie zum Funktionieren des Kreditsystems und des Bankwesens. Auch bei den gewählten Beispielen versuchen wir, neue und jüngste Entwicklungen zu berücksichtigen.
Pirmin Fessler und Stefan HinschWien, im April 2013
1. Woher wir wissen, was sieben Milliarden Menschen brauchen oder zumindest kaufen wollen
Um ein altes Beispiel der Volkswirtschaftslehre hervorzukramen: Wir wollen Robinson Crusoe auf seiner Insel bemühen. Robinson Crusoe geht fischen, weil er etwas zu essen braucht. Er baut ein Haus, um sich vor der Kälte und vor wilden Tieren zu schützen. Er stellt Werkzeuge her, um seine übrigen Arbeiten effizienter zu gestalten. Robinson Crusoe würde nicht auf die Idee kommen, tonnenweise Fische zu fangen, die er weder essen noch konservieren kann. Er erzeugt auch nicht zwanzig Hämmer, wenn er nur drei benötigt. Er arbeitet mit knappen Ressourcen – sein Arbeitstag ist begrenzt – und wird immer genau das herstellen, was ihm im Augenblick dringlich erscheint.
Es ist unmittelbar nachvollziehbar, dass das in einer Weltwirtschaft, an der mehr als sieben Milliarden Menschen teilnehmen, nicht ganz so einfach sein kann. Warum erzeugt ein Stahlwerk in Südkorea die richtige Menge an Stahlträgern, die dann am Persischen Golf in Hochhäuser hineinbetoniert werden? Wie kann bestimmt werden, wie viele Becher Erdbeerjogurt gebraucht werden, wie viele Paar Herrenschuhe und wie viele Krankenhäuser? Warum produzieren sieben Milliarden Menschen, was andere sieben Milliarden brauchen? Wie wird das koordiniert?
Um eine erste Einschränkung zu treffen: Sehr oft wird eben nicht produziert, was gebraucht wird – oder es wird zwar produziert, aber jene, welche die Dinge brauchen, bekommen sie nicht. Ein Beispiel: Etwa eine Milliarde Menschen auf der Welt leiden an akuter Unterernährung. Diese bräuchten eigentlich zusätzliche Lebensmittel, bekommen sie jedoch nicht – und das, obwohl die weltweite Agrarproduktion völlig ausreichend wäre, um alle zu ernähren. Noch ein Beispiel: Tatsächlich wurden in den letzten Jahren zwar nicht zu viele Stahlträger erzeugt, wohl aber zu viele Hochhäuser am Persischen Golf. In jeder Wirtschaftskrise bleiben Waren liegen, die nicht mehr abgesetzt werden können, und in der Folge wird dann die Produktion eingeschränkt und Menschen verlieren ihre Arbeit.
Dennoch ist es offensichtlich, dass die Weltwirtschaft nicht ununterbrochen in totalem Chaos auseinanderfällt. In der bisher schwersten Wirtschaftskrise seit der industriellen Revolution, der »Großen Depression« mit ihrem Höhepunkt 1931 war vielleicht ein Drittel der Menschen arbeitslos. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass selbst in dieser Situation zwei Drittel immer noch beschäftigt waren. Es geht keineswegs darum, die Bedeutung von Krisen zu relativieren, denn die Rate der Arbeitslosigkeit in den 1930er Jahren hat ausgereicht, um die Gesellschaft in ihren Grundfesten zu erschüttern. Dennoch muss es Mechanismen geben, die Ordnung in ein völliges Chaos bringen, zumal die Arbeitslosigkeit für gewöhnlich auch nicht dreißig Prozent beträgt.
Das Problem der Koordinierung der Wirtschaft beginnt nicht in der Steinzeit. Das Robinson-Crusoe-Beispiel zeigt, dass diese Schwierigkeiten offensichtlich mit Arbeitsteilung und Austausch von Gütern zusammenhängen. Obwohl es Handel schon sehr lange gibt, ist zu bemerken, dass die Produktion von Gütern für den Austausch bis in die Neuzeit nur einen kleinen Teil der wirtschaftlichen Aktivitäten der Menschen abgedeckt hat. Die Gesellschaft wurde von der »Subsistenzwirtschaft« oder »Hauswirtschaft« dominiert, der Leistungsproduktion von Familiengemeinschaften und von diesen Familiengemeinschaften abhängigen Personen für den Eigenbedarf. Damit beschäftigten sich auch die VorläuferInnen der Wirtschaftswissenschaft: Das Wort Ökonomie kommt vom griechischen oîkos, dem Haus, und die oikonomía des Aristoteles meint die gute Bestellung des Hauses (mit vielen praktischen Tipps, etwa wie SklavInnen zu behandeln sind oder was bei der Aussaat zu beachten ist). Die europäische Landwirtschaft – und das ist der ganz überwiegende Teil der Wirtschaft Europas bis in das 19. Jahrhundert – beginnt (mit Ausnahmen, etwa im Weinbau) frühestens im 16. Jahrhundert mit Produktion, die nicht mehr in erster Linie auf die Selbstversorgung ausgerichtet ist. In vielen Ländern der Erde ist die Subsistenzwirtschaft bis heute die Lebensgrundlage eines großen Teils der Bevölkerung. Der Trend zur Ausweitung der Arbeitsteilung ist dabei bis heute ungebrochen. Das zeigt sich nicht nur an der Vertiefung der Integration der Weltwirtschaft und der Zunahme des Welthandels, sondern auch an der weiteren Zurückdrängung der Hauswirtschaft. Aus jener abgegeben wurden etwa erst in jüngster Zeit die Betreuung von Kleinkindern in Kindergärten oder weite Teile der Nahrungszubereitung. Beim Verarbeiten von Lebensmitteln erledigen wir heute nur mehr die allerletzten Schritte: Selbst wer keine Mikrowellen-Gerichte isst, bäckt sein Brot nicht mehr selbst und knetet auch keinen Nudelteig.
Die entstehende Wirtschaftswissenschaft entdeckt das Koordinierungsproblem gerade zu dem Zeitpunkt, als die Koordinierung schwieriger wird. Das liegt an der fortschreitenden Arbeitsteilung, der Ausweitung der Geldwirtschaft und der Möglichkeit, Geld zu sparen oder Kredite zu bekommen. Im Laufe der Neuzeit treten langsam neue Typen von Krisen auf. Zuvor ist eine Wirtschaftskrise meist eine Krise der Subsistenz und damit eine Krise der Landwirtschaft. Der Grund kann eine relative Überbevölkerung sein (relativ zu den Produktionsmöglichkeiten der Landwirtschaft) oder der Zusammenbruch von landwirtschaftlichen Produktionsarrangements, etwa politische Wirren, die Bewässerungssysteme verfallen lassen. Eine derartige Krise ist eine Krise des »zu wenig«, in der Seuchen eine vom Hunger geschwächte Bevölkerung heimsuchen. Solche traditionellen Gesellschaften kennen aber auch keine Arbeitslosen.
Im Laufe der Neuzeit entwickeln sich neue Krisen, die mit der einsetzenden Modernisierung einhergehen. Die Modernisierung der englischen Landwirtschaft im 17. Jahrhundert führt zur Vertreibung der Bauernschaft von ihrem Land und zur Entstehung von Armeen von BettlerInnen. In den 1840er Jahren besingt Gerhart Hauptmann die schlesischen Weber, die von den Dampfwebstühlen in Elend und Arbeitslosigkeit getrieben werden. Im selben Jahrzehnt kommt es erstmals zu Absatzkrisen der Industrieproduktion und zu staatlichen Arbeitsprogrammen (etwa in Frankreich), um die politischen Auswirkungen des Elends in Grenzen zu halten.
Diese Krisen sehen anders aus als jene traditioneller Gesellschaften. Nun gibt es Menschen, die in Not leben, weil sie keine Arbeit haben, und gleichzeitig Betriebe, die ihre Produktion drosseln, weil der Absatz schwierig wird. Solche Krisen werden von unterschiedlichen Schulen der Volkswirtschaftslehre unterschiedlich interpretiert, aber es entsteht eine Debatte darüber, wie die Koordinierung der Wirtschaft möglich ist und warum sie zeitweise zusammenbricht.
In den letzten gut zweihundert Jahren hat die Volkswirtschaftslehre mehrere Mechanismen wirtschaftlicher Koordinierung aufs Tapet gebracht. Da wäre einmal die spontane Ordnung des Marktes, die sich unabhängig vom einzelnen menschlichen Willen vollziehen soll. Außerdem hätten wir da das bewusste, auf ein Ziel gerichtete Eingreifen des Staates oder anderer Institutionen, welches als »Planung« bezeichnet werden kann. Es gibt Vorstellungen, welche die Ordnung der Wirtschaft als weder unmittelbar geplant noch als völlig spontan begreifen, sondern als abhängig von institutionellen Arrangements, etwa von der Art des Zusammenwirkens von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden bei der Festsetzung von Löhnen oder von der Stellung der Zentralbank.
Es gibt kaum jemanden, der das gleichzeitige Auftreten aller drei Faktoren bestreiten würde. Über die Gewichtung kann freilich gestritten werden, denn – so viel sei vorausgeschickt – das Problem lässt sich nicht mit mathematischer Sicherheit lösen. Letztlich bleibt es eine politische und eine ethische Frage, was aber die Begründung der einzelnen Positionen keineswegs unbedeutend macht.
Gerade in den letzten Jahrzehnten wurde – ob zu Recht oder nicht – im Allgemeinen der Markt als wichtigste und beste Instanz wirtschaftlicher Koordinierung betrachtet.
Markt
Ein Markt wird definiert als Ort des Aufeinandertreffens von Kauf- und Verkaufsinteresse, von Angebot und Nachfrage. Auf Märkten werden Preise gefordert und bezahlt. Wir wollen nicht zu lange mit Trivialitäten langweilen, aber tatsächlich fallen Preise, wenn die Nachfrage gleich bleibt und das Angebot steigt, und Preise steigen, wenn ein geringes Angebot auf hohe Nachfrage trifft; und die Angebots- und Nachfrageentscheidungen reagieren ihrerseits auf diese Preise. Der Markt vermag dadurch, individuelle Angebots- und Nachfrageentscheidungen über die sich bildenden Marktpreise aufeinander abzustimmen. Die Sache ist dabei nicht immer ganz so einfach. Industrieprodukte können bei sinkender Nachfrage auch teurer werden, weil die Produktionskosten pro Stück steigen, wenn weniger abgesetzt werden kann. (Mehr dazu weiter unten.)
Der schottische Aufklärer Adam Smith war der Erste, der von der »unsichtbaren Hand« des Marktes gesprochen hat, welche die Wirtschaft lenkt. Tatsächlich sagte Smith viele Dinge, die zum Teil nicht mit dem ihm nachgesagten Marktliberalismus zu vereinbaren sind; aber oft geht es nicht darum, was gesagt wurde, sondern wie Menschen das Gesagte verstehen wollen. Es ist kein Wunder, dass die Idee des Marktes in der Traditionslinie der Aufklärung steht. Diese etablierte das Individuum und dessen Freiheit in der Philosophie. Das Denken des Mittelalters war nicht auf einzelne Individuen, sondern auf Korporationen, auf menschliche Verbände und Gemeinschaften gerichtet. Smith propagierte die über den Markt koordinierten Individuen als Gegensatz zum absolutistischen Zwangsstaat.
Wir bauen uns ein ganz einfaches Modell einer Wirtschaft, um die Funktion des Marktes zu erklären: Produziert werden nur zwei Waren – sagen wir Nahrungsmittel und Werkzeuge –, die in gleicher Menge benötigt werden (alle möchten Nahrung und Werkzeuge in gleicher Menge) und die auch bei der Herstellung den gleichen Aufwand an Arbeit verursachen. Idealerweise stellt dabei auch jeweils die Hälfte der WirtschaftsteilnehmerInnen eine der beiden Waren her. Die AkteurInnen treffen ihre Produktionsentscheidungen allerdings völlig autonom.
Es ist also durchaus möglich, dass in einer ersten Phase z. B. zu viele Nahrungsmittel und zu wenige Werkzeuge hergestellt werden. Beim Austausch (es entsteht ein Markt) wird ein relativer Mangel an Werkzeugen und ein Überangebot an Nahrungsmitteln festgestellt. Der Markt reagiert: Die relativen Preise verschieben sich, es müssen nun mehr Lebensmittel geboten werden, um ein Werkzeug zu erhalten. In der nächsten Periode wird der festgestellte Marktpreis die Angebotsentscheidungen ändern: Um die höheren Preise zu nutzen, werden einige Bauern auf die Produktion von Werkzeugen umsteigen.
Wir analysieren das nun etwas genauer: Über den Markt kommen die Hämmer, Sägen und Schaufeln aus unserem Beispiel jenen zu, die bereit sind, den relativ hohen Preis zu bezahlen. Das werden jene sein, die sich vom Einsatz der Werkzeuge den höchsten Nutzen erwarten – einen Nutzen, der über dem Preis der Werkzeuge liegt. Wenn eine Bäuerin in unserem Modell unbedingt sofort einen Hammer braucht, um einen Zaun zu bauen – andernfalls laufen ihre Schafe davon – dann wird sie bereit sein, auch höchste Preise zu bezahlen, da ihr Verdienstausfall ohne Hammer noch höher wäre. Ein anderer Bauer, der den Hammer für das Renovieren seiner Veranda wollte, verschiebt den Kauf vielleicht auf das nächste Jahr – so wichtig ist die Veranda auch nicht. Dem Bauern mit der ausbruchfreudigen Schafherde mag der hohe Werkzeugpreis ungerecht erscheinen, aber er wäre noch viel schlechter dran, wenn sich die Preise nicht nach oben anpassen würden: Wäre der Hammerpreis aus irgendwelchen Gründen fix, dann bekämen die knappen Hämmer einfach jene, die früher aufstehen. Unter Umständen würde dann die Veranda fertig, aber die Schafe wären davongelaufen und insgesamt wäre hoher Schaden entstanden. Der Markt teilt die knappen Ressourcen konkurrierenden Zielen zu: Veranda oder Schafherde, beides ist nicht möglich.
In unserem Beispiel ist aber noch mehr passiert: Der Marktpreis für Nahrungsmittel und Werkzeuge hat Investitionsentscheidungen beeinflusst; der relativ höhere Preis für Werkzeuge hat einige Bauern dazu bewogen, Werkzeuge herzustellen, was wiederum den Preis der Werkzeuge gesenkt hat. Im Prinzip ist das eine Variation des Themas: Der Markt teilt knappe Ressourcen konkurrierenden Zielen zu. Arbeit ist knapp. Ebenso begrenzt ist Kapital (etwa Maschinen), wenn auch die Produktion in unserem Beispiel relativ wenig kapitalintensiv ist, sonst könnten die Bauern nicht so einfach den Beruf wechseln. Alles gleichzeitig produzieren geht sich nicht aus. Entweder Nahrungsmittel pflanzen oder Werkzeuge bauen – was davon gerade zweckmäßig ist, kann durch den Markt geregelt werden.
Das Funktionieren des Marktmechanismus erwartet dabei von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern kein soziales Gewissen, christliche Nächstenliebe oder Stolz auf den Beruf des Vaters. Ganz im Gegenteil: Am besten funktioniert alles, wenn jeder seinen eigenen unmittelbaren Vorteil verfolgt. In der Volkswirtschaftslehre wird das als »Nutzenmaximierung« bezeichnet. Für das Funktionieren des Marktes ist dies in jedem Fall von Vorteil. Unser einfaches Modell würde in jedem Fall schlechter funktionieren, wenn es einen Eingriff von außen gäbe. Ein Staat, der Preise festlegt, mittelalterliche Handwerkszünfte, die den Wechsel des Berufs verhindern – all das ist nicht notwendig. Der Markt regelt sich selbst. Ganz im Gegenteil, jede Staatsintervention würde ein Ergebnis bringen, das – gemessen am möglichen gesamten Output unserer Wirtschaft – hinter den Ergebnissen eines »freien Marktes« zurückbleibt.
Es ist nicht besonders schwierig, unser Modell der Bauern und Werkzeugmacherinnen auszuweiten. Wir könnten statt der zwei Berufsgruppen auch hundert oder tausend setzen, ohne dass sich das Funktionieren des Marktes verändern würde.
Im Wesentlichen können wir auf diese Art mit ein paar Bauern und Handwerkerinnen scheinbar die Überlegenheit der freien Marktwirtschaft zeigen. Ganz so leicht ist es allerdings nicht.
Die Neoklassik hat aus dem Marktmodell die »Allgemeine Gleichgewichtstheorie« gemacht. Diese versucht, die Bildung von Preisen etwas genauer zu erklären, und beschreibt ein allgemeines Gleichgewicht zwischen dem gesamten Angebot und der gesamten Nachfrage.
Dabei sorgen die Kalküle der Individuen dafür, dass sie ihren Nutzen anhand ihrer eigenen Güter und jener, die sie eintauschen können, maximieren. Dieser Tauschprozess führt – so die Allgemeine Gleichgewichtstheorie – zu einem Gleichgewicht, bei dem niemand mehr weiter tauschen will, also niemand mehr durch Tausch bessergestellt werden kann, ohne dass ein anderer schlechtergestellt werden würde, der deswegen auch gar nicht mehr tauschen will. In diesem Sinne sind die Güter optimal verteilt, was in der Volkswirtschaftslehre nach Vilfredo Pareto als »Pareto-optimal« bezeichnet wird. In unserem Beispiel mit Bauern und Handwerkerinnen könnte das etwa so aussehen: Ein Bauer produziert 100 Lebensmittel, eine Werkzeugmacherin 40 Werkzeuge. Der Bauer benötigt 20 Lebensmittel zum Überleben und würde gern die übrigen Lebensmittel gegen Werkzeuge tauschen. Die Werkzeugmacherin benötigt 20 Werkzeuge, um weiteres Werkzeug erstellen zu können, und würde gerne die übrigen Werkzeuge gegen Lebensmittel tauschen. Also stehen nun 80 Lebensmittel auf dem Markt 20 Werkzeugen gegenüber. Bedeutet das nun, dass 80 Lebensmittel gegen 20 Werkzeuge getauscht werden und damit der Preis von Lebensmittel zu Werkzeugen 4:1 wäre, also 4 Lebensmittel für 1 Werkzeug bezahlt werden müssten? Nicht unbedingt. Das hängt von den so genannten Präferenzen der zwei Marktteilnehmer ab.
Die Volkswirtschaftslehre stellt einige Annahmen auf, damit ein Tausch zustande kommen kann. Erst einmal können beide, Bauer und Werkzeugmacherin, einschätzen, was ihnen lieber ist, hätten sie noch nichts davon: Werkzeuge oder Lebensmittel. Zudem sinkt der zusätzliche Nutzen einer weiteren Einheit eines Gutes mit der jeweiligen Menge, die sie von diesem Gut schon haben. Das erste Lebensmittel ist mehr wert als das zehnte. Der Bauer braucht in unserem Beispiel 20 Lebensmittel, um zu überleben, das zwanzigste wird ihm also deutlich wichtiger sein als das einundzwanzigste, aber das einundzwanzigste noch wichtiger als das zweiundzwanzigste usw.
Je nach den Präferenzen der beiden wird also am Ende eine Tauschrelation zustande kommen. Nehmen wir an, die Werkzeugmacherin ist mit dem Angebot einer Tauschrelation von 3:1 konfrontiert, d. h. der Bauer will nicht mehr als 3 Lebensmittel für 1 Werkzeug ausgeben. Mit dieser Tauschrelation konfrontiert beginnt die Werkzeugmacherin, zu tauschen. Am Beginn des Tausches werden die ersten Lebensmittel, die sie kauft, ihr noch deutlich mehr wert sein, da sie noch nichts zu essen hat. Aber je mehr Essen schon eingetauscht ist, desto weniger wird ihr ein zusätzliches Lebensmittel wert sein.
Aus diesem Grund wird sie genau so lange tauschen, bis ihr zusätzlicher Nutzen gleich der Tauschrelation ist, zu der sie tauschen kann. Sobald ihr ein zusätzliches Lebensmittel nicht mehr mindestens ein Drittel des Nutzens eines Werkzeugs bringt, wird sie nicht mehr bereit sein, 1 Werkzeug gegen 3 Lebensmittel zu tauschen. In der Modellwelt stellen alle Individuen gleichzeitig diese Überlegungen an und so entstehen Tauschrelationen für alle Güter. Die Tauschrelation ist eigentlich nicht viel anderes als ein Preis beziehungsweise bestimmt den Preis.
Tatsächlich gibt es aber weit mehr als zwei Güter und in der Folge sehr viele unterschiedliche Tauschrelationen. Wie kann es sein, dass eine gigantische Anzahl an relativen Preisen abgesprochen wird, deren Grundlage die Nutzenmaximierungskalküle aller Individuen sind, wovon jedes einzelne den Preis jedoch gar nicht beeinflussen kann? In unserem Beispiel von vorhin war das noch einfach, da nur zwei Individuen, Bauer und Werkzeugmacherin, beteiligt waren und der Bauer von vornherein nur je 3 Lebensmittel gegen 1 Werkzeug tauschen wollte. Da es gar kein anderes Angebot gab, kann auch kaum von einem freien Markt gesprochen werden. Die Werkzeugmacherin benötigte Lebensmittel und musste den Preis, den der Bauer bestimmte, einfach akzeptieren – schließlich muss sie doch etwas essen.
Bei einer großen Anzahl Menschen und Güter sollte sich das recht schwierig lösen lassen, da der Bauer durch andere Bauern Konkurrenz hat, die ihn unterbieten können, sodass am Ende kein einzelner mehr Preise bestimmen kann. Die Frage, die sich stellt, ist aber dann: Wer bestimmt die Preise und wie kann es sein, dass sie dann genau den Preisen entsprechen, die sich durch die einzelnen Nutzenkalküle ergeben?
In der Allgemeinen Gleichgewichtstheorie löst dieses Koordinierungsproblem ein Gedankenexperiment, der so genannte »Auktionator«. Zunächst tauscht keiner, denn die Preise werden erst durch die Offenbarung der Nutzenkalküle der Einzelnen durch ihre Bereitschaft zu tauschen offengelegt. Der »Auktionator« ruft nun allen bestimmte relative Preise zu bis eine Kombination von relativen Preisen die Tauschbedürfnisse so erfüllt, dass die Märkte geräumt sind, also Angebot und Nachfrage übereinstimmen und niemand mehr tauschen wollen würde. Erst zu diesen Preisen wird dann tatsächlich getauscht. Dass die Märkte zu diesen Preisen geräumt sind, heißt nicht, dass es nicht in einzelnen Märkten noch ein Überangebot geben kann. Es kann also durchaus sein, dass Menschen noch gern Lebensmittel gegen Werkzeuge tauschen würden, aber nur mehr Lebensmittel angeboten werden. Das würde bedeuten, dass auf dem Markt für Werkzeuge ein Nachfrageüberschuss besteht und auf dem Markt für Lebensmittel ein Überangebot.
Das Gleichgewicht kennzeichnet sich dadurch, dass die überschüssige Nachfragemenge an Werkzeugen zu den Gleichgewichtspreisen denselben Tauschwert hat, wie das Überangebot an Lebensmittel. Anders gesagt, die Summe der Überschussnachfrage (die »aggregierte Überschussnachfrage«) muss immer null sein.
Unsere Bauern und Handwerkerinnen sind ein Modell, reale Märkte sehen anders aus. Und bei der Erstellung des Modells wurden wahrhaft heroische Annahmen getroffen: Alle handeln immer rational und haben nur ihren eigenen Vorteil im Kopf. Alle haben alle relevanten Informationen. Es herrscht vollständige Konkurrenz. Es gibt keine Zeit und kein Geld. Die Menschen sind völlig vereinzelte Individuen. Und noch ein paar mehr. KritikerInnen der Neoklassik gemahnen deren Modelle an »Steinzeitmenschen, die am Rande des Waldes Wurzeln und Beeren tauschen.« Wir versuchen nun, diese Annahmen ein wenig zu hinterfragen.