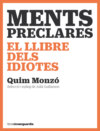Kitabı oku: «Hundert Geschichten», sayfa 11
Oldeberkoop
Für Marcelo Cohen, den tollen Hecht
– Hört es denn nie auf zu schneien? Ich will hier weg. Seit wie vielen Tagen sind wir hier? Elf? Oder zehn? Zehn oder elf: Ich habe den Überblick verloren. Wenn nicht einmal du ihn hast, der der Meinung war, es würde nicht lange schneien und der Schnee bleibe nicht liegen, da es kürzlich geregnet habe! Die Dinge fangen immer klein an und am Ende verschlingen sie dich. Was schreibst du da? Wir sind alle so ernst hier drin . . . All diese Leute hier sind so ernst, dass sie irgendwann schlicht anfangen zu saufen. Wenn sie saufen, fürchte ich mich etwas vor ihnen. Und sie betrinken sich so oft . . .: Es ist kaum zu glauben, dass es hier immer noch Alkohol geben soll! Die, die ausländisch reden, finde ich lustig. Wir wissen immer noch nicht, was sie sprechen. Holländisch nicht, das steht fest. Und sie sehen auch nicht aus wie Indonesier. Vielleicht sind sie Friesen. Hast du schon einmal Friesisch gehört? Vielleicht ist es Friesisch. Du meinst, sie reden hebräisch, aber wenn sie hebräisch sprächen, wären sie Israelis, und Israelis sprechen als Zweitsprache Englisch; und die hier können kein bisschen Englisch. Wir sind schon so lange hier und wissen immer noch nicht, welche Sprache es ist. Ich würde gerne mit ihnen reden. Ich würde sie fragen, wo sie herkommen, wie sie leben, was sie machen, was sie interessiert: Ich würde sie alles fragen. Ich habe es dir doch schon ein paar Mal erklärt; ich kann da nichts mehr tun: Hier passiert seit zehn oder elf Tagen rein gar nichts. Oder vielleicht zwölf? (Möchtest du einen Zug?) Ich habe Lust zu quatschen. Du kennst mich ja: Wenn ich nichts zu tun habe, rede ich wie ein Wasserfall. (Weißt du, dass wir keine Milch mehr haben?) Natürlich weißt du es: Ich habe es dir ja vor einer Weile gesagt. Und ich habe es dir gesagt, weil du es mir heute Morgen gesagt hast. Aber ich möchte dir auch etwas mitteilen. Auch wenn du es schon weißt und es deshalb nichts Neues für dich ist. Mmmhh. Wenn ich eine Wohnung hätte, würde ich in der Küche grüne Fliesen verlegen, wie diese hier. Willst du keinen Zug? Was schreibst du da? Mmmhh. Na, komm. Oh, was ist denn da zu Bruch gegangen! Das muss der Junge gewesen sein (wie heißt er gleich? Jan?). Er muss ja das halbe Geschirr zerbrochen haben. Er ist ganz unruhig, der arme Junge. Hast du gehört, was sie jetzt gesagt haben, die Friesen oder Israelis? Sie hören ja gar nicht auf zu lachen . . . Das muss ja superlustig sein. Hast du’s nicht gehört? Warum schaust du mich so an? Mmmhh, schmeckt dieses Kraut gut! Wo sie das wohl herhaben? Eigentlich war nichts mehr da, und plötzlich taucht eine ganze Menge aus dem Nichts auf. Sicher hatte es dieser eingebildete Schnösel versteckt. Er sieht so unsympathisch aus: Ich mag ihn überhaupt nicht. Bedank dich bei ihnen. Thank you, nicht? Mmmmhh, es ist sehr . . . wie soll ich das sagen? (Ach egal . . .) Wenn ich daran denke, dass ich das Zeug zu Hause angepflanzt habe: in tausend Töpfen. Jetzt raucht ihn sicher Mary Jane: Mary Jane raucht Mary Jane. Mary Jane raucht sich selbst: eine neue Form der Selbsttötung? Mmhh. Erzähl mir nicht, dass du sie nicht kennst. Mary Jane ist ein Fall für sich: Sie hatte nie eine müde Mark, aber sie hat immer den richtigen Wein angeschleppt, du weißt schon, was ich sagen will. Ich mag die Leute, die so was machen. Mmh. Es wäre das Paradies, wenn hier jetzt jemand LSD hätte. Vielleicht hat der Schnösel welches und läuft deshalb so hochnäsig herum. Hast du schon mal einen Trip geschmissen? Ja? Das wundert mich aber. Und Pilze? Pilze hast du doch sicher noch nie probiert, stimmt’s? Nein, natürlich nicht. Ich aber. Pilze sind . . . Man kann das nicht erklären. Pilze sind . . . Alles. Sie sind wie ein Film, wie ein Film von Walt Disney: der Himmel tiefblau: die Kulisse falsch und gleichzeitig so echt wie nie. So als sei alles Kulisse mit künstlichem Licht. Der Rasen so grün, ein Grün, was es überhaupt nicht geben kann. Nein, Mann, nein. Sie sind nicht wie LSD. Sag mal, zu was sagt man »Schnee«? Zu Heroin oder Kokain? Welche Ironie, jetzt von Schnee zu reden: wo wir so eingeschneit sind. Wir könnten rausgehen und uns den ganzen Schnee spritzen (oder schnüffeln, je nachdem): So würden wir wirklich gleich alles hinter uns lassen. Ich hatte mal einen Lover, der spritzte, und das war echt ein Problem, denn er bekam nie einen hoch; und wenn ich etwas nicht machen kann, krieg ich noch mehr Lust. Stell dir vor: Ich war völlig heiß darauf, mit ihm zu vögeln, und es ging nichts. Mmh. Ich habe dir doch schon gesagt, als es mit dem Schnee anfing: Lass uns gehen. Jetzt wären wir zumindest im nächsten Dorf (wie heißt es gleich?): in einem kleinen Hotel im Bett und würden Kamillentee mit Honig trinken. Was hat der Wirt gesagt? Der arme Mann, der hat nicht mit diesen ganzen Gästen in seiner Kneipe gerechnet. Wenn er wenigstens Gästezimmer hätte. Dann könnte man damit leben. Mit dieser Erfahrung jetzt kann er demnächst ein Hotel aufziehen. Was meint er jetzt? Er sagt sicher, wer ihm heute in der Küche helfen muss. Wir sind heute nicht dran, oder? Er hat uns nicht angeguckt. Einmal musste ich eine Nacht in einer Bar verbringen. Habe ich dir das noch nie erzählt? In der Bar von Pito. Kennst du ihn? Seine Bar ist zu laut und völlig verräuchert, und da läuft immer dieser Scheißfernseher (auf den niemand schaut) und so ’ne Maschine, Pinball glaub ich, mit ganz vielen Zahlen und Buchstaben, die immer an- und ausgehen. Sobald du dich in Richtung Maschine bewegst, um ein Spiel zu spielen, kommt Pito sofort mit dem Staubtuch angerast und fuchtelt auf der Glasplatte herum (damit du die Kugel nicht mehr richtig sehen kannst), und dabei kriegst du ständig seinen Ellbogen in die Rippen, bis du die Kugel (falls du bisher geschickt genug warst, das Spiel trotz des Staubtuchs zu bestehen) endgültig versenkst. Pito ist verrückt: Er ist gleichzeitig durchtrieben und nett. Wenn du ein Bier bestellst, bringt er ’ne Cola und wenn du einen Espresso Macchiato bestellst, bringt er dir einen Cubalibre oder Rum mit Orangenlimonade, und wenn du einen Rum Orange bestellst, serviert er dir Kutteln oder einen Grog, und während er dich zurechtweist, schaut er dich schräg an, stellt dir den Mann neben dir am Tresen vor, ruft nach dem Hund mit den traurigen Augen, dem er immer ähnlicher sieht. (Beide gehören zu derselben Art Wesen, die mehr mit Cafés und Cognac verwandt sind als mit Menschen oder Hunden). In der Nacht, die ich dort verbringen musste, habe ich eines verstanden, um das zu bekommen, was du wolltest, musstest du das Spiel mitspielen, du durftest nie das bestellen, was du wirklich wolltest, und auch nicht das Getränk oder das Essen, was gar nichts damit zu tun hatte. So konnte es dir gelingen, dass Pito zwar nicht genau das servierte, was du wolltest, aber doch etwas, was dem ziemlich nahekam. Ich wollte einen Whiskey: Ich bestellte gefüllte Oliven und eine Orange: Er brachte mir einen Cognac und ein Plunderstückchen. Ich trank den Cognac und ließ das Plundergebäck liegen. Ich lag nur wenig daneben. Bei der zweiten Bestellung hatte ich weniger Glück: Ich hatte wieder Lust auf einen Whiskey und bestellte ein Tonic: Er servierte mir einen trockenen Sherry, den ich hasse. Beim dritten Mal lag ich richtig. Ich bestellte Johannisbeersirup: Ein wunderbarer Malt Whiskey füllte mein Glas fast bis zum Überlaufen. Während dieser ganzen Spielereien goss es draußen wie aus Kübeln: Es goss, wie es auf diesem Planeten noch nie geregnet hatte. Das Wort Sintflut verniedlicht die Proportionen dieses Ereignisses: Keiner kam auf die Idee, nach Hause zu gehen, auch wenn er nur ein paar Häuser weiter wohnte. Wir mussten also bleiben, ein Haufen ganz unterschiedlicher Leute. Wir fingen an zu spielen, was wir (um zwei Uhr nachts, als das Wasser das Erdgeschoss überschwemmte) unterbrechen mussten, um in den ersten Stock umzuziehen. Wir spielten bis um halb sechs morgens, als der Regen nachließ und die einen nach Hause und die anderen zur Arbeit gingen. In der übrigen Stadt hatte es kaum geregnet: Siehst du, was es alles gibt: Vielleicht passiert hier das Gleiche, und es schneit gar nicht im Dorf nebenan: Es schneit nur in dieser Ecke und sonst nirgends auf der Welt. Vielleicht brauchen wir den ganzen Schnee auf, und es wird jahrhundertelang nicht mehr schneien; unsere Kinder und Enkel werden nicht wissen, was Schnee ist, und werden ihn nur von Fotos und aus Filmen kennen. Hast du gesehen, wie hoch der Schnee liegt, schon zwei Handbreit über der Fensterbank? Der Schnee wird die Scheibe doch nicht eindrücken, oder? Warum sagst du nicht dem Wirt, er solle die Läden schließen? Sonst macht der Schnee noch die Scheiben kaputt. Außerdem ist es dann nicht mehr so kalt. Warum ist das bisher noch niemandem eingefallen? Guck mal; jetzt schneit es noch mehr. Mann, liegt der Schnee schon hoch, das wird ja immer mehr. Schau, man kann den Himmel nicht mehr sehen: Wir sehen nichts mehr: nur noch Schnee. Bald bekommen wir keine Luft mehr. Es wird so viel schneien, dass wir unter einer Schneedecke verschwinden werden, wir und die Häuser, wir werden ersticken, wenn uns die Luft ausgeht, was bald sein wird, und bei dieser dauernden Kälte wird der Schnee nie wieder schmelzen, und wenn die Menschen sich dann an die neue Eiszeit gewöhnt haben (das muss es sein: Das hier ist eine neue Eiszeit: Wir sind Jahrmillionen zurück!), werden sie Autobahnen über uns bauen. In tausend Jahren werden dann kurzsichtige Archäologen unsere Leichen in vollkommen erhaltenem Zustand entdecken: wie in einer Tiefkühltruhe. Sie werden uns ausziehen, uns untersuchen, uns analysieren. Welche Horrorvorstellung! Warum kommt eigentlich keines dieser Schneeräumfahrzeuge vorbei? In diesem Land sind solche Stürme doch sicher normal: Ganz so viel Schnee vielleicht nicht, natürlich, aber hier ist man heftigen Schneefall bestimmt gewöhnt. Warum kommt eigentlich keiner und repariert das Telefon? Mmh. Da hast du’s: Es geht dem Ende zu. Es bleibt nur die Kiste. Wie spät ist es? Wenn wenigstens der Fernseher funktionieren würde . . . Warum passiert das gerade uns? Ah. Ich bin müde. Legst du dich mit mir in die Ecke? Komm, wir machen Mittagsschlaf. Du schreibst. So als ob du nichts anderes könntest. Bringt es dir irgendetwas? Was schreibst du eigentlich, darf man das erfahren? Mal sehen . . . Du bist verrückt. Warum schreibst du alles auf, was ich sage? Das heißt: Du saugst dir das nicht einmal selbst aus den Fingern, sondern im Prinzip kann ich dir befehlen, was du schreiben sollst; und dann schreibst du nur das, was ich will. Schreib Scheiße. »Scheiße.« Nein, jetzt habe ich es gelesen. He, hör auf. Du spinnst. Schreib nur das, was ich dir sage, was du schrei . . . Hey! Du hast ein halbes Wort aufgeschrieben; also, wenn ich jetzt schweige, wirst du nichts mehr schreiben: Wirst du einen Leerraum lassen oder einen Absatz machen? Zeig mal . . . Bah: Du hast Punkt, Punkt, Punkt gemacht: Du bist nicht gerade originell: Das hast du vorhin auch schon mal gemacht. Machst du nie einen Absatz? Mach einen Absatz. Jetzt. Es ärgert mich, dass du nicht auf mich hörst. Du schreibst, damit du nicht reden musst. Du glaubst, du stehst über den Dingen hier, was?, und dabei bist du genauso ein Scheißkerl wie alle anderen auch. Glaubst du vielleicht, mir würde es Spaß machen, hier rumzusitzen? Du könntest ruhig etwas netter zu mir sein. Kommunikation zwischen den Menschen ist zumindest interessant und hilft, die Zeit zu vertreiben. Hast du nie darüber nachgedacht? Schau mir in die Augen. Schau mich an. Schreib nicht »Schau mich an«, sondern schau mich an. Nein: Schreib nicht »Schreib nicht ›Schau mich an‹, sondern schau mich an«, sondern schau mich an. Nein: Schreib nicht »Nein: schreib nicht ›Schreib nicht ›Schau mich an‹, sondern schau mich an‹«, sondern schau mich an, sondern schau mich an. Lass gut sein. Jetzt bin ich still, damit du nichts mehr aufschreiben kannst und mich anschauen musst, oder wenn nicht, dann langweile dich eben. Non scriverai più.
Die Aktentasche
P: Quid est vigilanti somnus? A: Spes.
P: Quid est mirum? A: Nuper vidi hominem stantem, molientem, ambulantem, qui numquam fuit.
P: Quomodo potest esse? Pande mihi. A: Imago est in aqua.
A: Quidam ignotus mecum sine lingua et voce locutus est, qui numquam ante fuit nec postea erit, et quem non audiebam nec novi. P: Somnium te forte fatigavit, magister.
A: Quid est quod est et non est? P: Nihil.
A: Quomodo potest esse et non esse? P: Nomine est et re non est.
Disputatio regalis et nobilissimi iuvenis Pippini cum Albino scholastico
Die Aktentache
Borrell schrieb das letzte Wort, setzte den Schlusspunkt, zog das Blatt aus der Maschine und betrachtete es mit ausgestrecktem Arm von Weitem wie eine Zeichnung. Er las es noch einmal.
Langsam kniet er nieder und merkt nicht,
dass das blendende Scheinwerferlicht,
die dunkle Sibylle, der Trubel ist,
mit der ihn verwirren will die Finsternis.
Erst danach füllt Nitrat den Raum.
Ergeben beugt er sich, bis es empfängt der Mund.
Er wird gesehen von einer Eule ohne Flügelflaum,
von der Gans im Wahn und dem brennenden Hund.
Er legte das Blatt zu den anderen einundzwanzig Blättern, die bereits in einer Mappe aus blauem Karton lagen. Auf das nächste Blatt tippte er den Titel des Buches: Die Aktentasche und den ihm vorangestellten Leitsatz: »Aliquando bonus dormitat Homerus«. Er tippte dieses Motto auf einen Umschlag und auf ein weiteres Blatt Papier. Auf dieses weitere Blatt schrieb er zudem seinen Namen, seine Adresse und seine Telefonnummer und steckte alles in den Umschlag. Er leckte ihn an und klebte ihn zu.
Im Copycenter an der Ecke kopierte er das Buch, dreimal. Im Papierwarengeschäft kaufte er Aktendeckel. Wieder zu Hause, schob er einen Satz Fotokopien in eine Schreibtischschublade, legte das Original in der Mappe zu den beiden anderen Stapeln mit Fotokopien und packte daraus ein Paket. Er schrieb die Adresse einer bedeutenden Kultureinrichtung darauf und eilte zur Post. Heute war der letzte Tag, um eine unveröffentlichte Arbeit für den höchsten Dichterpreis des Landes einzureichen.
Borrell hätte nie gedacht, dass die Blitzlichter der Fotografen und die Mikrofone der Journalisten ein so wenig traumatischer Bestandteil der Welt des Dichters sein könnten. Er verlor erstaunlicherweise überhaupt nicht den Kopf, als auf einmal gegen Mitternacht ein Heer von Journalisten in seine Wohnung einfiel. Eine halbe Stunde zuvor hatte ihn das Klingeln des Telefons aus einem Traum gerissen, in dem er mit Riesenzahlen eine geometrische Reihe fantasierte. Er hatte so wenig an eine Auszeichnung geglaubt, dass er, völlig unbeeindruckt vom laufenden Abstimmungsverfahren, schlafen gegangen war.
Die Mund-zu-Mund-Propaganda funktionierte, und die erste Auflage von Die Aktentasche war fast vergriffen, bevor die ersten Kritiken veröffentlicht wurden. Als diese schließlich erschienen (seltsamerweise nur positive, außer einer, in der ein paar Reimprobleme entdeckt wurden), stand der Verlag mit der Produktion der dritten Auflage unter Zeitdruck. Bei der Einschätzung eines neuen literarischen Werkes hatte sich die Presse seit Jahrzehnten nicht so einmütig gezeigt. »Die Poesie von Borrell« – schrieb eine Gazette – »zeigt uns, auch wenn uns diese Erkenntnis schwerfällt, dass wir bisher noch nicht alle Seiten dieses enigmatischen, wechselnden Parallelepipedons entdeckt hatten, das die Dichtung sein kann und auch ist.« »Die Qualität dieses Buches« – schrieb eine andere – »macht Die Aktentasche bereits kurz nach Erscheinen nicht nur zu einem Markstein der lokalen, sondern der europäischen Dichtung, die sich derzeitig, und das schon seit Jahrzehnten, durch Unentschiedenheit und Orientierungslosigkeit auszeichnet.«
Borrell war glücklich. Nicht wegen des Erfolges, sondern weil die öffentliche Anerkennung ihm zeigte, dass er sich nicht geirrt hatte; dass, so wie er es immer geglaubt hatte, seine Gedichte den Zeitgeist trafen. Mit der Einfachheit seiner Kunst, und offenbar weit entfernt von dem heraufdämmernden einundzwanzigsten Jahrhundert, wurde Borrell zum »Priester all jener unmöglich festzulegenden Empfindungen, von denen die Seelen seiner Zeitgenossen zerrissen wurden«.
Ihm zu Ehren, und weil sie ihn liebten, feierten seine Freunde Feste. Alle freuten sich aufrichtig über Borrells Erfolg, dessen einzige, ständig wiederholte Forderung gewesen war, ihn in Ruhe schreiben zu lassen. Sie schätzten auch eine weitere Eigenschaft an ihm: Im Unterschied zu den meisten anderen hatte er sie nie mit einem Gedichtvortrag oder einem Seminar über das, was seiner Meinung nach Dichtung sei oder zu sein habe, geplagt. Sie wussten, wie sehr er geschwitzt hatte, um die zweiundzwanzig Gedichte herauszudestillieren, die in Die Aktentasche Eingang gefunden hatten, denn ganz war er nie zufrieden. Er hatte sich nie wegen des Erfolges selbst verraten. Einen Erfolg, den er viel früher erreicht hätte, wenn er nur den Modeströmungen gefolgt wäre, wenn er nicht überzeugt und frei von prophetischem Dünkel seine Vision von der Poesie am Ende unseres Jahrhunderts vertreten hätte.
Der erste, der ein Fest organisierte, war Josep. Das zweite organisierte Manel. Danach folgten Andreu, Marta, Ignasi, Ramon, Maria, Teresa, Gerard. Auf dem Fest von Gerard erklärte Borrell, dass, wenn sie weiter so viele Feste feierten, Wochen ins Land ziehen würden, ehe er wieder am Schreibtisch sitzen könne. Aber natürlich musste man die Freude über diesen Erfolg ausleben. Die folgenden Feste wurden organisiert von Xesc, Rosa, Corina, Emili, Maria-Rosa, Toni, Anna, Núria, Arcadi, Arau, Josep-Maria, Tomàs, Sumpta, Albina, Miquel, Artur, der anderen Anna und Pepa.
Eines Abends, die Preisverleihung lag zwei Monate zurück, setzte sich Borrell an den Schreibtisch (nachdem er zuerst mit einem Rundfunkjournalisten telefoniert hatte, der seine Meinung zum Tod einer bereits älteren, bedeutenden Dichterin wissen wollte, und dann mit Anna, die sauer war, weil er sie seit Wochen nicht angerufen hatte). Seine Hände strichen über die Schreibtischkanten. Seit der Preisverleihung hatte er sich nur selten hierher gesetzt, und das tat ihm leid, denn in gewisser Weise war ihm dieser Schreibtisch, der ihn jahrelang bei der Arbeit begleitet hatte, ein sehr guter Freund. Er drehte sich um; er sah all die ungelesenen Bücher, die sich auf der Tischecke stapelten, wo er schon von jeher die Bücher hinlegte, die er in der allernächsten Zukunft lesen wollte, eine Ecke, auf der gewöhnlich wenig Bücher lagen, denn sobald sie dort ankamen, waren sie auch schon wieder verschwunden, bereits verschlungen. Während er versuchte, sich zu erinnern, ob es nun genau das dritte oder das vierte Mal war, dass er in jenen zwei Monaten am Schreibtisch saß, klingelte wiederum das Telefon. Ein Journalist der drittgrößten Zeitung der Stadt (hinsichtlich der Auflage) meldete sich. Während des Gesprächs ging es Borrell durch den Kopf, dass er eigentlich die Hälfte der letzten Monate in dieser Stellung verbracht hatte: am Telefon hängend, Interviewtermine vereinbarend, um damit dann die andere Hälfte der Zeit zuzubringen. Nach seiner Einschätzung durfte es im ganzen Land keine Medien (Presse, Rundfunk oder Fernsehen) mehr geben, in denen nicht über ihn berichtet worden war, nach Interviews mit Journalisten, die, wenn sie von Zeitschriften und Zeitungen kamen, in neunzig Prozent der Fälle seine Aussagen gänzlich verdrehten, vielleicht nicht einmal in böser Absicht, sondern weil sie die Nuancen in seinen Antworten nicht gewissenhaft wiedergaben. Auf der anderen Seite der Leitung hatte er nun einen der Journalisten, die ihn in der Nacht der Preisverleihung zu Hause besucht hatten. Schnell hatte er begriffen, dass es diesmal dem Mann nicht um ein Interview, sondern um einen Beitrag ging. Einen Beitrag in Form eines Gedichtes für die nächste Sonntagsausgabe. Borrell entschuldigte sich. In den letzten Monaten sei er kaum in der Lage gewesen, ein paar Gedanken zu skizzieren, geschweige denn, diese wenigen Gedanken zu einem Gedicht zu verdichten. Der Journalist blieb hartnäckig: Es sei ihm egal, wenn die Gedichte noch im Embryonalzustand seien.
– Denken Sie daran, es ist eine Zeitung. Es muss nicht den Vollkommenheitsgrad erreichen, der für eine Buchveröffentlichung erforderlich wäre. Später werden Sie schon Zeit haben, es nach Ihrem Gutdünken zu überarbeiten, wenn Sie es dann in einem Buch veröffentlichen.
Borrell argumentierte, es ginge nicht so sehr um Vollkommenheit, sondern darum, die Dinge gut zu machen. Der Journalist blieb hart: Man könne auch, falls er wolle, in einer Randbemerkung festhalten, dass es sich »um reine Skizzen zu einem Gedicht« handele, um nichts Fertiges.
Beim Auflegen des Telefonhörers wurde Borrell bewusst, dass er den Vorschlag schließlich akzeptiert hatte. Als Korrektiv zur vorausgegangenen Tat legte Borrell den Hörer neben den Apparat (anderenfalls würde er möglicherweise in den nächsten drei Stunden zwischen zwanzig und dreißig Anrufe erhalten) und bemühte sich, ein Gedicht zu vollenden. Er sollte es noch am selben Abend abgeben, da es für die Sonntagsbeilage vorgesehen war, die genau an diesem Tag Redaktionsschluss hatte. Borrell verstand nicht, warum sie bis zum letzten Tag gewartet hatten, um ihn um etwas zu bitten, was sie auch gut und gerne ein paar Tage vorher hätten einplanen können. Doch schon vor Wochen hatte er sich angewöhnt, sich nicht mehr über die mangelnde Planung der Leute zu wundern, mit denen er nun Umgang pflegte.
Am späteren Abend erklärte er das Gedicht für mehr oder weniger fertig. Er legte den Hörer wieder auf die Gabel, und sofort klingelte das Telefon. Es war der Journalist, der ihn um das Gedicht gebeten hatte: Was denn los sei, dass er nun seit Stunden telefoniere, ob er wisse, wie spät es sei, und ob er nun das Gedicht vorbeibringen werde oder nicht, denn sie müssten schließen.
Auf der Fahrt zur Zeitung las Borrell das Gedicht noch einmal durch und fand es schwach. Er überlegte, wieder umzukehren und es noch einmal zu schreiben, aber er entschied (nur bei dem Gedanken an das empörte Gesicht des Journalisten), diese Idee zu den Akten zu legen und das Gedicht, so wie es war, abzugeben. Abgesehen davon war es ein Entwurf, und das würde ja auch in Kleinbuchstaben am Rand stehen.
Noch am selben Sonntag (nachdem er mit Emili telefoniert hatte, der ihm vorhielt, nie anzurufen) bat ihn ein Mitglied des Redaktionsbeirats einer bedeutenden Kulturzeitschrift um einen Beitrag. Sie planten eine Nummer über neue Poesie, und seine Mitarbeit war nach dem Eindruck, den Die Aktentasche in der Kulturszene gemacht hatte, unentbehrlich. Borrell erklärte ihm das Gleiche, was er dem Journalisten der Zeitung erzählt hatte: Er habe bisher nichts Neues, er habe nur Notizen gemacht, die man beim besten Willen nicht Gedichte nennen könne. Der von der Kulturzeitschrift fragte ihn daraufhin, wie es denn dann komme, dass genau heute eines seiner Gedichte in der drittgrößten Zeitung der Stadt (hinsichtlich der Auflage) erschienen sei (natürlich ohne die erläuternde Randbemerkung, dass es sich um einen Entwurf handelte; die Randbemerkung, die der für das Layout Verantwortliche angeblich ohne Rücksprache weggelassen hatte, weil sie ihm das Aussehen der Seite verdarb). Und wenn er in der drittgrößten Zeitung der Stadt (hinsichtlich der Auflage) ein Gedicht veröffentlicht habe, gäbe es natürlich noch viel mehr Gründe, in seiner Zeitschrift zu schreiben, die sich nicht nur durch ihr erbittertes Ringen um eine fortschrittliche Haltung in der Kultur hervorgetan habe, sondern auch ein Bollwerk in den schwarzen Zeiten der Diktatur gewesen sei. Borrell sagte, er könne nach Belieben aus seinem Band Die Aktentasche veröffentlichen. Der von der Kulturzeitschrift war empört: Mit beleidigter Stimme machte er unmissverständlich klar, es müsse etwas Unveröffentlichtes sein.
– Aber ich habe doch nichts fertig – bemerkte Borrell.
– Das ist doch egal. Irgendetwas, gleich was, geht in Ordnung.
In den fünfzehn Tagen, die auf die Veröffentlichung des Gedichtentwurfs in der Kulturzeitschrift folgten, erhielt Borrell neben den üblichen Telefonanrufen im Durchschnitt achtzehn komma vier Anrufe täglich mit der Bitte um einen Beitrag für Zeitschriften jeglicher Größe, Erscheinungsweise, Druckart und ideologischer sowie ästhetischer Richtung.
Am sechzehnten Tag aber, gerade nachdem er den Telefonhörer aufgelegt hatte (er hatte mit Gerard gesprochen, der ihm seine Schlussfolgerung mitteilen wollte, ihm sei wohl der Ruhm zu Kopfe gestiegen, denn anders könne er sich nicht erklären, warum er sich auf einmal nicht mehr melde), rief ihn der Chefredakteur der bedeutendsten Zeitung der Stadt (hinsichtlich der Abonnentenzahl) an.
– Keine Angst, ich will Sie nicht um einen poetischen Beitrag bitten – begann er lachend.
Der Chefredakteur lud ihn zum Mittagessen ein, dabei könne man entspannter plaudern. Sie gingen in ein Luxusrestaurant.
Den Chefredakteur faszinierte vor allem, wie wenig Borrell über den Klatsch in der Szene informiert war. Beim Nachtisch legte er die Karten auf den Tisch: In der Tat wollte er keinen poetischen Beitrag von ihm. Er wollte einen journalistischen Beitrag. Er hatte sich gedacht (und glaubte, damit den Punkt getroffen zu haben), es wäre eine interessante Erfahrung für ihn, wenn er Artikel schriebe. Just in dem Augenblick überrascht, als der Chefredakteur eine Flasche Sekt zur Feier seiner möglichen Mitarbeit bei der Zeitung bestellte, wusste Borrell nichts zu antworten. Er hatte noch nie etwas anderes als Poesie geschrieben. Der von der Zeitung versicherte ihm, seine Dichtung funktioniere nur aus einem Grund: Er habe sich nie einer neuen Möglichkeit verschlossen. Mit einer Kolumne in einer Zeitung könnte er seine Meinung über Politik und Kultur ausdrücken. Zudem, insistierte er, fände er es nicht reizvoll, seinen Kolumnen die gleiche Sorgfalt und Dichte abzuverlangen wie seinen Gedichten? Borrell versuchte eine Widerrede aufzubauen: Er könne nicht so ganz sehen, wie er regelmäßig, einmal in der Woche, schreiben solle.
– Einmal in der Woche? – entgegnete der Chefredakteur.
– Nein, aber nein doch. Einen Artikel täglich.
Er schrieb die Artikel am frühen Nachmittag, gleich nach dem Mittagessen. Die Erfahrung hatte ihn gelehrt, möglichst alle Interviews auf den Vormittag zu legen, so hatte er den Nachmittag für die anderen öffentlichen Verpflichtungen frei. Die Artikel nach dem Mittagessen zu schreiben, erwies sich als ärgerlich, denn gewöhnlich war er satt und leicht berauscht und hatte viel mehr Lust auf ein Mittagsschläfchen als darauf zu grübeln, über welches Thema er einen Artikel schreiben könne, den er noch am selben Nachmittag vor der Cocktailparty, dem Empfang, der Präsentation oder der Vernissage abliefern musste, wo man nach seiner Gegenwart verlangte, häufig nicht nur mit der üblichen per Post zugeschickten Einladungskarte, sondern durch einen verpflichtenden Telefonanruf des Ausstellers, Galeristen, Redners oder Künstlers, je nach Art der Veranstaltung. Es ärgerte ihn, die Artikel unter Zeitdruck schreiben zu müssen, denn wie die Mehrzahl der Dichter war er ein Gegner der Improvisation. Die Gedichte aus Die Aktentasche hatte er immer wieder neu geschrieben, über Jahre hinweg, und er feilte noch daran herum, als er die Druckfahnen durchsah. Nun befand er sich in der misslichen Lage, die Artikel in einem knappen Dreiviertelstündchen schreiben zu müssen, ohne genügend Zeit, sie reifen zu lassen und immer wieder neu durchzulesen, um Fehler, Ungenauigkeiten, übertriebene Meinungen, überflüssige Adjektive oder zu kryptische oder zu wenig kryptische Anspielungen aufzuspüren.
In jener Zeit, als Die Aktentasche zur siebten Auflage gelangte, wusste Borrell bereits, dass es bei wirklich jeder Cocktailparty, jedem Empfang, jeder Präsentation und jeder Ausstellungseröffnung zwangsläufig zur Verbrüderung mit irgendeinem Maler kam. Die Bescheideneren baten ihn um die Einführungsrede bei der nächsten Ausstellung. Alle anderen schlugen ihm unweigerlich die Schaffung eines gemeinsamen Werkes vor.
– Ich glaube, es könnte sehr interessant sein, aus der Dialektik unserer beiden Sprachen heraus, dem Wort und dem Bild, Experimente zu machen, etwas Gemeinsames zu schaffen – sagte ihm einmal ein etwas klein geratener Maler, der ihn buchstäblich zwang, sofort mit ihm sein Atelier aufzusuchen und das WERK zu betrachten.
Dann folgten die Vorworte zu den Büchern anderer Schriftsteller, über die er sich auslassen sollte, obwohl er sie im Schnellverfahren kaum diagonal gelesen hatte. Ende Januar baten ihn achtzehn Fastnachtskommissionen aus achtzehn verschiedenen Städten und Dörfern (darunter die Hauptstadt der Nation) um Büttenreden. Unmittelbar danach musste er Vorträge über Themen halten, mit denen er sich nur oberflächlich beschäftigt hatte; er nahm an Podiumsdiskussionen zu Literatur und Politik teil, zu Dichtung und Metrik, zu Literatur und sozialer Lage, zu poetischer und architektonischer Struktur, zu Ästhetik, zu Dichtung im Zeitalter der Raumfahrt, zum Engagement des Literaten, zu Poesie und Ökologie, zu Poesie und Elitedenken, zu Literatur und Libido . . . Er hielt Vorträge in Instituten und Universitäten. Er kannte jeden einzelnen der Literaturprofessoren, die es übers Land verstreut gab, und erklärte (vor flegelhaften Studenten, die gähnend abwechselnd auf die Uhr und an die Decke schauten), was er unter künstlerischem Schaffen, unter Dichtung verstand, an welche Art Leser er beim Schreiben dachte oder nicht dachte, wie ihm ein Gedicht einfiel und ob er Anhänger des freien Verses sei.
Ein halbes Jahr, nachdem er den Preis erhalten hatte, suchte er eine Lücke in seinen Aktivitäten (Artikel, Vorträge, Podiumsdiskussionen, Ausstellungen, Interviews), um sich zum Mittagessen mit Verlegern zu treffen, die neue Bücher von ihm wollten. Zwei von ihnen begehrten gleichzeitig und unabhängig voneinander einen Roman.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.