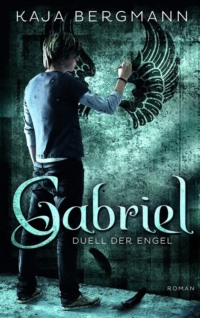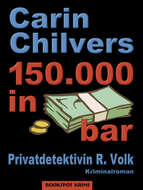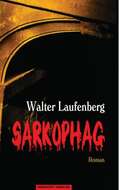Kitabı oku: «Gabriel», sayfa 2
Kaja Bergmann
Bir şeyler ters gitti, lütfen daha sonra tekrar deneyin
₺97,95
Türler ve etiketler
Yaş sınırı:
18+Hacim:
142 s. 4 illüstrasyonISBN:
9783937357911Yayıncı:
Telif hakkı:
BookwireSeriye dahil "Edition 211"