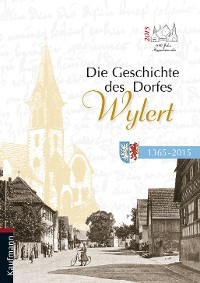Kitabı oku: «Die Geschichte des Dorfes Wyhlert», sayfa 5
4. Kapitel. Die Zeit nach 1945 bis in unsere Gegenwart
4. KAPITEL
Die Zeit nach 1945 bis in unsere Gegenwart

Wandel in der Arbeitswelt von Stephan Hurst
Wandel in der Arbeitswelt
VON STEPHAN HURST
Nicht nur in der Landwirtschaft, auch bei den Arbeitern und im Handwerk gab es insbesondere in den vergangenen 60 Jahren große Veränderungen, die wir näher beleuchten wollen.
Der Beruf des Webers
Verbreitete Webgarne aus einheimischen Rohstoffen waren in unserer Gegend um Kippenheimweiler vor allem Flachs oder auch Hanf für die Leinenweberei. Der Webstuhl ermöglichte dem Weber, Stoffe von hoher Qualität zu produzieren. Allerdings brachten die mechanischen Webstühle und die Industrialisierung das Ende dieses früher sehr verbreiteten Handwerks. Dieser Umbruch brachte viele Weber um ihre Existenz. Und so waren die Weber einer der ersten Berufsstände, die die negativen Folgen der Industrialisierung am eigenen Leib erfahren mussten.

Auch in Kippenheimweiler gab es Weber; so ging beispielsweise auch der Großvater von Herbert Hurst, August Hurst (1864–1947), dem Beruf des Webers nach. In dessen Haus in der Luisenstraße 2 stand im linken Teil lange Jahre ein Webstuhl, den es heute leider nicht mehr gibt.
Schornsteinfeger
Den Beruf gibt es bekanntlich auch noch heute, wenngleich die technische Ausrüstung in unseren Tagen natürlich deutlich besser ist.

Dieser wunderbare Schnappschuss eines vorbeigehenden namentlich unbekannten Schornsteinfegers gelang dem Vater von Karl Beinroth kurz nach dem Krieg.
Waldarbeiter
Auch der Beruf des Waldarbeiters ähnelte dem heutigen. Motorsägen gab es damals noch nicht, gefällt wurde mit Axt und Säge. Der Transport der Bäume erfolgte noch mit Pferd und ohne Maschinen. Über den Winter arbeiteten zahlreiche Landwirte des Dorfes im Gemeindewald und verdienten sich so ein Zubrot. Nicht selten kehrten die Waldarbeiter des Dorfes nach der Arbeit unterwegs ein.

Otto Stubanus beim Schälen eines Baumes mit Waldarbeitern. Er arbeitete beim Verlag Schauenburg und war lange Jahre Gemeinderat der damals noch selbstständigen Gemeinde Kippenheimweiler.

Waldarbeiter aus Kippenheimweiler bei einer Vesperpause
Zeitzeugen erinnern sich an die Waldarbeit:
Renate Weis-Schiff: Ich glaub, si hänn amol ä Deil miän bringe, wu dr Lohn nit glangt het. Eugen Gänshirt: Do derf ich gar nit dran denke (lacht). Drwege het der Gänshirt Schorsch gsait: „Blieb d’heim, ihr verdiene nix, dü versüffsch meh, wie ihr verdiene.“ Un ich weiss nit, mir hänn halt in dr Woch, ich glaub mir sinn selde durchkumme, ohni dass mir nit iehkehrt hänn.
Wagner („Krummholz“)
Durch den Wegfall der eisenbereiften Leiterwagen sowie der größtenteils aus Holz hergestellten Werkzeuge und landwirtschaftlichen Gerätschaften wurden die Tätigkeiten des Wagners ab den 1950er-Jahren immer weniger nachgefragt. In Kippenheimweiler gab es die Wagnermeister August Weinacker in der Lindenstraße und Oskar Siefert in der Luisenstraße.
Küfer
In Kippenheimweiler gab es vor dem Krieg wie in den umliegenden Ortschaften auch den Beruf des Küfers. Daniel März war der letzte seines Standes und auch der letzte der Küferinnung. Seine Werkstatt hatte er in der Wylerter Hauptstraße 36 (heute: Haus von Klaus Löffel). Das Leben von Daniel März steht beispielhaft für den rasanten Umbruch der letzten Jahrzehnte.
Daniel März wurde 1912 in Dinglingen geboren und begann 1947, nach der Rückkehr aus dem Krieg, als Küfer in Kippenheimweiler zu arbeiten. Sein Vater war auch Küfer. Sie kauften das Holz im Wald, lagerten es drei Jahre im Freien und ein Jahr im Schopf, bevor sie es bearbeiteten. Der Vater noch mit dem Fügehobel, mit Krummmessern und dem Lenkbeil. Der Sohn benutzte bereits seine Bandsäge, um die Bretter zu Dauben zu formen und ihnen die richtige Länge, Breite und Wölbung zu geben. Viele Arbeitsschritte, das Befestigen der Dauben, das Biegsammachen des Holzes mit kochendem Wasser, das Aufziehen der Reifen und das Einlegen des Bodens erforderten Kraft und Genauigkeit, Armschmalz und Kunsthandwerk. „24 Stunden habe ich an einem Fass gearbeitet, das 150 Liter fasst und 80 cm hoch und 50 cm breit ist“, sagte Daniel März. Kaum zehn Jahre waren vergangen, da konnte er mit dieser Arbeit seine Frau und sich selbst nicht mehr ernähren. Die Brennerei wurde zu seiner wesentlichen Einnahmequelle. „Anfangs habe ich zwei oder drei große Mostfässer in jedem Jahr gemacht“, erinnerte sich Daniel März. Seit den 1960er-Jahren bestand seine Tätigkeit nur noch aus Reparaturarbeiten an Fässern, Krautständern und Bottichen. Die vermehrte Produktion von Kunststoffen machte sein Handwerk fast überflüssig.
Die Lehrbuben, deren Fertigkeiten er in den 1950er-Jahren als Prüfungsmeister zu beurteilen hatte, sind alle in die Industrie gegangen. 40 Küfer arbeiteten zu Lebzeiten von Daniel März’ Vater im Kreisgebiet. Als Daniel März als Obermeister der Innung mit seinen Kollegen 1972 beschloss, die Innung aufzulösen, da waren sie noch zu sechst. Daniel März verstarb am 27. Oktober 1989.

„Geduldig und liebenswürdig“ – so wird Daniel März in einem Zeitungsbericht über ihn vom Mai 1984 beschrieben – zeigte er der damals jungen Zeitungsmitarbeiterin Annette Hillebrand zwei Tage lang seine Tätigkeiten, erklärte, wann Gargelkämme und Ziehklingen, Fassschaber und Leierbohrer bei der Fertigung eines Fasses gebraucht werden.
Die Nachkriegszeit von Stephan Hurst
Die Nachkriegszeit
VON STEPHAN HURST
In den ersten Tagen nach dem Kriegsende in Kippenheimweiler kam es auch hier wie in vielen Nachbarorten zu Plünderungen von Fleisch, Eiern und Wertsachen wie Schmuck, Uhren und Fotoapparaten. Ebenso wurden Weinvorräte, Geflügel sowie Stallhasen entwendet, teilweise auch sinnlos aufgebraucht.
Die Mädchen wurden so gut es ging versteckt, um ihnen Schlimmeres zu ersparen. Trotzdem fanden mehrere Vergewaltigungen an Frauen im Dorf durch die französischen Soldaten statt. Besonders gefürchtet waren die nordafrikanischen Soldaten aus Marokko.
Fritz Fleig wurde vom französischen Militär zum neuen Bürgermeister bestimmt. Da er des Französischen und Englischen mächtig war, konnte er sich gut mit der Militärbehörde verständigen. Drohte Ungemach durch betrunkene Soldaten, meist aus den französischen Kolonien, so rief er unverzüglich die Kommandantur an, die dann die Militärpolizei sandte und für Ruhe und Ordnung sorgte. Die Situation im Dorf entspannte sich nach einigen Wochen, und die Zeit des Schreckens wich nach und nach der Hoffnung auf einen Neuanfang.
Die Franzosen nahmen die Vieh- und Tierbestände des Dorfes zusammen mit zwei Elsässern sowie den Kippenheimweiler Bürgern Emil Kuhn und Julius Siefert auf. Es wurden vor allem viele Schweine, Kühe und Pferde beschlagnahmt. Die konfiszierten Tiere mussten von den Landwirten nach Dinglingen an den Bahnhof geführt werden, von wo der Weitertransport nach Frankreich erfolgte. Nicht selten wurde hier und da ein Schwein oder Kalb unterschlagen und von der Dorfbevölkerung schwarzgeschlachtet, auch des Nachts. Da im Dorf französische Patrouillen erfolgten, war dies ein nicht ganz ungefährliches Unterfangen. Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt.
Werner Spathelfer berichtet:
Un wenn die (die französische Militärkontrolle) s’Dorf underieh kumme sinn, no hesch’s gwisst, des het sich so rumgschbroche, schneller wie hit middem Telefon. Un drno hänn sie dr Sau ä weng Schnaps oder Wiin niehgmacht, no sinn die ruhig gsieh un hänn gschlofe uffem Wage, un hänn Schdroh oder Gras druffgworfe un sinn durchs Feld gfahre. Wenn d’Franzose kumme sinn, sinn d’Wäge mit dr Sau druff rumgfahre. Die hänn sich dann nit griehrt, die ware bsoffe. No sinn mir als Kinder halt dänne Franzose hindenoh grennt, dänne Franzose.
Zuerst war von 18 Uhr an Sperrstunde, später von 20 Uhr bis morgens um 8 Uhr. Während dieser Zeit durfte keiner der Dorfbewohner auf der Straße sein. Wurde dennoch einer von der Patrouille aufgegriffen, dann wurde er mitgenommen. Die Radios und die Butterfässer/Plumpfässer mussten, mit Namen versehen, auf dem Rathaus abgegeben werden, damit keine illegale Butter gemacht werden konnte. Nach geraumer Zeit, etwa ein Jahr später, durften diese dann wieder abgeholt werden. Auf dem Land gab es immer etwas zu essen. Allerdings mussten gerade in der Nachkriegszeit die Verwandten aus den umliegenden Städten mit versorgt werden. Das Teilen gerade mit den Verwandten, welche kaum eigenes Essen hatten, war jedoch selbstverständlich.

Alltagsszene aus den 1950er-Jahren: Eugen Gänshirt fegt vor seinem Haus die Straße, die Kühe der Familie Otto Fleig werden von der Weide aus nach Hause gebracht, ein Volkswagen und ein Pferdefuhrwerk passieren gerade die Straße …
Im Hintergrund das heutige Anwesen Bernhard und Elsa Preschle.
Aus Kippenheimweiler wurden Otto Weis, Georg Weis und Emil Frenk im ehemaligen Arbeitsdienstlager von Dinglingen durch das französische Militär interniert. Dort wurden die ehemaligen NSDAP-Funktionäre aus Südbaden (Ortsgruppenleiter, Ortsbauernführer, einfache Mitglieder) zusammengeführt und zur Arbeit abgeurteilt. Die Angehörigen versuchten gelegentlich, ihnen am Lager Lebensmittel zuzuschieben. Über ihre genaue Haftdauer ist nichts Genaues bekannt, das Lager in Dinglingen wurde jedoch 1948 aufgelöst.
In den ersten Tagen nach Kriegsende lagen Munition und Waffen im Dorf frei herum: Für die Kinder war die Versuchung groß, sich diese anzueignen. Ein gefährliches und bisweilen auch leider tödliches Unterfangen.
Werner Spathelfer erinnert sich an einen tödlichen Unfall:
Werner Spathelfer: Do sinn jo ieberal Munitione rumgläge nachem Krieäg glich, also acht Dag schbäder oder so. Un do sinn, ich weiss dr Schuelkamerad vun mir, der war so ald wie ich, un dr Brueder, der het Heinz gheiße, un der isch, mir Kerli sinn halt ieberall rumgrennt un so … Ingrid Karl: Des hänn ihr eigentlich nit derfe? Werner Spathelfer: Ha doch, s’isch jo frei gsiehne, d’Franzose ware jo alle furt. Ingrid Karl: Aber vun dr Müdder halt nit? Werner Spathelfer: Achso fun daheim, die hän halt Angscht kahn um uns, aber dr hesch hald alles gfunde, Pulverschdängli, im Feld ieberall isch Zeigs rumgläge. Un do isch obedruff ä Panzerfauscht gläge. Un dr Heinz het des Ding in d’Händ gnumme un het mit dem ä weng gschbielt, un au ä weng dra rum glopft. Un pletzlich isch des losgange, un annäre Panzerfauscht, geht jo d’Munition vornüs, un hindenüs gibt’s ä Schdichflamm. Die hesch mien immer so hebe, dass hinde frei war. Un no hets ä Schdichflamm hindenüs gänn vunneme Meter un die Schdichflamm isch uff dr Heinz (Weis, *1935, †1945) un het anfange bränne un isch verbrennt. Un no sinn d’Anita Scheffler un d’Sleifir Martha un noch ä Frau relativ noh an der Bunger schbaziere gloffe, s’war ammä Sonndag, un do sinn die hiehgrennt un hänn d’Mändel ieberne deckt, aber der het halt schun brennt, bis die hiehkumme sinn, un no hänn sie ne halt, do hets jo noch kei Rotkriezwäge un nix so gänn, no hänn sie ne, wiesienä denn in ä Krangehüs hänn, weiss ich jetzt au nimmi, un no ischer gschdorbe, jaja. Un dann war fier uns Jungi dr Krieäg rum. D’Väddere ware dann nunit alli d’heim, no hesch halt schun ä wengeli Freilauf ghan, weisch, dr Müdder hesch halt au nimmi so ghorcht, wie dr halt hesch solle. Un drno hets wieder ä wenig ebbs z’kaufe gänn, un no hesch sell un des wieder kriägt, no war des halt alles ä weng lockerer un besser. Un dann isch ä scheni Zitt kumme. Dü hesch nit so lebe kenne im Saus un Braus. Aber im Prinzip hesch ä scheni Jugend genosse. Was uns halt gfehlt het, war in dr Schuel die einahalb Johr, des het dann schun ä weng gfehlt, aber des isch dann au kumme, nochher (lacht).
Die zerstörten Gebäude galt es wieder zu reparieren. Nennenswerte Hilfsmittel gab es dabei nicht:
Renate Weis-Schiff: In ejer Hüs isch jo au a Bomb nieh. Hilde Schiff: A Granat, ja. Renate Weis-Schiff: S’war jo au viel kabütt. Hilde Schiff: Jaja, un des hänn mir no alles sälber miän uffbäue, mir hänn jo nix bekumme drfier, mir hänn Bachschdein (Backsteine) butzt un hänn in Eigeleischtung des Hüs miän einigermaße herrichte.
Das Leben normalisierte sich in der Nachkriegszeit zusehends. Die Kriegsgefangenen kehrten teilweise erst nach Jahren wieder nach Kippenheimweiler aus der Gefangenschaft zurück, einige blieben vermisst. Für die Angehörigen und die betroffenen Familien war dies ein Leben voll schmerzhafter Ungewissheit. Denn unklar war oft, ob der Mann, Vater oder Bruder überhaupt je wiederkam oder ob dessen Schicksal für immer im Dunkeln blieb.

Wilhelm Hertenstein mit seinem Kuhfuhrwerk auf dem Weg nach Hause („s’Lise Jerge Wilhelm“, *1891, †1972). Im Hintergrund das Anwesen Hurter, heute: Sofie Schell / Familie Renate Lögler.

Die Rentnerbank in der Lindenstraße: Ein beschauliches Bild Anfang der 50er-Jahre, das heute (fast) verschwunden ist. V. l. n. r.: Franz Schröder (*in Ostpreußen 1888, †1955), August Weinacker (Wagner, *1865, †1951), Georg Hurst(*1878, †1962), Wilhelm Berne (*1872, †1963). Auf dem Gelände im Hintergrund befindet sich heute der evangelische Kindergarten.

Auf dem Heimweg vom Milchhäusle: Renate Weis-Schiff geb. Siefert (*1939) und Trudel Herrenknecht geb. Siefert (*1944) Mitte der 50er-Jahre. Kinder hatten früh Verantwortung zu übernehmen und waren für vielerlei Arbeiten voll eingeplant.

Verdienter Feierabend bei Familie Bohn. Nach getaner, wohl harter Arbeit strahlt Gerhard Bohn trotzdem eine spürbare Zufriedenheit aus. Neben ihm Sohn Reinhard Bohn sowie seine Frau Mathilde Bohn geborene Weis verw. Siefert.
Hilde Schiff und Renate Weis-Schiff berichten über die Flüchtlinge:
Hilde Schiff: Oja, mir hänn viele im Dorf ghan. Des isch jo genauso gsieh, dü hesch sounsoviel qm Wohnraum derfe hahn, un fir s’ander hesch Flichtling bekumme, hesch miän Flichtling zu dir nämme. Renate Weis-Schiff: Des war nit nur dr Burgermeischter, wu iteilt hett, do sinn au Fremdi drbie gsieh, des denkt mir au noch vun d’heim üs, do isch a Abordnung do irgendwu kumme. Uns hänn sie d’heim au niegsetzt. D’Großmüdder het in ihrem Zimmerli glebt un mir zwei (Anmerkung: Renate und ihr Bruder Richard Siefert) hänn mian bi dr Müdder im Schlofzimmer schlofe: Ei Zimmer het sie no derfe owe beanschbruche, un d’Kuchi owe un ein Zimmer hett mian vermietet were. Hilde Schiff: Vieli sinn vum Rheinland kumme. Üsgebomdi au. S’Hurschte Maxe, denkt dir noch sell klei Hiesli, die hänn alle d’Halfti abgann un hänn sich mian beschränke. Renate Weis-Schiff: Sie sinn jo nit verwehnt gsi in sellene Johre un mir jo au nit. Die sinn froh und dankbar gsieh, wenn sie guet uffgnumme wore sinn, was die hinder sich ghan hänn. Die wu gar nix meh ghet hänn. Die sinn oft middem Koffer kumme un meh war nit drbie sunscht. Hilde Schiff: Hajo, des ware armi Litt, nit.
Erst durch die Währungsreform am 20. Juni 1948 war es der Bevölkerung möglich, wieder vernünftige Waren für ihr Einkommen zu erhalten. Die Währungsgesetze der westlichen Alliierten sahen eine Barquote pro Kopf der Bevölkerung von 60 DM vor, von denen 40 DM am Sonntag, dem 20. Juni 1948, ausgezahlt wurden; der Rest folgte etwa zwei Monate später.
Auch für die ins Dorf kommenden Flüchtlinge war es eine schwere Zeit, hatten sie doch oft bis auf weniges alles verloren: ihren Besitz, ihr Haus, ihre Grundstücke – und ihre Heimat.
Mit wenig, dem, was auf dem Leiterwagen oder dem Handkarren Platz hatte, mit den Kindern und Angehörigen, kamen sie aus den Ostgebieten nach einer weiten, beschwerlichen und oft unvorstellbaren Odyssee mit Leid und Entbehrung im Westen an, auch in Kippenheimweiler.
Die damals als Flüchtlinge Angekommenen fanden sich relativ zügig zurecht. Die Arbeit in der Landwirtschaft war für viele der Neubürger die erste Möglichkeit, wirtschaftlich Fuß zu fassen. Das Verständnis der Bevölkerung für die schwierige Lage der Flüchtlinge war groß, und entsprechend war die Hilfsbereitschaft eine Selbstverständlichkeit.

Ein vertrautes Bild der ausgehenden 50er-Jahre: Herbert Hurst (*1936) war von 1968 bis 1999 als Verwaltungsangestellter im Dienst der Gemeinde und betrieb bis Mitte der 1980er-Jahre seine Landwirtschaft im Nebenerwerb wie viele im Dorf. Die Reben hatte er bis 2007. In 272 Sitzungen schrieb er während seiner Dienstzeit exakt 1.408 Tagesordnungspunkte nieder und war im Rathaus eine Institution: So ging man in Kippenheimweiler in Verwaltungs-, Renten- oder öffentlichen Angelegenheiten nicht ins Rathaus, sondern einfach zum Herbert.

Bei einem Gartenfest des MGV Sängerrunde: Gefeiert wurde schon immer ausgiebig und gesellig so wie hier, v. l. n. r.: Julius Stubanus, Emil Fleig, Albert Traber, ?, Julius Zipf, ?, Georg Siefert, Friedrich Fleig.

Aufmerksam verfolgen die Landfrauen in der Küche der „Linde“ die Zubereitung von Speisen, v.l.n.r.: Landwirtschaftslehrerin Wissel sowie unter anderem Hilda Siefert, Luise Zipf, Sieglinde Siefert, Hilde Schiff, Mathilde Zipf, Lena Fleig, Lina Weinert.
Ein 75-jähriger Altwylerter erinnert sich von Kurt Hertenstein
Ein 75-jähriger Altwylerter erinnert sich
VON KURT HERTENSTEIN
Sehr geehrte Leser und Betrachter dieses Buches!
Sehr begeistert bin ich vom Gelingen dieses Werkes mit den vielen Bildern, wozu an der Spitze Herr Stephan Hurst mit zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern beigetragen hat. Besonders erfreut war ich darüber, als ich Ende März 2014 in einer Besprechung bei Stephan Hurst die Younglady Anna-Luise Labelle angetroffen habe. Sie half auch aktiv bei der Gestaltung des Buches mit, obwohl sie mit ihren Eltern lange Zeit in Kanada lebte.
Kurz nach Beginn des Zweiten Weltkrieges wurde ich am 29. Januar 1940 in Kippenheimweiler geboren. Damals war in der Regel die Hebamme zuständig, besonders in der ländlichen Region. In meinem Falle war es Frau Christina Zipf, die Ehefrau vom Bahnbeamten Hermann Zipf. Die zwei waren die Urgroßeltern unserer Buchmitverfasserin Anna-Luise Labelle. Als mein Vater Ludwig Hertenstein einmal Fronturlaub bekam, war natürlich die Wiedersehensfreude mit seiner Frau, meiner Mutter Lydia geb. Zipf, so überwältigend, dass neun Monate später meine Schwester Margrit geboren wurde. Doch dann stand die Mutter mit dem landwirtschaftlichen Betrieb wieder alleine da. Glücklicherweise standen die Dorfbewohner zusammen; besonders die Familie Studer mit den ältesten Buben Richard, Bernhard und dem Vater Karl seien hier dankenswert erwähnt. Bei schweren Erntearbeiten halfen sie immer mit. Mein Vater Ludwig war nicht lange in Kriegsgefangenschaft. Er war in Frankreich bei einem landwirtschaftlichen Betrieb interniert und es ereilte ihn kurz vor Kriegsende ein Herzinfarkt im Alter von 42 Jahren. Nach der Behandlung in einer Straßburger Klinik kam er nach Hause. Das dritte Kind, mein Bruder Gerhard, kam zur Zeit der Währungsreform am 14. Juni 1948 zur Welt und ich höre noch heute meinen Vater sagen, dass er die Hebamme noch mit Reichsmark bezahlt habe, welche dann zu 90 Prozent abgewertet worden war.
Zu dieser Zeit wurden die Kinder auf dem Land stark zur Mithilfe in der Landwirtschaft herangezogen. Neben der Arbeit im Feld in den Sommermonaten musste ich auch im Winter ran; der Vater war als Holzmacher im Gemeindewald tätig. Dorthin mussten wir Schüler immer das Mittagessen bringen, zu Fuß bis in den „Dürren Schlag“ im Unterwald. Meistens waren wir zwei Stunden unterwegs. Dann begann die Arbeit zu Hause mit Rübenputzen, Heu vom Heuschober herunterwerfen, die Stallhasen füttern, die Eier aus den Hühnernestern holen oder in der Rübenmiete auf dem Feld weiße Rüben und Runkelrüben holen. Da kam keine Langeweile mit null Bock auf wie oft in der heutigen Zeit. Doch an frostigen Tagen blieb auch mal Zeit zum Schlittschuhlaufen, meistens bei der „Hanfrözi“, beim Rebweg am Bahndamm. Dort in dem großen Weiher konnte man übrigens im Sommer auch baden gehen. In den ersten Nachkriegsjahren fuhr dort immer 10 Minuten vor 16 Uhr der Amerikanerzug vorbei mit Soldaten oder Zivilpersonen. Nicht umsonst warteten wir am Bahndamm, bis Päckchen voller Bohnenkaffee oder Schokoladentafeln von den Fahrgästen aus dem Zug geworfen wurden. Eishockey wurde damals auch schon gespielt.
Natürlich war die „Kinderarbeit“ in der Landwirtschaft nicht ganz ungefährlich. Im Alter von sieben Jahren musste ich abends immer Rüben rätschen. Die Rübenmühle hatte an der unten frei liegenden Walze viele Stahlzähne, die in gebogener Form ca. 5 cm lang und 1 cm stark waren. Die Mühle war etwa 1,50 m hoch, frei hängend und mit zwei Flacheisen an der Wand befestigt. Oben war ein Kasten aus Holz, in den die Rüben eingefüllt wurden. Als die Mühle am Laufen war, angetrieben vom Futterschneidemotor mit 1 kW, hielt ich mich oben am Einfüllkasten fest und zog mich hoch, die Füße an der Wand auf die Flacheisen gestellt. Ich wollte ja nur mal sehen, was da drinnen ablief, doch meine Neugier wurde bestraft. Danach nahm die Entwicklung ihren Lauf und ich war vermutlich der erste Mensch in Deutschland, der unter Zuhilfenahme des linken Knies einen Motor zum Stehen brachte. Vater war zum Rübenholen in der Scheune und hörte das Stottern des Motors. Da er der Meinung war, es sei eine Rübe zwischen Riemen und Antriebsrad geraten, rief er mir von draußen zu: „Kurt, stell ab!“ Vor Angst gab ich jedoch keine Antwort. Vater kam in den Futtergang und sah die Bescherung. Er stellte den Motor aus und befreite mich aus der misslichen Lage: Einer der Stahlhaken hatte sich in mein Schienbein unterhalb des Knies eingegraben. 1947 war es mit Krankentransporten noch nicht so weit her. Meine Eltern setzten mich in den Schesenwagen und Mutter marschierte mit mir nach Kippenheim zum Hausarzt Dr. Eggs neben der Eisenhandlung Müller in der Hauptstraße. Dieser nähte die offene Wunde ohne Narkose zu.
Wir drei Kinder bei Hertensteins in der Bahnhofstraße wurden „in der Zucht und Vermahnung zum Herrn“ erzogen und mussten regelmäßig zum Gottesdienst. Dafür sorgte hauptsächlich die Großmutter Christine, welche eine sehr fromme Frau war. Und als nach Pfarrer Wiederkehr Pfarrer Henschke die evangelischen Kirchengemeinden Kippenheim und Kippenheimweiler übernahm, konnte man einen Anstieg der Kirchgängeranzahl feststellen. Sein Slogan war: „Ein Sonntag ohne Gottesdienst ist kein Sonntag.“ Auch das Opfergeld beim Gottesdienst stieg etwas an, denn wenn der Pfarrer um das Opfergeld bat, war sein Spruch immer: „Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb.“
Bekanntlich wurden ja während des Zweiten Weltkrieges in den meisten Kirchen die Glocken zum Bau von Geschützen und sonstigen Waffen demontiert. Die Weihe der neuen Glocken 1949 war auch schon für mich im Alter von neun Jahren ein feierliches Ereignis, vor allen Dingen die technische Seite mit dem Hochziehen der Glocken in den Turm. Auf dem großen landwirtschaftlichen Anhänger der Familie Frenk waren die Glocken zunächst durchs Dorf gefahren worden, flankiert von den ganz in Weiß gekleideten Mädchen im Alter von ca. 14 Jahren. Auf dem Kirchvorplatz fand der Einweihungsgottesdienst statt. Auch der Gemeinderat und der damalige Bürgermeister Friedrich Fleig gestalteten die Feier mit.
Bei uns Buben entwickelte sich ständig eine große Sucht danach, die Glocken zu läuten. Unzählige Male begab auch ich mich zu Mesners (Familie Siefert) und trat vom Kirchplatz aus an das Küchenfenster, um die Schlüssel für die Kirche zu erhalten. Bereitwillig bekam ich diese dann durch Frau Frieda Siefert oder die Tochter Erika (heute: Frau Bohnert) ausgehändigt.
Im Jahr 1949 wurde der Sportverein gegründet. Es gab am Anfang nur die Abteilung Fußball. Einige Wylerter Fußballer spielten damals in Kippenheim. Nach der Gründungsversammlung im Gasthaus „Linde“ wurde dem Fußballbezirk Offenburg eine Mannschaft für die C-Klasse gemeldet. Wir Jugendliche kickten schon vorher meistens hinter dem Dreschschopf auf der dortigen Wiese. Als ich 17 Jahre alt war, sprach mich der damalige erste Vorsitzende, Hauptlehrer Karl Herrmann, an mit der Frage: „Willst du nicht Schriftführer machen beim Sportverein?“ Ich war etwas perplex, doch wusste ich, dass der erste Schriftführer des Vereins, Richard Studer, infolge seiner Heirat nach Offenburg umgezogen war und sein Nachfolger Kurt Gäßler beruflich nach Karlsruhe zog. So nahm ich diese Tätigkeit an und versah sie – mit kleinen Unterbrechungen wie zum Beispiel 18 Monate Wehrdienst bei der Bundeswehr – 27 Jahre lang. Auch hinterher lag mir der Verein immer sehr am Herzen, mich freute einfach die Arbeit mit der Jugend. Mit 17 Jahren war ich auch als Trompeter und Flügelhornist in die Musikkapelle eingetreten unter Dirigent Richard Werfel. Dieses Musizieren war übrigens der Übergang zur Gründung der Tanzkapelle Hertenstein durch den Musikkollegen Bruno Hertenstein. Er sagte damals Anfang 1959 sinngemäß: „Ich spiele Akkordeon, Hans Heck Gitarre, Heinz Berne Saxophon“, und zu mir, „du spielst Schlagzeug.“ Ich hatte keine Ahnung, spürte aber immer schon einen gewissen Rhythmus in mir. Freundlicherweise lieh mir Richard Baier sein Schlagzeug aus, wofür ich ihm heute noch dankbar bin. Es wurden daraus 55 Jahre in verschiedenen Tanzkapellen bis Ende 2013. Zuletzt waren es 15 Jahre im Senioren-Akkordeonorchester Friesenheim. Immer ging ich mit Fröhlichkeit und Begeisterung an die musikalische Arbeit und kam immer mehr zur Erkenntnis: Wenn die Menschen immer gut arbeiten, singen und musizieren und das biblische Gebot „Seid allzeit fröhlich!“ halten würden, dann gäbe es bestimmt keine Kriege auf der Welt.
Wir Hertensteins in der Bahnhofstraße wurden „s’Schange“ genannt. Der Großvater hieß Christian – im Elsass sagte man dazu „Chrischang“. Somit war mein Vater der Schange-Ludwig. Wir Kinder: dr Schange-Kurt, die Schange-Margrit und dr Schange-Gerhard. Unser Vater war im ganzen Dorf der Holzsäger. Er besaß eine fahrbare Kreissäge, deren großes Sägeblatt angetrieben wurde durch einen 5 PS starken Elektromotor. Bis etwa zu seinem 65. Lebensjahr betrieb er die Holzsägertätigkeit im Dorf. Der Motor hatte einen eigenen Stromzähler, die Kilowattstunden wurden zusammen mit den Hauszählern abgelesen. Den Strom holte unser Vater direkt an den Oberleitungen im Dorf, die er mittels Steigbügeln bestieg. Auf der Kabelrolle hinten am Sägefahrzeug befanden sich ca. 150 m Kabel. Meistens wurden im Umfeld mehrere Sägetermine zusammengelegt. Im Schopf des Ökonomiegebäudes zu Hause befand sich eine große Schrotmühle, mit der das Getreide der Kundschaft zu Viehfutter gemahlen wurde. Mit dem Leiterwägelchen oder sonstigen Fahrzeugen brachten die Dorfbewohner das Getreide in Jutesäcken. Das Mahlen eines Zentners brachte in den 1950er/60er-Jahren etwa 2 DM ein. Als Antrieb der Schrotmühle diente ebenfalls der 5-PS-Motor auf der Kreissäge. So hatten ich und auch später mein Bruder Gerhard fast täglich Gelegenheit, die Arbeit an der Schrotmühle zu verrichten, und wir kamen daher nicht auf dumme Gedanken. Die Konstruktion der Kreissäge und der Schrotmühle verdankten wir dem Onkel Heiner, Heinrich Zipf, Bruder von Lydia Hertenstein, unserer Mutter. Er war leider im Zweiten Weltkrieg gefallen und hinterließ die Ehefrau Berta aus Langenwinkel mit Sohn Klaus.
Zu unserem landwirtschaftlichen Betrieb gehörten auch Reben: zwei kleine Stücke mit 10 Ar „Im Ehrental“ an der Straße nach Sulz, ein weiteres Stück zu 5 Ar in der Gemarkung Kippenheim im Gewann „Haselstaude“. Bekanntlich war in der damaligen Zeit Ackerbau und Viehzucht dominierend im Dorf. Dieses wurde seinerzeit von etwa 650 Einwohnern bewohnt.
Alles Weitere aus der geschichtlichen Entwicklung des Dorfes ist ja im Buch erfasst; lediglich auf die damalige Volksschule möchte ich noch kurz eingehen. Hier ging es äußerst streng zu. Mit Fräulein Wöhrle und Lehrer Herrmann war selten zu spaßen. Oft gab es „Tatzen“ von der Lehrerin oder eine „Watschen“ vom Herrn Lehrer. Eine Geschichte erzählte man schon damals im Dorf. Ein Schüler musste sich – bäuchlings – auf den Tisch legen, da er mit einem Stock vom Lehrer auf den Po geschlagen werden sollte. Der Schüler hatte dies zuvor schon geahnt und einen dicken Atlas in die Hose geschoben. Zum Pech des Schülers schaute der Atlas jedoch etwa 2 cm aus dem Hosenbund raus. Als der Lehrer dies sah, war er nicht mehr zu bremsen, schäumte vor Wut und schlug so um die 20 Mal zu.