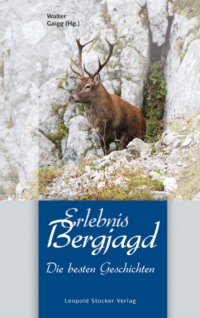Kitabı oku: «Erlebnis Bergjagd», sayfa 3
Was den Hirsch zu diesem ungewöhnlichen Auftritt veranlaßt hatte, wurde nie ergründet. In der Brunft gibt es viele Möglichkeiten. Unsere Falläpfel vom Fischerbauern werden vermutlich nicht viel dazu beigetragen haben!
Als ein völlig gebrochener Weidmann kam mein Bruder an jenem Oktobermorgen zur Hütte zurück. Alle Bemühungen Haralds, ihn mit einem schmackhaften Frühstück zu trösten, blieben vergeblich. „War das ein Hirsch! Bin ich ein Esel!“ Mehr war zunächst nicht aus ihm herauszukriegen. Erst später erzählte er uns den genauen Hergang der großen Tragödie.
Der alte Sechser aber erhielt an diesem Tag einen zweiten Namen. Er hieß fortan auch der „Sacktuchhirsch“!
Die Geschichte im Bahndurchlaß gelangte auf direktem Weg an die Ohren des Benzinger Jagdherrn, der sich darüber halbtotgelacht haben soll und uns schon am nächsten Tag auf der Rhonberghütte besuchte. In einer langen und sehr gemütlichen Plauderstunde wurde – wie könnte es auch anders sein–hauptsächlich über den geheimnisumwitterten „Sacktuchhirsch“ gesprochen. Auch der Nachbar kannte den alten Sechser mit dem Korbgeweih nicht. Seine beiden Jäger hatten ihn nie an einer Fütterung gehabt, keiner besaß einen Abwurf von ihm. Auch in der weiteren Nachbarschaft war er, wie sich später herausstellte, unbekannt. Es wird sich wohl um einen Zuwanderer aus Tirol gehandelt haben, dorthin war es ja nicht allzu weit.
Als sich der Benzinger Nachbar, es ging schon fast gegen Abend, verabschiedete, sagte er zu unserer großen Freude und Überraschung: „Sie haben sich solche Mühe gemacht um den alten Sechser, bitte, schießen Sie ihn ruhig bei mir herüben, wenn immer sie ihn haben können – er ist für Sie frei! Nur kann ich Ihnen dabei nicht behilflich sein, meine Jäger müssen noch Gäste führen. Also – Weidmannsheil auf den ‚Sacktuchhirsch‘!“
Wir konnten uns über soviel Großmut kaum fassen. Die Sache hatte aber schon wieder einen neuen Haken. Die Zeit Haralds und meines Bruders war abgelaufen, schon am nächsten Morgen reisten die beiden ab nach Norwegen, wo Harald eine Elchjagd vorbereitete und meinen Bruder dazu eingeladen hatte. Dieser kämpfte – ich weiß es – einen schweren inneren Kampf, den Elch sausen zu lassen und sich weiter seinem „Sacktuchhirsch“ zu widmen, auf den die Chancen ja jetzt dreimal so günstig standen als jemals zuvor. Und in wenigen Tagen würde die Hirschbrunft zu Ende gehen und der alte Sechser wahrscheinlich die „Rückreise“ ins Heimatland Tirol antreten. Aber die Reise nach Norwegen abzusagen, schien unmöglich. Vom Flug – damals noch ein Ereignis – angefangen, hatte Harald alles aufs beste geplant und vorbereitet. So trat mein Bruder schweren Herzens das uns vom Benzinger Jagdherrn eingeräumte Recht auf den „Sacktuchhirsch“ an mich ab, der allein für den Rest der Hirschbrunft auf der Rhonberghütte zurückblieb und über diese unerwartete Wendung der Dinge nicht gerade traurig war!
Der Rest ist schnell erzählt: Den ersten Tag nach der Abreise der Hüttengenossen benützte ich zur vorsichtigen Erkundung des Geländes im Benzinger Revier. Denn, außer daß der Hirsch mit seinem Rudel nach Überquerung der Aurach sehr früh steilbergan seinem Einstand entgegenzog, kannte und wußte ich dort drüben noch so gut wie nichts. Und selbst das wenige hatte er uns nur durch seine Stimme verraten.
Zu einer meiner neu gesammelten Erkenntnisse gehörte der Umstand, daß der einzige Steg, der über die Aurach führte, für mich einen Umweg von mindestens einer halben Stunde bedeutete. Zum Glück lag er für mich, der von der Rhonberghütte herunterkam, bachabwärts, so daß eine nächtliche Störung des auf den Wiesenleiten stehenden Wildes nicht zu befürchten war.
Der zweite Morgen brachte den ersten ernsthaften Versuch im Benzinger Revier. Das Rudel stand, genau wie ich vermutet hatte, schon vor Büchsenlicht nach Durchquerung des schmalen Hochmoors im Bergwald und zog langsam aufwärts. Der Hirsch meldete gut, aber ich kam, wohl infolge zu großer Vorsicht, zu spät an die entscheidende Stelle, einen Streifen Altholz und einen anschließenden schmalen Schlag. Als ich dort anlangte, fand ich alles leer. Die große, gleich oberhalb gelegene Dickung hatte den Hirsch samt seinem ganzen Rudel bereits verschluckt!
Auch am dritten Tag meines paradiesischen Jagens auf den „Sacktuchhirsch“ brach ein Morgen an, wie man ihn sich schöner nicht denken kann. Es gab einen starken Reif, bestes aller Vorzeichen. Mit dem Berg im Benzinger Revier fühlte ich mich schon ein wenig vertraut, aber natürlich noch längst nicht genug. Immerhin, mein Hoffnungsbarometer stand auf schön. Wie oft mag ich im Zwielicht des grauenden Morgens den Mittelfinger in den Mund gesteckt, wieviele Gräslein bei Tagesanbruch fliegen lassen haben, um nur ja keine mögliche Laune des Windes zu übersehen.
Es war noch sehr früh. Drüben, noch jenseits der Aurach, schrie der Hirsch auf „unserer“ Rhonbergleite, aber wie es mir, besonders im Angesicht des ideal schönen Morgens vorkam, bei weitem nicht mehr so eifrig wie an den Vortagen. Eine Ewigkeit schien zu vergehen zwischen dem Zeitpunkt, als er drüben verschwieg, bis zu jenem, da er endlich herüben den ersten Schrei im Benzinger Bergwald hören ließ.
So gut wie lautlos war das Rudel, wie alltäglich noch lang vor Büchsenlicht durch das kleine Moor wechselnd, eingezogen. Als es grau wurde, meldete der Hirsch, ließ aber an Eifer stark zu wünschen übrig. Immerhin erzählte er mir genug, um daraus zu schließen, daß das Rudel voraussichtlich den gleichen Wechsel annahm wie am Vortag.
Ich hatte nicht weit bis zu der Stelle, wo der bewußte Hochwaldstreifen anfing. Nur eine gute Viertelstunde früher als gestern mußte ich oben sein, darauf hatte ich meinen Plan genau aufgebaut. Heute wird es gelingen, das hatte ich, so, wie alles von Anfang an abrollte, fest im Gefühl. Es war der neunte Oktober, also auch insofern allerhöchste Zeit!
Ich erreichte ohne Zwischenfall, nur ein wenig atemlos, den vorgesehenen Platz und kauerte mich am Stamm einer alten Wetterfichte nieder.
Durch sein abermaliges Verschweigen stellt mich der Hirsch auf eine lange, bitterharte Probe. Sollte das Rudel wider Erwarten doch schon durchgezogen sein? Es ist schon lange gutes Büchsenlicht. Ein schneller Blick auf die Uhr. Da – ein deutliches Steineln zu meiner Rechten, etwas ober mir. Der Wind steht vorzüglich gerade auf mich herab, genau aus der Richtung, von wo das erregende Geräusch herkam. Nach kurzer Stille ein mürrisch tiefer Brummer, gar nicht weit. Sie kommen!
Das Herz schlägt mir bis über die Schläfen herauf, als das Leittier, nicht weiter als achtzig Schritt entfernt, mit unheimlich hochgestellt erscheinenden Lauschern den Hochwaldstreifen betritt. Dann geht es wie an einer Perlenschnur aufgereiht, Tier – Kalb – Tier – Kalb – Schmaltier – Tier, in solcher Reihenfolge ziehen sie zügig, aber vertraut durch den Bestand. Wieviele mochten es sein? Es ist wahrlich keine Zeit, sie zu zählen. Denn jetzt müßte der Hirsch kommen!
Er kommt nicht, er läßt mich sitzen und bangen. Das Rudel ist durch, genau so wie gestern von der großen Dickung aufgenommen.
Minuten scheinen zu vergehen. Es ist mäuschenstill. Enttäuschung, ja Wut will mich überfallen.
Eine rasche Bewegung etwas oberhalb der Stelle, wo das Rudel eben durchzog. Ein kleines, fast schwaches Schmaltier erscheint, verhält und äugt zurück: Und da steht „er“, frei und breit in einer Baumlücke, das Haupt mit dem steilen Korbgeweih, dessen helle Spitzen sich fast berühren, hoch erhoben, der alte Sechser mit den armdicken Stangen, der Aurachhirsch, der Sacktuchhirsch! Unbemerkt bringe ich die Büchse hoch, will ihm gerade ins Leben fahren – da, ein markerschütternder Schrecklaut aus unmittelbarer Nähe dicht hinter und unter mir: Leer ist die Bühne! Hirsch und Schmaltier sind verschwunden, wie vom Erdboden verschluckt, zwei Sekunden, bevor mein Schuß brach.
Ein anderes, verspätetes Stück Hochwild wollte unter mir durchziehen und bekam mich voll in den Wind!
Ganz ähnlich, wenn nicht ganz gleich, muß mein Bruder sich gefühlt haben, als er vor ein paar Tagen nach seiner Niederlage mit dem „Sacktuchhirsch“ den Bahndurchlaß verließ. Bis zum heutigen Tag habe ich die meine nicht verwunden. Dieser alte, freie Berghirsch von „nur“ sechs Enden wäre für mich der „Hirsch des Lebens“ gewesen!
Von jenem Morgen des 9. Oktober an war er fort und wurde nie mehr in der Gegend gesichtet. War er, ein unsteter freier Wanderer, abgebrunftet und weggezogen, oder war jener furchtbare Schrecklaut ihm vielleicht ebenso stark in alle Glieder gefahren wie mir, seinem Verfolger, und hatte ihn vergrämt? Niemand hat es je ergründet. Der „Aurachhirsch“ blieb für immer verschollen.
Heute noch bin ich dem Benzinger Jagdherrn tief dankbar für jene drei Jagdtage in seinem schönen Revier. Würde er aus dem Grab aufstehen und zu mir sagen: „Los, auf –, versuch’ es noch einmal mit dem alten Sechser an der Aurach!“ – mit tausend Freuden würde ich hinziehen, würde mir liebend gern, genauso wie damals, ein Dutzend Nächte auf der Rhonberghütte – ob sie wohl noch steht? – für ihn um die Ohren schlagen, und würde ihn wahrscheinlich eines schönen Morgens schießen. Danach würde ich sein Haupt mit dem engen Korbgeweih hinauf zur Hütte schleppen.
Ich würde es im Brunnentrog wässern und zuschauen, wie gelbe Blätter in das glasklare Wasser des eintönig murmelnden Brunnens fallen, aus dem die Geweihspitzen, die sich oben fast berühren, und wahrscheinlich auch die halbarmlangen Augenenden herausragen.
Ich würde das endenarme Geweih mit den prügeldicken Stangen in der Hütte selber auskochen und genauso eifersüchtig wie der rote Schweißhund darüber wachen, daß ja kein anderer zu nahe daran kommt oder mir beim herrlichen Tun helfend und werkend zur Seite steht.
Ich würde nicht müde werden, es zu betrachten, zu befühlen, zu wägen. Ich würde den unvergleichlichen Duft, jene einmalige Mischung aus Regen und Erde, Baum und Wild durch die Nase einsaugen.
Und ich würde lachen über alles, was man heute unter vielerlei Vorwand und grauer Theorie mit dem Hirsch und dem Rehbock der kargen Berglandschaft anstellt. Ich würde alle vielendigen Kapitalgeweihe, die man dem armen Berghirsch angemästet und anbiologisiert hat, diese Rekordgebilde, welche die Natur dem Hirsch und dem Rehbock nie und nimmer hätte wachsen lassen, ich würde das alles im Angesicht des starken Sechsergeweihs im Brunnen froh und guten Gewissens dahin wünschen, wo es hingehört!
Daß wir dem Wild ersetzen müssen, was wir ihm aus Profitgier im Wald und auf dem Feld weggenommen haben, ist doch eigentlich nichts anderes als eine selbstverständliche Pflicht. Eine Anstandspflicht, nicht nur des Jägers allein, sondern aller, die mit dem Wald und mit dem Acker noch etwas zu tun haben. Es ist eine schwerwiegende Frage menschlicher Moral, für uns Jäger ein Prüfstein jagdlicher Gesittung und Kultur. Gerade darum aber sind ungesunde Übertreibungen, wie sie heute so oft vorkommen, besonders gefährlich. Denn sie kommen gerade denen so schön zupaß, bei denen Anstand und Moral schon lange nicht mehr an erster Stelle stehen. Also – alles mit Maß und nie zur Unzeit!
Die Geschichte vom „Aurachhirsch“ sollte auch zeigen, wie ich mir einen „Trophäenkult“ vorstelle. Ein Berghirsch von „nur“ sechs Enden und vermutlich mit nicht viel mehr Pfunden im Geweih – für mich Traum und Erinnerung eines Jägerlebens, Inhalt und Inbegriff der Jagdtrophäe –, ihm hätte vielleicht einmal mein letzter Blick auf Erden gegolten. Aber er blieb für mich nur ein Traum. Doch was das Ärgste ist, und was ich doch eigentlich wollte und versprach: Sie hat wieder nicht geknallt, meine gute, treue Büchse!
WOLFGANG FREIHERR VON BECK (1905–2005), geboren in Hohenberg am Starnberger See, Oberbayern, hatte seit frühester Kindheit engen Umgang mit Wald und Wild. Als Volljurist leitete er lange den väterlichen Gutsbetrieb. Nach dem Zweiten Weltkrieg führte Wolfgang von Beck als bayerischer Jagdreferent in München einen doppelt schweren Kampf: einmal gegen den wahllosen, ungezügelten Wildabschuss der Besatzungssoldaten, ein anderes Mal gegen die Abschaffung des Revierjagdsystems. Er gewann, opferte aber dafür seine Stellung im Ministerium.
Nach 1949 wandte er sieh ausschließlich der Jagdschriftstellerei und der Wildfotografie zu.
Der Autor erhielt 1971 das Verdienstkreuz 1. Klasse der Bundesrepublik Deutschland, 1973 das Goldene Ehrenzeichen des Landesjagdverhandes Bayern und 1974 den Bayerischen Verdienstorden für seine Leistungen um das Jagdwesen verliehen.
W. Brenner
Ein schöner Damenschmuck
Tiergrandeln aus einem Gebirgsrevier der Ostalpen
Schon von weitem erblickten wir die vom Nachmittagslicht beleuchteten Türme der Basilika von Mariazell: eine gotische und zwei barocke Silhouetten, dahinter die Kulisse der Gebirgslandschaft. Wir näherten uns dem Endpunkt der ältesten Pilgerroute Österreichs, die von der Donau zum Heiligtum der Steiermark führt. Auf einem vorgeschobenen Höhenrücken steht die Kirche. Sie beherrscht die Ortschaft und bildet einen architektonischen Mittelpunkt in der wiesengrünen und waldumrahmten Landschaft des Tales.
In keinem Wallfahrtsort des Landes ist der letzte Nachglanz Altösterreichs noch so gegenwärtig wie hier, in der Kirche der Magna Mater Austriae, der Regina Hungariae, der Patrona der Slawen. In dieser Kirche lebt noch die Erinnerung an die historische Verbundenheit des Donauraumes – ein König von Ungarn ließ die ursprünglich gotische Basilika errichten – und auch an die Vielsprachigkeit der Donauländer. Man meint damit den weiteren Horizont von einst, man meint Rest und Erinnerungen, die selbst im Vergehen noch imposant genug sind und auf die man überall stößt: auf Relikte der europäischen Abenddämmerung vor dem Ersten Weltkrieg. Man meint Stimmung und Melodie, die in der Gegenwart noch als Unterton mitklingen. Es gibt etwas Kostbares, Unersetzliches, dem man eine stille Liebeserklärung schuldet: Reichtum an Kultur und Schönheit.
Wir kamen aus der Wachau; immer wieder neu erlebtes Glück der Kunst, ob Stift, Kirche oder Kapelle! Und man spürt, daß diese Kunst nicht Produkt nervöser Eiferer war, daß sie eine ruhige Überzeugung ausstrahlt, himmelweit entfernt von allem Düsteren. Die Unmittelbarkeit dieses Eindruckes läßt neben dem Glauben auch eine fast religiöse Weltliebe vermuten. – Ein besonders glückliches Zusammentreffen des Kunstgenusses und der jagdlichen Freude bestimmte diesmal unser Reiseprogramm. Unsere Stimmung stand noch ganz im Zeichen der in der Kremser Minoritenkirche erlebten großartigen Kunstausstellung, und dennoch war ich schon wieder in fröhlicher Erwartung. Die Jagdeinladung in das prachtvolle Revier in der Walster versprach weitere Höhepunkte für unsere kleine Urlaubsfahrt, die wir mit meiner Frau unternahmen.
Das alte, liebliche Land zwischen Donau und Alpen lag bereits hinter uns. Man müßte öfters diese Strecke befahren, um die Gegend richtig genießen zu können! Niederösterreich, das Kernland im Donautal mit seinen vielen Klöstern und Stiften, Schlössern und Kleinstädten, blieb zurück. Ein mildes Land ist dieses „Land unter der Enns“, es umarmt die eigene Mitte: Wien. Ein idyllisches Land der Thermalquellen, Römerfunde, Weingärten, der Heiden- und Rübenebenen, der dürftigen Föhrenwälder, der Berge, der melancholischen Kleinstädte, der wunderbaren Kunstwerke! Ein gutes Land, und doch in vielem so andersgeartet als die Steiermark, die vor Mariazell beginnt. Es ist leidenschaftsloser, weicher, geschmeidiger als die grüne Mark, wo wir wohnen.
Die sinkende herbstliche Sonne bestrahlte die Berge.
Auf dem Umweg über den Kreuzberg bogen wir nun in das Walstertal ein. Die bewaldeten Steilhänge und der häufig hervortretende nackte Kalkfels lassen hier stellenweise dem Bach und der Straße kaum Platz nebeneinander. Die Walster, dieser klare Forellenbach, strudelt mit hier und dort grünweißgischendem Schaum unmittelbar neben den Straßenkurven. Der Wald scheint rundum endlos zu sein, er wächst in eine Höhe, deren Ende man oft aus der Enge der Schlucht gar nicht sieht. Buche und Fichte wechseln einander ab, und eine klare, schwere Luft fließt von den Berglehnen ins Tal hinunter.
Eine eigentümliche Landschaft, eine isolierte kleine Welt, ist das Walstertal. Rundum Großgrundbesitz, private und staatliche Forstdomänen. Es fehlen daher die verstreuten Bauernhöfe, die für die Berglandschaft der Alpen sonst so typisch sind. Man sieht auch abends keine Lichter am Berghang, man findet kein Weidevieh beim Pirschen, keine Almen, nur Wälder und Wälder und ungestörte Gräben. Ein ziemlich menschenleeres Land, nur von Forstleuten und Holzarbeitern bevölkert, deren kleine Siedlungen kaum auffallen. Die meisten Häuser sind aus Holz, dessen ursprüngliche Farbe im Laufe der Zeit durch Verwitterung eine dunkle Tönung annahm oder aber braun gestrichen wurde. Klein und armselig wirken diese alten Häuser, doch ihre geschnitzten Fensterumrahmungen und vor allem ihre Blumen, eine Fülle von Nelken und Geranien, beleben das bei Regenwetter oft düster wirkende Bild.
Die Wälder werden von Hochwild, von Gams und Muffel bevölkert. Sobald man die einzige Durchzugsstraße verläßt, trifft man selbst in Sommerzeiten kaum noch Menschen. Auch darin liegt ein Reiz dieser Gegend.
In diesem Winkel zwischen Hochschwab, Mürztal, Mariazell und Alpenvorland stößt man noch überall auf das 19. Jahrhundert. Das zeigt schon das Kaiserdenkmal, eine Bronzefigur von Franz Joseph in Jägertracht; in einer Kurve der engen Talstraße stehend, die alte Hubertuskapelle, das einstige Kruppsche Jagdhaus neben dem Hubertussee und noch viele kleine Erinnerungssätten. Die Vergangenheit scheint hier noch Macht zu haben und die Gegenwart zu durchdringen, sie ist auf Schritt und Tritt noch gegenwärtig und durchwandert die Landschaft in langen, ruhigen Pensionistenspaziergängen.
Etwas oberhalb des hier schon breiteren Flußtales liegt das alte Forsthaus, daneben stehen zwei Jagdhäuser der Forstverwaltung. Die wohlbekannten Gesichter des Oberförsters und des Revierjägers lächelten uns bei der Begrüßung an. „Der Herr Graf hat eben vor zehn Minuten angerufen und nachgefragt, ob Sie schon angekommen sind“, berichtete der Oberförster. „Er wünscht Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und einen guten Anblick!“ Das war eine nette Aufmerksamkeit des Jagdherrn, in der bedächtig höflichen Art des Revierleiters übermittelt.
Revierjäger Nutz, dieser Vierziger mit dem Gesicht eines Knaben, mit der Höflichkeit mehrerer herrschaftlicher Revierjägergenerationen, half uns beim Auspacken. Er trug den Koffer meiner Frau ins Jagdhaus. Ich kannte Nutz schon seit Jahren, auch seine außerordentliche Begabung für künstlerische Wild- und Naturfotos, auch seine zähe, ruhige Art beim Pirschen.
Wie das Feuer eines Hüttenherdes, an dem man sich gelegentlich erwärmt, ist die Beziehung des Jagdgastes zum Berufsjäger, wenn man öfter ins selbe Revier zurückkehrt. Es ist meistens kein hochgeistiges Band, das zwischen den beiden entsteht, sondern ein Kontakt aus gegenseitigem Vertrauen, aus männlicher Achtung, aus natürlicher Distanz. Und je schwieriger die gemeinsame Leistung zu erreichen ist, um so fester wird die kameradschaftliche Bindung.
So wie eine Landschaft nur im Wandel der Jahreszeiten, nur im Wechsel der Witterung ganz zu verstehen ist, werden auch die Menschen durch ihre Umgebung und ihre Geschichte geprägt.
Der Menschenschlag, dem Förster und Jäger entstammten, ist besonders interessant. Die Leute sprechen, soweit ortsansässig, nicht die steirische Mundart, obwohl die Landesgrenze an der Reviergrenze verläuft, aber auch nicht den weichen Dialekt Niederösterreichs. Sie sind Nachkommen einst vertriebener salzburgischer Protestanten, die lieber in die Fremde zogen, als ihren Glauben aufzugeben, als hiezu der gestrenge Befehl des Fürstbischofs kam. Sie fanden damals in der kargen Einsamkeit dieses Tales Heimat und Zuflucht. Der Boden und die Besitzverhältnisse ließen keine bäuerliche Entwicklung zu.
Die Zuwanderer mußten sich daher zur Arbeit im Walde verdingen. Holzknechte, Flößer und Jäger wurden sie. Dieser naturnahe, zähe, stille Menschenschlag hielt dann bis heute dem unwirtlichen Boden der kleinen Heimat die Treue, bewahrte trotz der Abhängigkeit von der Grundherrschaft ein unaufdringliches Selbstbewußtsein, den Glauben der Vorfahren und das innige Verhältnis zu Wald und Wild. Kommt man aus dem Inneren der Steiermark, aus diesem leidenschaftlichen Land hierher, so hat man ein wenig den Eindruck, zu Puritanern gekommen zu sein. Und der Tonfall der Leute ist eine Mischung der Gebirgsmundart mit der Klarheit der Pastorensprache, die bei uns in Österreich immer noch ein wenig nach dem Norden klingt.
„Am besten, wir setzen uns oben zwischen Roßgraben und Krautgraben an“, hatte mir der Jäger nach den obligaten Probeschüssen schon vor der ersten Pirsch geraten. Nun saßen wir schon das dritte Mal an dieser Stelle. Es war ein Bodensitz, wie im Gebirge üblich, wenn man von irgendeinem geeigneten Punkt auch ohne Überhöhung der eigenen Position guten Ausblick hat. Unser Sitz befand sich auf einer Schneid‘ und bot nicht nur auf mehrere Hänge gute Sichtmöglichkeiten, sondern auch einen weiten Blick ins umliegende Land, auf die dunklen Fichtenbestände, auf die leuchtenden Buchen mit dem rotdunklen Bodenteppich, auf den Föhrenhochwald am Gegenhang, auf den kahlen, schildkrötenförmigen Rücken des Göller, auf den niedrigeren Sulzberg, auf den bald steigenden, bald fallenden Jägersteig, der uns hierhergeführt hat. Es war später Nachmittag.
Kaum hatte ich eine Viertelstunde oben gesessen, zog ein Tier mit Kalb ganz in meiner Nähe durch. Es gibt kaum einen friedlicheren Anblick, kaum ein eindrucksvolleres Bild der Mutterschaft in der Tierwelt als ein vertraut äsendes, führendes Rottier. Eine verborgene Schönheit liegt immer in diesem Anblick, wie eine Erfüllung der immerwachen Sehnsucht nach Leben und nach Fortpflanzung.
Der Oktober färbte bereits kräftig das Laub. Das klare Licht des Herbstes glänzte, und der sanfte Harzduft der Föhren und Fichten lag in der Luft. Ich roch direkt, wie die Nadeln wochenlang den Sonnenschein und den Sprühregen filtrierten, um diesen eigenen frischen Duft hervorzubringen, der sich dann mit dem Geruch des Harzes vermischte.
Das Tier mit dem Kalb verließ jetzt den Schlag. Die beiden wechselten in den Hochwald der Gegenseite ein. Ich ließ meinen Blick über die weitere Umgebung streichen, über die Bergrücken im Abendlicht.
Die Berge dieser Gegend stehen nicht, sie liegen im wahrsten Sinne des Wortes. In langgezogenen Linien schneiden sie scharf in den Himmel und setzten allem Irdischen eine betonte Grenze. Im Randgebiet der Alpen findet man echte Bergspitzen recht selten, eher Züge und Massive; es fehlt hier die Gotik der Gipfel und Zacken des Alpenhauptkammes, die Individualität der Bergformationen des Hochgebirges.
Die Ostalpen wirken oft schroff und schwer durchschaubar, weil es nur von wenigen Punkten einen weiten Ausblick gibt. Hier herrschen die Konturen annähernd gleich hoher Berge, zeichenhaft klare Formen bieten sich aus verschiedenen Blickwinkeln. Man braucht eine gewisse Vorstellungskraft, um Wesen und Ausdruck dieser Landschaft zu erahnen, die Sprödigkeit der oft schattigen Steilgräben nicht zu mißdeuten. Es ist eine rauhe Gegend, doch trotz ihrer kargen Verschlossenheit nicht hintergründig.
Am alten Buchenstamm neben meinem Sitz hörte ich ein Rasseln und Kratzen. Zwei Eichkätzchen liefen in nimmermüden Spiralen um den Stamm auf und ab. Sie spielten Fangen. Das eine, ein graugefärbter kleiner Missetäter mit dunkler Fahne, blickte mich im Vorbeihuschen jedesmal an. In den winzigen dunklen Augen lag eine Schelmerei, der man nicht widerstehen konnte. Ich hätte mich nicht gewundert, hätte der Kobold plötzlich mit einem Zweig, mit einer Eichel nach mir geworfen, um auch mich zum Spiel aufzufordern.
Später zog ein Kahlwildrudel durch den Jungwald unter dem Schlag und in den Hochwald ein. Ein auffallend helles Schmaltier stand beim Rudel. Kälber sah ich keine. Kaum war das Wild durchgewechselt, erblickte ich weit außer Schußweite oben am Kahlschlag des Hofberges ein zweites Rudel. Es waren vier Tiere, ein Spießer und drei Kälber. Manchmal schienen sie in den verdorrten Fratten des Schlages zu verschwinden, dann wieder leuchtete in der Abendsonne ein Wildleib oder ein heller Spiegel auf. Hirsche sahen wir nicht, diese hatten sich nach der Brunft in heimliche Bestände verzogen.
In die Gräben und Hänge legten sich allmählich die Schatten, nur in der Höhe leuchtete noch das Licht. Von diesem umflutet, stand oben die mächtige Föhre, ein einsamer Überhälter. Der Stamm glänzte dunkelrot. Unter mir trat jetzt ein recht guter Rehbock aus. Es war die schönste Stunde des späten Tages, sie offenbarte den tiefen Zusammenhang von Landschaft, Tier, Pflanze und menschlichen Gedanken. Sie kannte auch die Einsamkeit nicht, die uns so häufig überkommt, wenn träge Stille zwischen Tag und Nacht liegt. In solchen Stunden erlebt man, daß der Mensch ein antwortendes Wesen ist, selbst der Natur gegenüber.
Der Bock warf plötzlich auf und verhoffte zum Wald. Ein Häher rätschte und kreischte. Plötzlich stieg Spannung hoch; mir schien, als würde der Bach unten im Graben viel lauter rauschen. Dann aber zog der Bock behutsam fort. Ein Rudel Muffelwild kam zum Vorschein, das hat ihm offenbar nicht gefallen.
„Das macht nix, morgen werden wir wieder in diese Gegend kommen, hier hat man immer irgendeinen Anblick!“ meinte der Revierjäger, als wir bergab zogen.
Schön ist es, in einem hübschen, gepflegten Jagdhaus den Abend nach einer Pirsch zu verbringen. Schön ist es aber auch, Zeit für solche ausgedehntere Jagdaufenthalte zu finden. Dem ruhigen Pirschen ohne Zeitdruck wurde längst schon ein Garaus gemacht: Viele Jagdgäste möchten schon am Tag ihrer Ankunft im Revier, sozusagen beim Aussteigen aus dem Wagen – welches Glück! –, den Bruch auf ihren Hut stecken. Nichts aber verdirbt die Freude des Jagdpersonals mehr als die Hast, als der Mangel an Gelegenheiten, das Beste aus einer Pirsch herauszuholen, die Schönheit des von ihnen betreuten Reviers dem Gast zu zeigen. Und vor allem braucht der Jagdgast Zeit, um Sympathie und Vertrauen des Berufsjägers zu gewinnen, denn ohne die beiden gibt es kaum einen befriedigenden Erfolg.
Vor Morgengrauen saßen wir schon mit Oberförster Theubenbacher wieder draußen im Revier. Ein unbeschreiblich schöner Sonnenaufgang kam. Merkwürdig, daß die meisten Landschaftsmaler der Alpen das Tagwerden so vielfärbig, fast störend bunt sahen. Das liegt wohl daran, daß das Bunte und Grelle für Einheimische nicht alltäglich sind; sie wollen aber das Nicht-Alltägliche sehen und auch darstellen.
Mich aber faszinierte die rote Farbe dieses Morgens, dieses herbstlichrötliche Flammen ohne Rauch am Himmelssaum und über den Wäldern, und auch das Grün vielfältigster Variationen, das von endlosen Höhen zu den Bergen herunterzufließen schien. Wieder einmal erlebte ich durch die Jagd, wie sehr Bilder Gedanken und Gedanken Bilder sein können.
Mein Begleiter berührte behutsam meinen Arm. „Dort steht ein schwacher Hirsch, vielleicht zieht er näher!“
Das Wild schien soeben aus dem Hochwald oben an der Bergkante herausgezogen zu sein. Es war ein „Hirscherl“, ein recht schwacher Sechser. „Den könnten wir nehmen!“ meinte Theubenbacher bedächtig, während er den Hirsch mit dem Spektiv gustierte. „Gemma ihn an, der kommt nicht näher“, meinte er nach einer Zeit, da die Sonne den Berghang zu erwärmen begann und zu befürchten war, daß der Aufwind einsetzt.
Wir plagten uns gehörig, jede Deckung, jede Mulde, jeden Baumstock des Hanges auszunützen, um in die Nähe des Hirsches zu kommen. Dann lagen wir hinter einer kleinen Bodenerhöhung: Der Hirsch stand auf etwa fünfzig Gänge mit dem Spiegel zu uns – und äste.
Den Rest der Geschichte möchte ich nicht in die Länge ziehen.
Der Hirsch drehte sich nicht ein einziges Mal um, er stellte sich beim Äsen für keine Sekunde breit. Wir konnten den einzigen Körperteil an ihm bewundern, wohin man nicht schießen sollte. Und das ausgiebig; selbst dann, als die Losung kam. So vergingen die Minuten, wir hielten fast den Atem zurück. Der Hirsch tat uns nicht den Gefallen, den wir uns wünschten. Selbst dann nicht, als ein plötzlicher Windhauch kam und das Wild mit einigen raschen Fluchten im Bestand verschwand. Wir konnten nur seinem Spiegel nachsehen.
Abends zogen wir mit Nutz wieder zum Stand des Vortages. Die letzte halbe Stunde des Büchsenlichtes war angebrochen, da zuckte ich plötzlich zusammen. Hinter dem Waldrand fiel mir eine Bewegung auf. Mir schien, als ob sich etwas gerührt hätte. War es nur ein Zweig im Abendwind? Behutsam hob ich das Glas. Nichts. Minutenlang blickten wir scharf zur verdächtigen Stelle hinüber, doch nur die herbe Schönheit des Hochwaldes zeigte sich. Wir plauderten leise flüsternd weiter – ich erzählte dem Jäger eben von meinem Revier im Flachland, von dem Rehwild und dem Schwarzwild, das in unserer Gegend besonders gut zu gedeihen scheint –, da, wieder eine Bewegung! Mein Blick erhaschte einen verdächtigen kleinen Farbfleck. Oder war es nur ein brauner, verdorrter Farn?
Jetzt erblickte ich das Wild. Es trat fast bis zum Rand des Bestandes vor und schien den Wind zu prüfen. Die Minuten vergingen. Hirsch oder Kahlwild? Hinter dem Wildkörper rührte sich jetzt wieder etwas. Das Kalb?
Der Schlag lag schon im Halbdunkel, als das Kahlwild endlich ausgetreten war. Zuerst ein Alttier, dann zwei Schmaltiere und zuletzt ein Spießer. Die große Frage war: Steht noch ein Kalb beim Rudel, versteckt hinter dem Waldsaum, in den Fratten, im Gestrüpp des Schlages oder in einer Bodenmulde?
Das Leittier windete und äugte mit straffen Lauschern in unsere Richtung. Erst dann senkte es das Haupt und begann zu äsen. Doch immer wieder verhoffte es, prüfte den Wind und äugte hinaus in den allmählich verdämmernden Schlag.