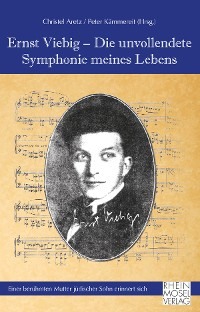Kitabı oku: «Ernst Viebig - Die unvollendete Symphonie meines Lebens», sayfa 3
2. Kapitel
Die Bühne dreht sich, ich stehe inmitten einer neuen Dekoration, beginne selbst zu handeln, Akteur zu werden in einem unaufhörlich wechselnden Geschehen mit einer unabsehbaren Reihe von Personen und Dingen, die das Drama meines Lebens füllen.
Zum ersten Mal stehe ich vor dem großen humanistischen Gymnasium in Zehlendorf, einem Bau aus rotem und grauem Gestein mit hohen Giebeldächern, schieferbelegt, ein wenig im Stil alter englischer Mansion-houses, mit großen Portalen und einer Inschrift in goldenen Lettern: »Nur dem Ernst, den keine Mühe bleichet, rauscht der Wahrheit tief versteckter Born (Schiller)«. Ich habe einen Schulranzen auf den Buckel geschnallt und eine Frühstückstasche umgehängt mit belegten Broten und einem geschälten Apfel (man durfte jetzt rohes Obst essen, die Zeiten hatten sich geändert). Ich trage einen Matrosenanzug der Firma Arnold Müller, die damals alle Kinder aus »gutem Hause« bekleidete. Auf dem Kopf habe ich einen grotesken Strohhut, breitrandig mit hochgestellter Krempe und einem fast mädchenhaften Schmuckband, auf dem »S.M.S.ILTIS« gedruckt ist und – werde zum Gespött meiner Kameraden, die alle Schülermützen tragen, blau und weiß mit einem farbigen Band rundherum, welches die Schulklasse bezeichnet, in die der Schüler eingereiht ist. Manche haben den stützenden Draht aus der Mütze entfernt und dem Mützenkopf durch Einknicken des Bandes einen verwegenen Aspekt gegeben. Heulend komme ich nach Hause, die Kinder haben mich gehänselt, haben mir den Hut, der unter dem Kinn mit einem Gummiband gehalten wurde, heruntergerissen, sind damit weggelaufen, ich hinterher, dann haben sie ihn auf den Fahrdamm der Straße geworfen, kurzum, ich bin tief unglücklich und will den Hut nicht mehr tragen. Vater schimpfte und schreit mich an – ich muss den Hut tragen. Hass gegen die, welche mich von dem Kollektiv meiner Kameraden trennen wollen, beginnt meine Seele zu verdüstern. Hochmütige Sätze meiner Eltern, wie »Kümmere dich nicht um diese Lausbuben«, »diese proletarischen Manieren«, »Sei stolz und gehe deiner Wege«, »Du hast mit derartigem Gesindel nichts zu tun« – bleiben in meiner Erinnerung und werden ihre Wirkung erst viel später zeigen. So war der Schulbeginn in Zehlendorf nicht erfreulich, zumal ich mitten im Schuljahr eingeschult wurde, also nur schwer dem Pensum folgen konnte. Meine Schrift war stets unkaligrafisch, mein Rechnen katastrophal, als Turner war ich damals ängstlich, einzig im Singen, in Religionsgeschichte und in Deutsch war ich gut.
Unsere Lehrer standen in krassestem Gegensatz zu dem modernen Bau der Schule. Es war eine Horde von bösartigen, verbissenen, ältlichen oder alten Raubvögeln. Die Professoren Hunger, Volkmann, Geister, Balsier waren die Schrecken aller, und es gab nur wenige Ausnahmen, wie unsern Lateinlehrer Asseyer, den Französischlehrer Platow, den Turnlehrer Schmid und den Gesangslehrer Barth, die in meiner Schulepoche eine menschenwürdige Rolle spielten. Die Atmosphäre dieses Gymnasiums war nicht gesund, sie war geladen mit Hass zwischen Lehrern und Schülern vice versa, kein Schimmer des Verständnisses für die Psychologie der Knaben und Jünglinge war bei unsern Lehrern zu spüren. Sturer Lehrplan und Drill kasernierten die Jugend und machte Herdenvieh aus ihr, und die, die Pädagogen sein sollten, waren zu Unteroffizieren der Wissenschaften entwürdigt. Erst viele Jahre später, als ich die Schule verließ, fand ich im Schillergymnasium des benachbarten Vorortes Lichterfelde Lehrer, wie sie sein sollten. So wurde meine Schulzeit in Zehlendorf von 1905 bis 1913, also volle acht Jahre lang, ein Martyrium.
Ich will mich nicht in Einzelheiten verlieren, wenngleich mir noch viele in Erinnerung sind, sondern mich mit den Folgen beschäftigen, die diese Lehrzeit auf meine Persönlichkeit hatte. Vorausschicken muss ich – wie ich schon sagte –, dass ich ein verzärtelter, verwöhnter und heterogen erzogener Knabe war. Ich war oft krank, namentlich litt ich schon damals an chronischen Bronchialkatarrhen, wurde in Sanatorien geschickt, zum Wintersport, wurde allen möglichen damals üblichen Abhärtungskuren unterzogen, bekam alle möglichen Medizinen, und der Hausarzt war oft gesehener Besucher im Elternhaus. Durch diese Krankheitsperioden kam ich schwer mit in der Schule, musste an den Nachmittagen mit meinen Nachhilfelehrern büffeln und wurde so versklavt durch die Fesseln meiner Pflichten. Schließlich – trotz allem – lernte ich viel, mehr durch das Elternhaus und das reiche Wissen meines Vaters als durch den Schulbetrieb. Alle freie Zeit galt dem Lesen. Die großen Bibliotheken meiner Eltern standen zu meiner Verfügung, so dass ich bereits als Knabe von zwölf bis fünfzehn Jahren außer mit den Klassikern auch vertraut mit den Werken Zolas, Dickens, Balzacs, Maupassants, Tolstois, Dostojewskis und vielen anderen war, wenn auch ohne die nötige Urteilsreife doch tief beeindruckt. Bücher, wie etwa die »Auferstehung« von Tolstoi, wühlten mich auf und ich vergoss Ströme von Tränen. »Germinal« machte mich zum glühenden Revolutionär, »L’ Assomoir« und »Nana« erregten meine erotische Phantasie zu beginnender Pubertät, und noch vieles andere. Vielleicht mag es ein Risiko gewesen sein, einen so jungen und immer empfindsamer werdenden Knaben all diese Bücher lesen zu lassen. Da aber ein Verbot nur das Gegenteil, meine Neugier gereizt hätte, war das kleine pouvoir, welches mir die Eltern hierin gaben, das kleinere Übel.
Mit unserer Übersiedlung nach Zehlendorf begann das Musikstudium, das heißt, ich lernte zunächst Klavierspielen bei einer ältlichen Dame, Fräulein Nipkow, die aber bald durch den Organisten, Herrn Hassenkamp, abgelöst wurde, der mir auch die ersten rudimentären Kenntnisse der Theorie und des vierstimmigen Satzes beibrachte, so dass eine erste Komposition meiner Feder, das Neujahrslied Mörikes für vierstimmigen a-capella-Chor, in der Kirche »uraufgeführt« wurde. Ich habe diese Komposition nie singen hören, denn am Tage der Aufführung war ich derart aufgeregt, dass ich, statt in die Kirche zu gehen, mit hohem Fieber ins Bett musste.
Das Klavier üben war mir, wie alle mechanischen Studien, ein Gräuel, und darum habe ich es als Pianist nie zu einer makellosen Technik gebracht. Als ich nach einigen Jahren bei Lehrer Hassenkamp dann in die Hände eines ausgezeichneten Pianisten, Paul Schramm, kam und meine Theorie-Studien bei Meister E.N. von Reznicek fortsetzte, änderte sich das Bild. Ich war ein erstklassiger Begleiter für Sänger und Sängerinnen. Mein feines literarisches Verständnis verband sich mit dem musikalischen, und ich durfte in ihrem Heim die große Hugo Wolf-Interpretin Julie Culp oft begleiten, sowie andere, die meine Eltern ins Haus zogen um meiner musikalischen Anregung willen. So lernte ich bald gut vom Blatt zu lesen und wurschtelte mich durch technische Schwierigkeiten einfach mehr oder weniger geschickt hindurch. Brauche ich zu sagen, dass damals Wagner und Hugo Wolf meine »Götter« waren? Das Erlebnis einer ersten Tristan-Aufführung warf mich für Tage aufs Krankenbett. Ich möchte hier in Paranthese einschalten, dass die erste Oper, die ich in der Königlichen Oper hörte, der »Freischütz« war. Die Oper war damals prächtig: Weingartner, Richard Strauss, Muck, Leo Blech – ohne Gastdirigenten zu nennen – leiteten das herrliche Orchester. Claere Dux, die Boehm van Endert, Geraldine Farrar e tutti quanti als Soprane, der junge Kirchhoff als Heldentenor, und viele andere große Namen, die mir im Moment entfallen sind, begeisterten mich zu wahrem Enthusiasmus. Caruso, den ich in »Pagliacci«, »Rigoletto« und »Carmen« hörte, ließ mich ziemlich kalt, ich schätzte ihn nur als Don José, immerhin ein Beweis für eine bereits bewusste Geschmacksrichtung. Wenig Verständnis hatte ich lange Zeit für Mozart, den ich, der ich »heroisch« und »dramatisch« eingestellt war, langweilig und verspielt nannte, während wiederum der »Fidelio« mich über alle Maßen beeindruckte. Die Dinge, die ich hier berichte, ziehen sich naturgemäß über Jahre hin, eigentlich über die ganze Epoche von 1905 bis 1914. Ich war in dieser ganzen Zeit mit Haut und Haar der Oper, dem Musikdrama verschrieben, und meine ersten Kompositionen, die ich allerdings eines Tages alle vernichtete – viele Lieder und Balladen von Boerries von Münchhausen, Texte von Liliencron und allen möglichen damals modernen Autoren, neben Goethetexten, Rimbaud, Verlaine und Baudelaire in deutschen Übersetzungen – gaben mir Anregungen zu ganzen Liederserien. Eines dieser Lieder »Dunkler Falter« von Münchhausen wurde damals oft in Konzerten gesungen. – Meine ersten Opernversuche bestanden zunächst in Andersens »Kleiner Seejungfrau«, kamen aber nicht über Skizzen und Anfänge (Gottseidank) hinaus, da mir ja der Textdichter fehlte und ich allein nichts Vernünftiges fertig brachte. Dunkel erinnere ich mich an einen Opernplan, der irgendwie mit mittelalterlichen Dingen zu tun hatte, weiß aber nicht mehr, was es eigentlich war, das mich beschäftigte. Ich glaube zu ahnen, dass es sich um Scheffels »Ekkehard« drehte, ein Beweis lediglich dafür, wie das Wagner-Erlebnis auf mich wirkte.
Abends im Dunkel oder Halbdunkel saß ich am Klavier und improvisierte. Meine Eltern, namentlich mein Vater, waren begeistert, zeigte doch der sonst so wenig gut geratene Sohn wenigstens in der Musik Begabung. Aber auch hier sollte es lange währen, bis der ungebärdige Most zu Wein wurde.
Ich blicke heute, an der Grenze des Greisenalters, nun mir nur wenig Zeit und Kraft bleibt, mit tiefer Trauer zurück auf diese Jugend, die ich – wie man später lesen wird – zum Großteil nutzlos vertan oder zumindest nicht genügend nutzbringend verwendet habe.
Jedenfalls stand es so ziemlich fest, dass ich Musiker, Kapellmeister werden würde, wenn auch insbesondere meine Mutter es lieber gesehen hätte, wenn ich in den Verlag meines Vaters eingetreten wäre, um ihn später zu übernehmen. Auch die medizinische Wissenschaft reizte mich sehr, und ich beschäftigte mich mit medizinischen Fragen schon als ganz junger Knabe ernsthaft und mit viel Verständnis. Schließlich hatte ich eine ausgesprochene Begabung fürs Kochen. Und da ich in der Schule so schwer mitkam bzw. nichts als Unfug trieb und zum Teil recht ernste Strafen bekam wegen meines immer ungebärdiger werdenden Wesens, wegen meiner glühenden Opposition gegen alles, was Schulbetrieb hieß, und wegen noch manch anderer Dinge, über die ich im folgenden berichten werde, plante Vater, mich zu einem »Traiteur« in die Lehre zu geben, mich dann ins Ausland zu schicken und aus mir einen großen Meister der Kochkunst zu machen.
Die Vielseitigkeit der Interessen: Literatur, Musik, Medizin und Kochkunst ist mir bis heute geblieben, sie hat aus mir einen allgemein gebildeten und vielleicht manchmal amüsanten Menschen gemacht, ein Glück war sie für mich nicht.
Noch einmal betrete ich die Szene, deren Prospekt die Zehlendorfer Schule ist. Ich beginne zu reifen. Aber nur einseitig. Alle Beschäftigung mit den größten Werken der Literatur, mit Musik, der geistige Einfluss meiner Eltern und vieler kluger Erwachsener haben meinen Geist damals nicht reicher werden lassen. Denn die Zeit meiner Pubertät war wie ein glühender Lavastrom, der alles andere mit sich fortriss und begrub.
Der Auftakt zu dieser Periode war der sogenannte Konfirmationsunterricht des evangelischen Pastors Anz und der Tag meiner Konfirmation. Mutter hatte meine religiöse Erziehung überwacht und ebenfalls die Großmutter Viebig. Ich war in »biblischer Geschichte« immer sehr firm und die Person Christi war mir lebendig im täglichen Gebet am Abend. Ich weiß gut, dass ich jeden Abend für mich mit gefalteten Händen betete, das Tischgebet »Komm Herr Jesus, sei unser Gast« war obligatorisch, kurz, ich war »fromm«. Das sollte sich schnell ändern. Wieder war es der Zwang und die Dogmatik, die mich zum Revoluzzer machten. Ich sträubte mich gegen den lutherischen Katechismus, gegen die »Auslegung« der Zehn Gebote mit ihrem »Was ist das?« – die Kontradiktion im »Wir sollen Gott fürchten und lieben« allein empörte mich bereits – und ebenfalls gegen den Glaubensbegriff als solchen. Ich störte die Konfirmationsstunden durch Fragen, die den Pfarrer in Verlegenheit bringen sollten und auch brachten, zur größten Freude meiner Kameraden. Ich bestritt die Glaubensthesen wie die Schöpfungsgeschichte, die Transsubstantiation, die Verwandlung von Wein in Blut, der Oblate in den Leib Christi, bestritt die Jungfräulichkeit der Mutter Maria unter lautem Halloh der Klasse, empörte mich gegen das dogmatische CREDO und verlangte nähere Details über den Begriff der Dreieinigkeit. Ich meine heute, es kann nicht nur Frechheit, Naseweisheit und Lust am Widerspruch gewesen sein, sondern es waren echte Zweifel, die mich verfolgten.
So kam es dazu, dass ich vom Unterricht ausgeschlossen wurde, und nur der persönlichen Bitte und Intervention meiner Mutter gelang es, dass man mich durch die Konfirmation in die christliche Gemeinschaft offiziell aufnahm.
Aber unter welchen Schwierigkeiten, die zum Teil nicht meine, sondern meiner Eltern Schuld waren! Es war üblich in Deutschland, dass zur Konfirmation die Knaben zum ersten Mal lange Hosen trugen, einen dunkelblauen Anzug mit langen Hosen. Gewiss, die Halbwüchsigen sahen dann aus wie Affen aus dem Zirkus, denen man menschliche Kleidung angezogen hatte, grotesk und albern, nicht wissend, wohin mit den noch unfertigen Proportionen ihres Körpers. Aber es war die allgemeine Sitte so. Was aber taten meine Eltern? Sie ließen mir einen Konfirmationsanzug machen im Stile der Lord Byron-Tracht, Escarpins und Lackpumps, ein dunkelblaues Samtjackett mit Byronkragen und Spitzen-Jabot. Man denke sich das Maß meiner Verzweiflung, welche sich in hysterischen Selbstmorddrohungen, in Heulen, Toben und Schreien Luft machte. Die sogenannte »Prüfung« am Vorabend des Festes, welches traditionell am Palmsonntag war, hatte ich mich kategorisch geweigert mitzumachen, und meine Mutter beschwichtigte den Pastor. Aber der Tag meiner Konfirmation ist mir, insbesondere meines karnevalesken Aufzuges halber in grässlicher Erinnerung. Nach der Kirche riss ich zuhause die Kleider herunter, zog meinen Matrosenanzug an und nahm in dieser Form an dem Festmahl teil, welches Paten, Verwandte und intime Freunde meiner Eltern vereinte, um den nunmehr zum Jüngling gereiften Knaben zu feiern. Noch heute schaudert es mich bei dem Gedanken daran.
Es ist klar, dass diese wilden und ungebärdigen Ausbrüche meines Temperamentes mitbestimmt wurden durch das Erwachen meines Sexualtriebes, der sich, angeleitet durch etwas mehr »aufgeklärte« Schulgefährten und Nachbarskinder vor allem in gleichgeschlechtlichen Handlungen Luft gemacht hatte. Trotzdem entsinne ich mich wohl, dass ich niemals ernstlich, auch später nicht, irgendwelche Neigung zu gleichgeschlechtlicher Sexualhandlung verspürte, auch nicht in der Zeit meines Soldatseins oder in andern frauenarmen Epochen. Wohl neigte ich stark zur Masturbation, namentlich in jener pubertären Periode, die in jeder Beziehung meine neurotische Veranlagung offenbarte. Nach dem Erlebnis der Konfirmation in dem Byron-Anzug versagte ich geradezu rapide völlig in der Schule, auch – noch vergrößert durch tägliche »Auftritte«, Prügel und Schreierei seitens meines Vaters – bestand ich nur noch aus wahren Hass-Komplexen. So gab es eine Zeit, in der ich meinem Vater nicht begegnen konnte, ohne wahrhafte hysterische Anfälle zu bekommen. Ich wurde ein Dieb, stahl Geld meiner Eltern, leerte langsam meine eigene Sparkasse aus Porzellan mittels eines in den Schlitz eingeführten Messers von den Goldstücken, die »Onkels« und »Tanten« dort deponiert hatten, und vergeudete das Geld in irgendwelchen Formen, namentlich in Gesellschaft mit Mädchen der Töchterschule, die ich in Konditoreien führte oder auf den Rummelplatz in Steglitz (einem andern Berliner Vorort). Geld war eine Sache, die »man« hatte. Im Elternhaus hörte ich niemals etwas darüber sprechen. Ich aber wollte mich mit fünfzig Pfennig Taschengeld in der Woche nicht begnügen und verfiel einer Form von Großtuerei – alles für den Psychologen natürlich klare Aspekte. Meine Mutter hatte ich »Lügnerin« genannt, als sie ein Dienstmädchen, welches in unserm Hause einen provozierten Abort hatte und fast verblutete, kaltblütig auf die Straße setzte. Ich wies sie auf ihre eigenen Bücher hin, in denen sie in jeder Form tiefstes Verständnis für die uneheliche Mutter, für den Sexus als Naturkraft (siehe Meister Zola) kundgab, und ich muss zu meinem Kummer gestehen, dass ich seit jener Zeit niemals mehr ein wirklich herzliches Verhältnis zu meiner Mutter fand. Später werden wir sehen, dass diese Kluft, die sich damals auftat, immer mehr vertiefte, bis durch die Macht der äußeren Umstände auch noch diese schwankenden Brücken zwischen uns zusammenbrachen.
Meine ja nicht besonders eigentümlichen Beziehungen zu meinen gleichaltrigen Genossen waren es aber nicht allein, die meine Seele verdüsterten: Die Einsamkeit und Richtungslosigkeit wurden immer größer. Ich floh von Hause fort, trieb mich eine lange Nacht im Walde herum, spielte ständig mit Selbstmordgedanken, las gierig ein Buch über Gifte, welches in der Bibliothek meiner Mutter stand, weil sie darin studiert hatte, als sie ihren Roman »Absolvo te« (eine Madame Bovary-Geschichte) schrieb. Ich grübelte, nun auch noch jeder Stütze der Gottgläubigkeit beraubt, hass- und wuterfüllt über alles, was mit der Kirche in Verbindung stand (grundlegend hat sich darin nichts geändert in mir bis zum heutigen Tag, nur in gerechterer und veränderter Form bestehend), hielt mich fern von jedem eigentlichen »Familienleben«, begann die wenigen Verwandten meiner Eltern zu meiden, wollte nichts zu tun haben mit irgendwelchen traditionellen bürgerlichen Bindungen, las eifrig Strindbergs Werke, immer wieder »Germinal«, »Fécondité« und dazwischen den »Bel-Ami« Maupassants, begeisterte mich an Edgar Allan Poe und weinte dann wieder mit »David Copperfield«. Den ersten Teil des Faust konnte ich auswendig, und die Kerkerszene »Mich fasst ein längst entwöhnter Schauder, der Menschheit ganzer Jammer fasst mich an«, schien mir eigens für meine persönliche Verzweiflung geschrieben zu sein. Das ist auch die Zeit, in der ich Nietzsches »Zarathustra« las (was ich davon verstand, weiß ich nicht) und – wieder ein herrlicher Zug meines Vaters, der gesehen hatte, dass ich »Zarathustra« las – fand auf meinem Schreibtisch die gesamten Reden des Gautama Buddha. Man braucht kein Psychologe zu sein, um sich vorstellen zu können, was all dies für die Seele eines 13-/14-jährigen Knaben bedeutete. Ich war hart am Rande des Wahnsinns. Man brachte mich zu einem Arzt (zum wievielten Male?), Herrn Dr. Körber, Vorsitzender des Renisten-Bundes, jener damals wichtigen philosophischen Gemeinschaft, der einer der ersten Psycho-Analytiker war. Ich erinnere mich dieses Barbarossa-bärtigen Mannes sehr wohl, ich lag auf einem Sofa und er bemühte sich, meine Träume und Gedanken zu entwirren. Fast jede Nacht war ich schreiend aus dem Schlaf geschreckt, Albträume verfolgten mich, namentlich einer, in dem meine Mutter mich küsste und ihr Gesicht im Augenblick des Kusses zu einem Totenschädel wurde, der mich in die Wange zu beißen versuchte. Auf der Straße hatte ich einmal die Halluzination, als ob ich selbst vor mir herginge; ohne Zweifel alles bedenkliche Zeichen einer hochgradigen neurotischen Veranlagung. Man kann sich vorstellen, welche seelische Belastung der Knabe für seine Eltern war. Auch der Arzt hatte nicht wesentlich helfen können, wenn auch das Verhältnis zu meinem Vater wenigstens sich besserte und ich die Angst vor ihm verlor. Immer wieder schickte man mich auf Reisen, zumal ich nebenbei stets mit den Atmungsorganen zu schaffen hatte, was schließlich zu einem schweren Bronchial-Asthma führte, an dem ich bis zum Jahre 1933 litt. Wie ich davon geheilt wurde, werde ich später berichten. Nach dieser Abschweifung in meine allgemeine Lage in jener Zeit, möchte ich noch mal zurückkommen auf die spezielle Frage meines unbefriedigten Sexus.
Wir hatten stets neben der Köchin, der Gouvernante und dem Zweitmädchen noch einen sogenannten »herrschaftlichen Diener«, der bei Tisch bediente, Silber putzte, die Pferde vom Tattersall holte und nach dem Reiten meiner Eltern diese wieder zurückbrachte, gröbere Arbeiten im Hause verrichtete usw.. Er hatte sein Zimmer im Souterrain in der ehemaligen Küche meiner Großmutter, welches entsprechend hergerichtet war. Nach verschiedenen erfolglosen Versuchen, den richtigen Mann zu finden, engagierten die Eltern Herrn Eugen. Herr Eugen, mit kleinem gestutzten Bärtchen und einer »Schmalztolle« war sehr vornehm, so vornehm, dass er gelegentlich einer Frage meiner Mutter, wo ich gerade sei, die für unsere Familie sprichwörtlich gewordene Antwort gab: »Herr Ernst sind auf dem Closé (sic)«. Als Diener war er trotzdem keine Leuchte seines Berufes, denn meine Mutter sagte von ihm: »Er ist zwar unfähig, aber wenigstens eine ehrliche Haut«. Wie sehr sie sich darin täuschte, wurde erst bemerkt, als wir von der Sommerreise zurückkehrten und Herr Eugen mit der gesamten Garderobe meines Vaters und allem im Hause befindlichen Silber verschwunden war, die ältliche Köchin Alwine, mit der er naturgemäß in unserer Abwesenheit geschlafen hatte, in Tränen zurücklassend. Die Polizei erwischte ihn schnell, morgens um zehn Uhr im Smoking meines Vaters mit einem großen Silbertablett unterm Arm, um dieses zu »verscheuern«. Er wurde als ein mehrfach vorbestrafter »Paletotmarder« identifiziert, und noch Jahre hindurch musste meine Mutter den Spott über ihre sogenannte Menschenkenntnis einstecken.
Dieser Diener-Verbrecher wurde also mein Lehrmeister in sexualibus. Ohne Zweifel war er auch noch im Nebenberuf Zuhälter, denn er verfügte über eine eindrucksvolle Fülle von Damenbekanntschaften, deren Fotografien er in einem Schuhkarton aufbewahrte. Allerdings waren die Fotos fast ausschließlich pornografischer Art, und zwar gab es kaum etwas an Perversionen, was in dieser Sammlung fehlte. Muss ich mehr erzählen und deutlicher werden? Ich denke, es genügt dieser Hinweis auf die Belehrung durch diesen häuslichen Krafft-Ebing, der ansonsten eine Aufgabe übernahm, die meine Eltern nicht erfüllt hatten, sei es aus Scheu, ein delikates Thema anzurühren, sei es wegen des stets gespannten Verhältnisses zwischen ihnen und mir. Der Diener Eugen machte seine Sache so gut, dass theoretisch dem 14-/15-jährigen nichts Menschliches und Unmenschliches auf dem Gebiete der Beziehungen von Mann zu Frau, von Mann zu Mann und Frau zu Frau mehr fremd blieb. Trotz alledem blieb es vorläufig bei der Theorie, und ich kann nicht sagen, dass durch diese Art der »Aufklärung« im damaligen Augenblick mehr Unheil angestiftet wurde, als bereits durch meine angebliche Erziehung schon getan war. So nannte mein Vater jedes Mädchen, welches mich antelefonierte, um sich mit mir etwa zum Schlittschuhlaufen oder Rodeln im Winter, zum Schwimmen im Sommer oder ähnlichen, völlig harmlosen Jugendvergnügungen zu verabreden, mir gegenüber: »Das Frauenzimmer hat telefoniert, ich habe ihr gesagt, dass du keine Zeit hast und arbeiten musst.« Anderntags erfuhr ich dann von meiner Freundin, dass Vater seine Stimme, die der meinen ähnlich war, so verstellte, dass man meinte, ich selbst sei am Telefon. »Ernst, wollen wir uns heute treffen um fünf Uhr?« fragte die Stimme. Mein Vater: »Es tut mir leid, ich kann nicht, muss Schularbeiten machen«. Ist es nötig, die solchen Sachen folgenden Auftritte zu schildern? Meine Wut über derartiges Vorgehen wandelte sich in eine Art Hass, dem das Verständnis für die gute Absicht Vaters fehlte, und heute will es mich dünken, dass manches, was ich später tat, aus all diesen Vorkommnissen zu deuten ist.
Zu jener Zeit brach ich mit dem Zehlendorfer Gymnasium, oder besser: es brach mit mir, da ich eine Menge Unfug getrieben hatte, bunte scheußliche Glaskugeln im Schulgarten demoliert, dem Professor Geister mit Steinen die Fensterscheiben eingeworfen, Karbid aus meiner Fahrradlampe in die Tintenfässer der Klasse gefüllt, Unterschriften meines Vaters unter Benachrichtigungen der Schule an ihn gefälscht hatte – kurzum mich als untragbar für das Lehrinstitut gezeigt hatte und überdies meine Versetzung in die Prima in Frage gestellt war. Ehe ich »cum infamia« aus der Schule geworfen wurde, nahm man mich heraus, um den Abgang einigermaßen glimpflich zu gestalten, und ich kam in Steglitz auf eine sogenannte »Presse«. Hier, unter meist älteren Kameraden reüssierte ich und lernte schnell. Es waren diese Institute, die nicht mit unnützem Kram das Gehirn und die Geduld der Lernenden belasteten, die Schüler als erwachsene, denkende Menschen betrachteten und dementsprechend behandelten. Ich holte sehr schnell Versäumtes nach und konnte bequem zum Semesterende in die Prima des Schillergymnasiums in Lichterfelde eingereiht werden, bis der Krieg 1914 meiner Schullaufbahn ein Ende setzte. Dieses letzte Jahr in Lichterfelde bewies mir, dass es denn doch nicht an mir allein gelegen hatte. Es wurde mir klar durch die Art von Unterricht und Behandlung, dass ich nicht für Schule und Elternhaus, sondern für mich selbst lernte. So beauftragte mich z. B. unser Lehrer in Griechisch an Hand der Schrift von Plutarch (Über die Musik) über griechische Musik einen Klassenvortrag auszuarbeiten und zu halten, er erkannte also mein persönliches Interesse an der Materie und benutzte dieses, mich in der Sprache fortzubilden.
Natürlich gab mir das Fahren in den andern Vorort auch ein größeres Maß von Freiheit, was mir gut tat. Die sogenannten »Poussaden« unterwegs haben mir nichts geschadet. Ich verliebte mich ununterbrochen neu in ein hübsches Gesicht, ohne allerdings zu ernsthaften Sexualhandlungen zu kommen. Trotz aller »theoretischer« Vorbildung hielt mich eine natürliche Scheu davor zurück.
In allen Ferien durfte ich verreisen, und zwar jetzt auch allein, so mit meinem Violoncello-Lehrer Herrn Berké nach Westerland, wo ich meine vielleicht erste Liebe hatte: ein Fräulein Simonsen, Tochter eines Hamburger Kapitäns, die wesentlich älter als ich war und gewiss kein unbeschriebenes Blatt. Trotz aller Avancen, die sie mir machte, war ich zu blöd, um die reife Frucht zu pflücken. Ich schwärmte nur, war noch nicht verdorben, und das Lieben an sich, das Lieben um ein Nichterreichbares befriedigte mich viel mehr, als es der endliche Genuss hätte tun können. Ich fühlte mich stets wie ein junger Werther, meine mit Romantik erfüllte Liebe – all das, was ich durch Jahre hindurch durch Lektüre in mich aufgesogen hatte – erlebte ich jetzt an mir selbst. So oft ich liebte in meinem Leben: ich habe stets gelitten wie ein geprügelter Hund. Und es ist ohne Frage der wesentlichste Grund meines später so abwechslungsvollen Liebeslebens, dass das Vorspiel, die qualvolle Lust des Leidens vor der Liebeserfüllung, für mich immer die wesentliche Essenz blieb, und dass nur, so lange diese seelische Anspannung bestand, das Objekt meiner Liebe für mich von Wert war; die reale Befriedigung des Triebes endete entweder in Enttäuschung oder in langsamer Entfremdung. Selbst später bei lang anhaltenden Liebesgemeinschaften suchte ich abseitig andere Liebesobjekte, um die Sensation dieser romantischen oder psychopatischen Veranlagung zu befriedigen. Nach außen hin erschienen die vielen sogenannten »Affären« als eine unkontrollierte Befriedigung der Geschlechtslust, ohne es wirklich zu sein. Ich könnte Fälle aufzählen, wo ich die begehrte Frau, nach dem sie meinem Werben nachgab, nicht einmal berührt habe: das Ziel war für mich erreicht, und damit der eigentliche Reiz verloren.
Ich schob diese, vielleicht etwas verfrühte Betrachtung meines Liebeslebens hier ein, weil der Fall von Fräulein S., deren Vornamen ich nicht einmal mehr weiß, mir bewusst in Erinnerung ist als typisch für viele, die folgen sollten. So habe ich niemals in meinem Leben geschlechtliche Befriedigung in Bordellen oder bei wohlfeilen Mädchen gesucht mit einer oder zwei Ausnahmen, die ich dann auch jedes Mal teuer mit meiner Gesundheit bezahlen sollte.
Im Frühling des Jahres 1914 reiste ich mit meinem Vater, der eine schwere Blinddarmoperation (damals durchaus noch nicht so einfach wie heutzutage) hinter sich hatte, zur Erholung auf die Isle of Wight nach Shanklin, einem durch den Golfstrom besonders klimatisch angenehmen Platz, und lernte zum ersten Mal Engländer im eigenen Land kennen. Es war eine besonders schöne Reise, sowohl was den Ort und das neue fremde Land betraf, wie auch die Gemeinschaft allein mit meinem Vater. Auf dieser Reise war mein Vater viel weicher, viel fröhlicher und aufgeschlossener denn auf Gemeinschaftsreisen, an denen meine Mutter teilnahm. Zumindest erscheint es mir in der Erinnerung so. Selbst eine Reise nach Glion oberhalb Montreux hatte ihre Krönung dadurch, dass Vater mit mir allein (Mutter hatte es als zu anstrengend abgelehnt) über Zweisinnen durch den damals neuen Simplon-Tunnel bis Domodossola fuhr, wo wir frühstückten und herrlichen Gorgonzola aßen, um am Nachmittag wieder zurückzufahren. Es ist das einzige Mal geblieben, dass ich durch den Simplon fuhr, später fuhr ich über den Brenner oder durch den St. Gotthard.
Auf dieser Englandreise sah ich zwar London nicht, sondern nur die Insel Wight, aber ich sah die Engländer, die typischen Figuren, die das Boardinghouse bevölkerten, wo wir wohnten. Ich lernte das ewige »mutton or roastbeef« in all seiner unförmigen Zartheit, die zahllosen Saucen von A 1 bis zum Mangoshutney, die einfach in Wasser gekochten Gemüse, den Yorkshire-Pudding und andere typische angelsächsische Spezialitäten kennen, ebenso wie die hysterische Begeisterung der alten Misses bei meinem abendlichen Vortrag der »Moonlight-Sonate from Beethoven«. Eines nachmittags verloren wir den Weg auf einem längeren Spaziergang, und Vater fragte einen vorüberkommenden Clergyman um Auskunft. Dieser lud Vater und Sohn ein, vor dem Heimweg in seinem Haus eine Tasse Tee zu trinken, was Vater gerne annahm. Der Herr führte uns einige hundert Schritte weiter zu seinem Haus. Was sage ich »Haus?« Es war ein efeubewachsenes Schlösschen im Tudorstil inmitten eines Parkes (er war der zweite Sohn irgendeines Lords oder Pairs, welche oft den Geistlichenberuf wählten). Der Butler öffnete, und keine zehn Minuten später saß ich an einem Teetisch, wie ich ihn nie vorher noch nachher im Leben gesehen habe, einem Teetisch, zu dessen Vorbereitung eine deutsche Hausfrau viele Stunden gebraucht hätte. Ohne durch Einzelheiten die Esslust meiner Leser reizen zu wollen, mag genügen zu sagen, dass tatsächlich nichts fehlte an süßen oder pikanten Leckereien, was Auge und Magen begehren könnten. Und die Form, das feinste Porzellan, das alte Sterling-Silber, die Atmosphäre um den runden Mahagonitisch herum, die alten Ahnenbilder an den Wänden, die Gobelins und schweren Teppiche – die scheinbar verstaubte Pracht einer heute vergangenen Zeit. Aber, es mag merkwürdig klingen: sie war nicht verstaubt, sie war lebendig, sie sprach, gemessen und mit etwas gezierter, leiser Diktion, denn ein lautes Wort hätte den Zauber zerstört, wie etwa das Knistern von Butterbrotpapier während des Liebesduetts im Zweiten Akt des Tristan. Die beiden Herren sprachen über alles mögliche und schließlich auch über Deutschland und den Kaiser. Der Engländer war sehr interessiert an einem Buch, welches gerade herausgekommen war, als dessen Autor der Kronprinz zeichnete, über das deutsche Heer. Vater versprach es ihm zu senden, was er nach unserer Rückkehr denn auch sofort tat. Drei Monate später waren die beiden Länder im Krieg: der Wahnsinn war ausgebrochen.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.