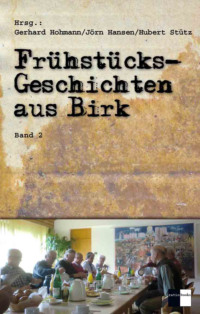Kitabı oku: «Frühstücksgeschichten aus Birk»
Hrsg.:
Gerhard Hohmann/Jörn Hansen/Hubert Stütz
Frühstücks- Geschichten aus Birk
Band 2


Das Redaktionsteam, v.r.: Hubert A. Stütz,
„Frühstückdirektor“ Hubert Simon, Dr. Jörn Hansen
Dr. Gerhard Hohmann, Franz König
Fotos der Autoren und Bildbearbeitung: Dr. Jörn Hansen
Gerhard Hohmann / Jörn Hansen / Hubert Stütz (Hrsg.)
Frühstücks-Geschichten aus Birk
Band 2
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Alle Rechte vorbehalten!
Impressum
ratio-books • 53797 Lohmar • Danziger Str. 30
info@ratio-books.de (bevorzugt)
Tel.: (0 22 46) 94 92 61
Fax: (0 22 46) 94 92 24
eISBN 978-3-939829-86-7
published by

Inhalt
Vorwort
Manfred Becker
Als ich Schüler war
Wolfgang Beyer
Mein Leben als Asylant
Willi Bröhl
Meine Jugend in meiner Heimatstadt Siegburg
Dieter Decker
Ilmenau, Goethe, Krallenfrösche, Schmuggler, Sputnik und Pamir
Rolf Diepenbrock
Diana – Die Göttin der Jagd
Wolfgang Giesener
Amis ante portas
Jörn Hansen
Und ich wurde doch kein Seemann
Gerhard Hohmann
Meine Piroschka hieß Erika
Gerhard Hohmann
Ferienfahrschule
Siegfried (Siegi) Klingshirn
Der kleine Oberbayer
Franz König
Henko, Persil und Sil
Max Lagoda
Ein verunglückter Flug
Hubert Simon
Flucht aus Schlesien 1945
Hubert Simon
Höhlenforscher
Gerd Streichardt
De Klopphannes vun Krölenbroich
Hubert A. Stütz
„Kinder- und Jugendarbeit hat nicht geschadet“
Hans Warning
Vom „Fringsen“ und „Maggele“
Vorwort
„Frühstücksgeschichten aus Birk“ heißt dieses Buch, weil es von Teilnehmern des Birker Männerfrühstücks geschrieben worden ist. Einmal monatlich treffen sich Senioren zum gemeinsamen Frühstück, unterhalten sich über Gott und die Welt und erzählen auch gern über ihre persönlichen Erlebnisse aus Gegenwart und Vergangenheit. Und irgendwann kamen sie auf die Idee, ihre selbst erlebten Geschichten aufzuschreiben. Ohne jede thematische Beschränkung entstand so der erste Band, der vor zwei Jahren erschienen ist. Die erste Auflage ist inzwischen vergriffen. Nicht erloschen ist jedoch die Lust, weitere Geschichten zu schreiben und in einem neuen Band zu veröffentlichen.
Dieser zweite Band sollte sich vor allem mit den Erlebnissen aus der Kindheit und Jugend befassen, sich also vor allem mit den Verhältnissen in den Vierziger- und Fünfziger-Jahren des vorigen Jahrhunderts beschäftigen. Jeder von uns durfte seine Erlebnisse und Gedanken aus jener Zeit aufschreiben, so wie er sich erinnert und wie er sie heute bewertet. Keiner von uns ist Schriftsteller und keiner von uns hat je einen Kurs über die Kunst des Schreibens absolviert. Jeder aber, der wollte, sollte das schreiben, was er für erzählenswert hielt, und so schreiben, wie er es konnte und wollte. Nicht jeder hat sich an die gesetzte Vorgabe gehalten; doch haben wir auch deren Beiträge übernommen und alle so gelassen, wie sie abgegeben worden sind.
So sind Geschichten entstanden, die sehr unterschiedlich sind: kurz und bündig oder ausführlich gründlich, sachlich oder emotional, belehrend oder zurückhaltend. Nennen wir es, was schon zum ersten Band gesagt wurde: Das Buch hat eine „Narrative Breite“. So sind die einzelnen Geschichten immer individuell geprägt und geben persönliche Meinungen wieder, die man nicht immer teilen muss. Und gerade darin besteht der Reiz dieses Buches. Es ist ein buntes Bild des Lebens aus vergangener Zeit, wie es die einzelnen Schreiber ganz persönlich erfahren und bewertet haben. Möge der Leser sich in der einen oder anderen Geschichte wiederfinden und sagen können: „Ja, so ähnlich war das bei mir auch.“
Neu ist, dass in dem Buch auch Fotos abgebildet werden. Wer mitgeschrieben hat, hat sich im Anhang vorgestellt. Die Reihenfolge der Geschichten richtet sich nach den Namen der Autoren, wie es das Alphabet vorgibt.
Auch dieses Mal muss Franz König besonders erwähnt werden. Ihm verdanken wir, dass auch dieser Band, so wie er vorliegt, erscheinen kann.
Dr. Gerhard Hohmann Hubert A. Stütz Dr. Jörn Hansen
Manfred Becker
Als ich Schüler war
Wenn man unsere Schulerlebnisse aus den vierziger und fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts mit denen unserer Enkelgeneration vergleicht, gibt es unter anderem für mich zwei bedeutende Unterschiede: Zum einen rutschten damals bei einigen wenigen Lehrern schon einmal die Hände aus, wenn es um „Fehlverhalten“ unsererseits ging. Das wäre heute vollkommen unmöglich, sei die Provokation noch so groß. Zum anderen konnten wir uns bei pauschalen Beurteilungen – damals ohne Notendifferenzierungen (von 1,1 bis 4,9) – zufrieden geben. Denn neben der Schule gab es genug Freizeit, zum Beispiel für Sport oder Musik. Wir standen einmal unter Druck, aber Stress war uns unbekannt.
Wie war das also vor langer Zeit?
Im harten Winter 1947 kam ich von der vierten Jungen- und Mädchen-Klasse der evangelischen Humperdinck-Schule in Siegburg nach eintägiger Prüfung zum Staatlichen Gymnasium, Siegburg (heute Anno-Gymnasium). Da gab es nun im Frühjahr drei Sexten (heute 5. Klassen) mit je über 50 Jungen. Das Mädchen-Gymnasium hatte damals in den ersten zwei Jahren noch kein eigenes Gebäude; deswegen befanden sich die Mädchen zwar separat, aber wie wir im gleichen Gebäude (heute Volkshochschule) im Schichtunterricht. Unsere drei Sexten waren so eingeteilt, dass in der a-Klasse die katholischen Schüler aus Siegburg waren. In der b-Klasse waren die restlichen katholischen Schüler des Siegkreises (aus der unteren und der oberen Sieg, aus dem Aggertal, aus der Much-/Neunkirchen-Gegend sowie aus Richtung Bonn) untergebracht. Der c-Klasse, in der auch ich war, waren die evangelischen Schüler und einige „Reste“ zugeordnet worden. Dankenswerterweise gibt es schon seit Langem solche religiösen und geschlechtsspezifischen Differenzierungen nicht mehr.
Das Schuljahr begann mit einem Schulsportfest am Brückberg auf dem Platz des Siegburger Turnvereins. Eröffnet wurde die Veranstaltung mit dem uralten Turnerlied:
Turner auf zum Streite,
Tretet in die Bahn,
Kraft und Mut geleite
Uns den Weg hinan!
Jede Klasse durfte sich in einer bestimmten Disziplin betätigen; die drei Sexten liefen Pendelstaffeln, sodass wohl alle Schüler beteiligt werden konnten. Erinnern kann ich mich nicht mehr, ob wir gewonnen hatten; das bedeutet wohl Platz zwei oder drei.
Unser Klassenlehrer Dr. Müller (Mü 3, natürlich waren da auch Mü 2 und Mü 1, der übrigens der violette Mü genannt wurde) gab nicht nur Latein, sondern er vermittelte dabei auch römische Geschichte. Er war verständnisvoll und souverän, was bei mehr als 50 Schülern bestimmt nicht einfach war. Dass er nacheinander alle Eltern besuchte, war einmalig und bemerkenswert.
Unser Lehrer für Deutsch und Erdkunde, genannt Bömmel, pflegte einen sehr rauen Ton. Wer ihm nicht passte, konnte schon einmal als Meerschweinchen oder Prolet bezeichnet werden. Im Steigerungsfall wurden sogar Leute vor die Tür gesetzt, bald schon eine Unmöglichkeit.
Am Anfang des Unterrichts wurden manchmal essbare Naturalien eingesammelt, was sicher der Versorgungssituation geschuldet war und sich für den Geber nicht negativ auswirkte. Ich erinnere mich an ein Friseurgeschäft, dass der Bömmel regelmäßig auf dem Heimweg mit seinem Fahrrad passierte. Er fragte einmal die Klasse, wie das Gebäude aussah. Die Antworten, es sei ein Friseursalon, schienen ihn nicht zufriedenzustellen. Da das Schild Salon Michels infolge von Bombensplittern das „n“ verloren hatte, wagte ich die Antwort „Salo Michels“ und ging sofort in Deckung, weil ich eine „unfreundliche Handlung“ erwartete. Doch zu meinem Erstaunen wurde ich wegen meiner „aufmerksamer Beobachtung“ gelobt.
Im Laufe mehrerer Jahre, nach der Währungsreform (1948) und nach einigen Wechseln von Lehrern und Direktor normalisierte sich der Schulbetrieb, und aus den über 150 Schülern der damaligen Sexten wurden dann im achten Schuljahr zwei Klassen mit jeweils etwa 30 Schülern.
Von besonderer Erinnerung blieb mir Studienrat K., Herr der Biologie und des Turnsports. Als ihn die „bösen“ Schüler zu sehr ärgerten, drohte er damit, in kommenden Kriegs- und Hungersituationen seine „mühsam erworbenen Erkenntnisse zur Zucht von Riesenkarnickeln uns nicht zur Verfügung zu stellen“. Er sagte, er werde „schweigen wie ein Grab“. Seine Eintragungen ins Klassenbuch waren zahlreich und sollten der Disziplinierung dienen. Eine harmlose Form war: „Becker macht freche Bemerkungen.“ Schlimmer empfand ich, als ich wegen „Unbotmäßigkeit“ nach vorne zitiert wurde und von ihm gefragt wurde, ob ich es tragen wollte, wie ein Mann. Die Ohrfeige war nicht leicht. Beim Turnunterricht hielt Studienrat K. in ähnlicher Manier auf Disziplin. Auf dem Sportplatz des Siegburger Sportvereins an der Waldstraße war von ihm eine Bahn zum 3000-m-Lauf abgesteckt worden. Die von ihm gestoppte Siegerzeit war phänomenal, weshalb ein Kenner der Leichtathletik sagte: „Aber Herr Studienrat, das wäre doch Weltrekord.“ Die Antwort war überraschend sanft: „Na, dann freut Euch doch!“
Am letzten Schultag in der Mittelstufe (Untersekunda = 10. Klasse) gab es in der Klassenpause ein großes Chaos. Zufällig kam der sehr gefürchtete Oberstudienrat Dr. Schwamborn, der stellvertretende Direktor (übrigens aus Heide) dazu, rief uns zur Ordnung und verließ den Klassenraum mit der Drohung, dass er „den Sauhaufen auf Vordermann bringen würde, sollte er einmal unser Lehrer sein“. Am ersten Schultag der Oberstufe geschah das nicht Erwartete: Dr. Schwamborn wurde prompt der Klassenlehrer. Französisch und Englisch waren seine und unsere Fächer. Entgegen allen Erwartungen erwies sich „Schwamborns Hein“, wie er unter Schülern genannt wurde, als ausgezeichneter Pädagoge und äußerst verständnisvoller, toller Lehrer.
Neben Schule und Spiel gab es für mich noch das Singen bei den Siegburger Sängerknaben (SSK), die am Anfang des Jahres 1948 gegründet wurden. Die ersten Auftritte hatten wir im Saal des Restaurants Lindenhof in der Kronprinzenstraße. Von besonderer Bedeutung war wohl die Teilnahme an einer Veranstaltung in der Bonner Pädagogischen Akademie, wo im Rahmen der Eröffnung zum Deutschen Bundestag neben unserem Knabenchor auch Operettensängerinnen und Operettensänger (Schenkt man sich Rosen in Tirol etc.) auftraten. Dass ich im SSK die vierte und im Schulchor die erste Stimme hatte, schien nicht nur für meine „Vielseitigkeit“ zu sprechen, sondern auch für die „Flexibilität“ der Lehrer.
In guter Erinnerung ist auch eine Außenprobe des Knabenchors am Johannistürmchen des Michaelsberges. Der Text der ersten Strophe wäre eigentlich heute viel aktueller:
Aus der Jugendzeit, aus der Jugendzeit
Klingt ein Lied mir immerdar.
Oh wie liegt so weit, oh wie liegt so weit,
was mein einst war.
Wolfgang Beyer
Mein Leben als Asylant
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Deutschland in mehrere Besatzungszonen aufgeteilt, in denen die jeweilige Siegermacht nach ihren Vorstellungen die Staatsmacht ausübte. Für Deutschland als Ganzes gab es den Alliierten Kontrollrat, der versuchte, allgemeine Regeln für die Behandlung des besiegten Deutschland aufzustellen. So lief im Frühjahr 1946 in der deutschen Bevölkerung die Meldung um, der Kontrollrat habe empfohlen, auf den „sogenannten gefährlichen deutschen Nachwuchs“ zu achten und ihn „sicher zu verwahren“. Diese Direktive wurde äußerst unterschiedlich umgesetzt. Während Amerikaner, Engländer und Franzosen sie großzügig handhabten, setzten sie Russen und Polen umso rigider um. „Gefährlicher Nachwuchs“ war unter anderem jeder, der vor dem Jahre 1945 eine weiterführende Schule, zum Beispiel – wie ich – das Gymnasium besucht hatte. Sie gingen dabei so „gründlich“ vor, dass von meinen über 40 Mitschülern der Quarta nur drei das Jahr 1946 überlebten.
So erschienen im Juni 1946 auch zwei bewaffnete russische Soldaten bei uns auf dem Hof in Badenau, Kreis Leobschütz, Oberschlesien und verlangten, mich zu sprechen. Als sie mich sahen – ich war ein 14 Jahre altes, kleines schmächtiges Kerlchen – fingen sie an, untereinander zu diskutieren. Während sie noch miteinander redeten, tauchte plötzlich und völlig unvorhergesehen ein junges Mädchen auf. Von da an spielte ich keine Rolle mehr, sondern die Russen nahmen sie mit, vergewaltigten sie und ließen sie dann wieder laufen. Mich hatten sie offensichtlich völlig vergessen. Meine Mutter war es, die als Erste den Ernst der Lage begriffen hatte und erklärte: „Junge, du bist hier nicht mehr sicher, du musst weg.“ Sie begann noch an demselben Tag, ein Bündel Fluchtgepäck für mich zu schnüren. Dann begannen sich die Ereignisse zu überschlagen. Als ich am nächsten Tag in der Nähe der Polizeistation herumstrolchte, hörte ich durch das offene Fenster die Polizisten wiederholt meinen Namen nennen. Ich ahnte, was das bedeutete und lief nach Hause. Dort erwartete mich schon meine Mutter, denn ein Pole habe ihr soeben höhnisch gesagt, „heute würde ihr Sohn eingefangen“. Es blieb für mich nur die Zeit, zwei Anzüge übereinander anzuziehen, mein Bündel zu schnappen und durch die Felder in Richtung Tschechoslowakei abzuhauen. Wenige Minuten später durchsuchten die Polen unser Haus und dessen Umgebung, natürlich ohne Erfolg. Da die Polizisten nicht wussten, wohin ich verschwunden war, stellten sie zunächst die Suche mit dem Bemerken ein, sie oder ihre Kollegen in den Nachbarorten würden mich schon finden.
Für mich gab es nur ein Ziel, mich nach Langendorf, Kreis Sternberg in der Tschechoslowakei, durchzuschlagen. Dorthin hatte es meinen Onkel Anton, bis 1945 Arzt in Branitz bei Troppau, verschlagen. Da die Tschechen zu wenige eigene Ärzte hatten, hatten sie meinen Onkel zur Behandlung ihrer Leute in Langendorf festgesetzt. Er hatte im Erdgeschoss des örtlichen Schlosses seine Praxis und seine Wohnung. Da der örtliche Polizeikommandant im ersten Stock des Schlosses sein Büro und seine Wohnung hatte, war auf diskrete Weise für die Kontrolle des Deutschen gesorgt. Dieser Onkel war einer der in der Familie verabredeten Punkte, bei denen sich die Mitglieder der Sippe melden sollten, wenn sie den Krieg überlebt hatten.
Für uns unter den Russen und Polen leidenden Deutschen galt die Tschechoslowakei damals – vor der Machtergreifung durch die Kommunisten – noch als Rechtsstaat und Hort der Menschlichkeit. Wir kannten nicht das Schicksal der Sudetendeutschen. Dementsprechend hatten mir meine Eltern als Ziel meiner Flucht blauäugig Langendorf, Kreis Sternberg, vorgegeben. Da ich die Umgebung meines Elternhauses bis zu einem Radius von 30 Kilometern von Treibjagden und Ausflügen her kannte, konnte ich Ortschaften und Straßen umgehen. Dabei stieß ich immer wieder auf Deutsche, die mir halfen und mich vor Kontrollpunkten warnten. Das war aber auch notwendig, da ich inzwischen aufgrund der scheinbaren Leichtigkeit meiner Flucht leichtsinnig wurde und, statt querfeldein zu gehen, die bequemeren breiten Straßen benutzte. Ich stellte oft fest, dass der Name meines Onkels der Schlüssel für die Hilfsbereitschaft der für mich unbekannten Menschen war. Er genoss hohes Ansehen, weil er hilfsbedürftige Kranke ohne Rücksicht auf ein Honorar behandelte.
Nach einem mehrtägigen strammen Marsch erreichte ich an einem Nachmittag den Ort Langendorf, fand ohne Mühe das Schloss und setzte mich in den Warteraum, in dem sich noch zwei weitere Personen befanden. Geduldig wartete ich, bis ich an der Reihe war. Als mich die Sprechstundenhilfe schließlich fragte, was mir fehle, antwortete ich wahrheitsgemäß: „Nichts!“ Auf die weitere Frage, was ich dann hier wolle, antwortete ich ebenso wahrheitsgemäß: „Hierbleiben.“ Ich habe selten in meinem Leben ein so verdutztes Gesicht gesehen. Mit offenem Mund starrte die Sprechstundenhilfe mich an, bis sie mich erkannte und umarmte. Wir hatten uns mindestens seit dem Jahre 1943 nicht mehr gesehen und jetzt viel zu erzählen. Aber zuerst wurde ich in die Badewanne gesteckt, um mich nach dem Kampieren in Scheunen und dem Staub der Straßen und Feldwege wieder zu einem Menschen zu machen.
Drei Tage nach meiner Ankunft sagte mein Onkel, er müsse mich „ehrlich“ machen und bei der Polizei als „Zugang“ anmelden. Etwa 14 Tage später erhielt ich eine Vorladung vor einen Ausschuss in der Kreisstadt Sternberg. Dem Gremium aus fünf Männern trug ich meine Geschichte vor, wobei deren Gesichter von Minute zu Minute skeptischer wurden. Mein Onkel übersetzte mir die Randbemerkungen des Ausschusses mit: „Räuberpistole, Lügenmärchen, alles erfunden, schmutziger Deutscher, der eine slawische Brudernation schlecht machen will.“ Mein Onkel blieb die Ruhe selbst. Er sagte, er wolle die Kompetenz des Gremiums keineswegs anzweifeln. Aber in diesen turbulenten Zeiten sei es durchaus möglich, dass nicht jede Nachricht sofort allen zugänglich sei. Er schlage daher vor, in den Ministerien in Prag nachzufragen, welche Erkenntnisse dort über die Zustände in Schlesien vorlägen. Mit Rücksicht auf die Person meines Onkels fand sich der Ausschuss schließlich bereit, entsprechende Nachforschungen anzustellen. Ich erhielt die Auflage, Langendorf nicht zu verlassen und mich jederzeit für Maßnahmen der Polizei bereitzuhalten.
Etwa drei Wochen später erhielt ich die erneute Vorladung vor den Ausschuss in Sternberg. Ich erinnerte mich an die Gesichter der Ausschussmitglieder aus der vorherigen Sitzung und bekam abgrundtiefe Angst. Aufgrund eigenen Erlebens und der Erzählung der Sudetendeutschen hatte ich nicht mehr die geringste Hoffnung auf eine faire Behandlung meines Falles. Ich fürchtete festgenommen und an die Russen/Polen ausgeliefert zu werden. Mein Onkel hinderte mich daran, in einer Art Panikreaktion den Ort zu verlassen und unterzutauchen. Er sagte, er habe für mich gebürgt und ich hätte kaum eine Chance, mich zum Beispiel nach Bayern durchzuschlagen. Also fuhr ich mit ihm zum Ausschuss nach Sternberg. Dort kam alles ganz anders als von mir befürchtet. Der Ausschussvorsitzende begrüßte meinen Onkel und mich freundlich mit Handschlag und wollte wissen, wie es mir ginge. Auch die übrigen Mitglieder des Ausschusses waren wie umgewandelt. Sie erkundigten sich, ob ich mich von den Strapazen meiner „Reise“ gut erholt hätte und ob mir der Ort Langendorf gut gefiele. Mein Onkel war mindestens so verblüfft wie ich, ließ sich aber nichts anmerken. Beiläufig erfuhr er, dass man in Prag über gewisse „Vorkommnisse“ in Schlesien sehr besorgt sei, mit Rücksicht auf das slawische Brudervolk der Polen aber von einer offenen Kritik absehe. Für mich persönlich bedeutete dieser Wandel, dass ich Asyl erhielt und mich ohne spezielle Auflagen in der Tschechoslowakei aufhalten konnte. Wegen unerlaubten Grenzübertritts musste ich allerdings noch 90 Kronen Strafe zahlen.
Ende August 1946 lag beim Abendtisch neben meinem Teller ein Brief, an dessen Anschrift ich sofort erkannte, dass es Post von meiner Mutter war. Sie teilte mir mit, dass die Familie nach der Vertreibung aus Schlesien in Braschoß, einem Ort in der Nähe von Siegburg und Bonn, angekommen sei. Wenn ich wollte, könnte ich zu ihnen kommen. Diese Nachricht löste hektische Überlegungen aus. Mein Onkel erklärte, er kenne die Gegend. Er habe in Bonn studiert und bei Ausflügen das Land kennen gelernt. Es handle sich um eine ganz arme Region. Die Erwerbstätigen seien gezwungen, zum Beispiel aus Much – er nannte ausdrücklich diesen Ortsnamen – morgens um vier Uhr loszulaufen, um rechtzeitig in der etwa 20 Kilometer entfernten Arbeitsstelle in Siegburg einzutreffen. Wenn sie nachmittags gegen 18 Uhr nach einem mehrstündigen Fußmarsch wieder in Much einträfen, müssten sie sich um ihre kleine Landwirtschaft kümmern, von der allein sie ohne die Fabrikarbeit nicht leben könnten. Ihre Frauen müssten nachts losgehen, um rechtzeitig ab 8 Uhr auf dem Markt in Siegburg Butter und Eier anbieten zu können. Die Leute lebten in kleinen Häuschen aus Fachwerk, die schon für die bisherigen Bewohner zu klein seien. Er könne sich kaum vorstellen, wie zusätzliche Leute dort untergebracht und ernährt werden könnten. Dagegen fehle es mir hier in der Tschechoslowakei an nichts. Nicht einmal auf die tägliche Schüssel Erdbeeren müsse ich verzichten. Ich war hin- und hergerissen. Ich konnte keines der Argumente widerlegen und fühlte mich in Langendorf mehr als gut aufgehoben. Auf der anderen Seite riet mir eine innere Stimme, Eltern und Geschwister nicht aufzugeben. So entschied ich mich – nach einer Woche langen Schwankens – für eine Ausreise aus der Tschechoslowakei.
Jetzt ging alles extrem schnell. Da es aus politischen Gründen einen fahrplanmäßigen Reiseverkehr nach Deutschland nicht gab, bot sich als Verkehrsmittel ein Zug mit vertriebenen Sudetendeutschen an. Davon fuhr im Jahre 1946 nur noch einer und zwar in 14 Tagen um den 10. September 1946. Als anerkannter Asylant gehörte ich an sich nicht in einen solchen Zug. Von den Sudetendeutschen wurde ich deshalb als Exot bestaunt, zumal ich unbeschränkt Gepäck mitnehmen durfte und mit einer großen mit Wäsche vollgepackten Kiste und dem üblichen Handgepäck zur Abfahrt des Zuges erschien. Nachdem die Kiste mangels eines anderen Platzes in dem Eingangsbereich des 3. Klasse-Wagens abgestellt war, war mein Aufenthalts- und Schlafbereich für die Reise nach Deutschland festgelegt. Die Abteile waren belegt. Für mich als Nachzügler dieses Transports blieb nur die Kiste übrig, die ich ja gegen Diebstahl schützen musste. Die Stimmung in dem Zug war eigenartig. Es überwog nicht das Gefühl des Verlustes der Heimat, sondern das der Befreiung von einem Zustand der absoluten Rechtlosigkeit und der Drangsalierungen. Dazu trug sicher bei, dass die Mehrheit der Zuginsassen dem Augenschein nach nicht älter als 40 Jahre alt war. Sie fühlten sich stark genug, in einem fremden Land einen Neuanfang zu wagen. Sie ließen sich auch nicht durch die widrigen Umstände von den Freuden des Lebens abhalten. Als der Zug in die Nacht hinein fuhr, waren schon kurz nach Einbruch der Dunkelheit mühsam unterdrückte Lustschreie zu hören.
Im Laufe des folgenden Tages überquerte der Zug bei Furth im Walde die Grenze nach Bayern. In diesem Ort wurden wir „entlaust“. Männer und Frauen bewegten sich getrennt im Gänsemarsch auf zwei Baracken zu, wo sie wie an einem Fließband drei Stationen zu durchlaufen hatten. Jede der Stationen war mit einem Mann/Frau mit einer großen, DDT-gefüllten Spritze besetzt. An der ersten Station hieß es: „Mütze ab“. Dann war der Kopf weiß wie Schnee von dem Pulver. An der zweiten Station hieß es: „Hemd auf!“ und schon war der Oberkörper wie in Mehl gehüllt. An der dritten Station kam der Ruf: „Hose auf!“ und schon war der Rest des Körpers „eingemehlt“. Ohne dass ein Wort zur Gesundheitsschädlichkeit des DDT-Pulvers gesagt wurde, ging es in die Registrierstelle. Nach der Aufnahme der Personalien wurden den Familien die neuen Aufenthaltsorte zugewiesen.
Bei meinem Namen kam Hektik auf. Ich war nicht nur ein „Einzelreisender“ und mit 14 Jahren minderjährig, sondern wollte aus der amerikanischen durch die französische in die britische Besatzungszone zu meinen Eltern reisen. Mit einem Schlage lernte ich die Aufteilung Deutschlands in Interessengebiete und deren unterschiedliche Behandlung kennen. Der für mich zuständige Registrator meinte, man könne nur über einen Aufenthalt in der amerikanischen Zone entscheiden. Sein Vorgesetzter vertrat die Auffassung, mit den Briten käme man wohl noch zurecht, aber mit den Franzosen sei wohl keine Einigung zu erreichen. Der eingeschaltete Leiter der Aufnahmestelle erkannte den Problemfall eines Minderjährigen im Niemandsland. Er wollte sich die Arbeit vom Halse schaffen und entschied, dass ich ein vorläufiges Ausweispapier mit „Marschbefehl“ und Fahrkarte nach Siegburg erhalten sollte. Im Übrigen wünschte er mir viel Glück für die Weiterreise. Ich wurde also mit meinem Gepäck nach Cham zum Bahnhof gebracht. Dort wurde meine Kiste mit den nötigen Adressen versehen und in die Obhut der Reichsbahn gegeben. Ich selbst wurde in den Zug in Richtung Westen gesetzt. Mein Betreuer sagte mir noch, ich müsse in Regensburg in Richtung Frankfurt/Main umsteigen. Dort solle ich mich an die Bahnhofsmission wenden, die eventuell wisse, ob überhaupt und wann ein Zug aus der amerikanischen durch die französische in die britische Zone führe. Mangels irgendwelcher Fahrpläne habe man insoweit in Bayern nicht die geringste Ahnung.
Nach einem kurzen Aufenthalt konnte ich in Regensburg in den Zug nach Frankfurt/Main einsteigen, der randvoll mit Schwarzhändlern und „Hamsterern“ besetzt war. Jeder beobachtete sein Gepäck in der Angst, es könnte gestohlen werden. Auch dieser Zug fuhr wieder in die Nacht hinein, aber aus Furcht, er könnte beraubt werden, wagte keiner zu schlafen. Einer der Reisenden hatte Pech. Sein Rucksack, in dem er Raps transportierte, war entweder aufgegangen oder aufgeschnitten worden: Jedenfalls rollten die Rapskörner in dem ganzen Wagen umher und verwandelten – zertreten – den Fußboden in eine ölige Rutschbahn, die von den Mitreisenden zwar verflucht aber nicht ohne Schadenfreude gesehen wurde. Gegen Mitternacht erreichte der Zug Frankfurt/Main. Natürlich steuerte ich sofort die Bahnhofsmission an und traf dort auf eine Frau mittleren Alters, die bei meinem Anblick zu schimpfen anfing. Es sei unverantwortlich, in dieser Zeit Kinder allein um Mitternacht auf Bahnhöfe zu lassen. Als ich erklärte, dass ich schon eine längere Zugfahrt hinter mir hätte und jetzt eine Verkehrsverbindung durch die französische in die britische Zone nach Siegburg suchte, fiel sie fast in Ohnmacht. Sie fing an, mir lang und breit alle Schwierigkeiten eines solchen Transports aufzuzählen. Während ihres Redeschwalls stieg mir die ganze Zeit der Geruch einer warmen Suppe in die Nase, die in einer Ecke auf einem Ofen vor sich hin kochte. Auf meine Frage nach etwas Essbaren entschuldigte sie sich, dass sie selbst nicht schon früher daran gedacht hatte, und gab mir eine große Schüssel Erbsensuppe zu essen. Während meiner Mahlzeit beobachtete ich sie aus dem Augenwinkel und konnte fühlen, wie sie sich intensiv mit der Frage beschäftigte, was sie mit diesem minderjährigen Einzelreisenden im Niemandsland anfangen sollte. Als ich sah, wie sich ihr Gesicht aufhellte, ahnte ich, dass sie beschlossen hatte, sich selbst keine Schwierigkeiten zu machen und mich weiterreisen zulassen. Ganz im Gegensatz zu ihrem anfänglichen Lamento ging sie katzenfreundlich mit mir vor die Tür, zeigte auf einen in der Dunkelheit nur schemenhaft erkennbaren Zug und meinte, dass dieser in die britische Zone fahren würde. Er hätte zwar schon vor zwei Tagen abfahren sollen, könnte aber jetzt wohl als einer der Nächsten den Bahnhof verlassen.
Also stapfte ich über die Gleise zu dem Zug, öffnete eines der Abteile und wollte mich in der Dunkelheit mit Schwung auf einen Sitz setzen, als mich jemand auffing und mir klarmachte, dass schon alle Plätze besetzt seien. Schließlich wartete man schon mehrere Tage auf die Abfahrt des Zuges. Nach einigem Hin und Her rückte man aber doch zusammen und überließ mir ein schmales Stück Bank. Der Zug rührte sich aber nicht vom Fleck. War die Unterhaltung der Mitreisenden seit meinem Zugang zunächst verstummt, so wurden die Gespräche mit der Länge der Wartezeit wieder aufgenommen. Als es morgens immer heller wurde, konnte ich auch meine Abteilgenossen erkennen. Es waren alles Männer im Alter von etwa 50 Jahren. Alle waren Schwarzhändler oder „Hamsterer“, die aus den Unterschieden der Besatzungszonen ihren Profit zogen. Die meisten kannten sich – aus welchen Gründen auch immer – schon länger. Beruhigend für mich war, dass sie die Schwierigkeiten des Zonenwechsels genau kannten, sie in mir keinen Konkurrenten sahen und mir gegenüber sogar gewisse Betreuungsgefühle erkennen ließen. Die hygienischen Verhältnisse im Umfeld des jetzt schon drei Tage auf die Abfahrt wartenden Zuges waren verheerend. Da sich niemand aus Angst vor einer plötzlichen Abfahrt von dem Zug zu entfernen wagte, wurde die Notdurft zwischen den Waggons auf den Gleisen verrichtet. Es stank fürchterlich. Plötzlich hieß es, der Zug fährt gleich los. Alle stürmten in die Abteile und brachen in Jubelgeschrei aus, als sich der Zug mit seiner altersschwachen Lokomotive langsam in Bewegung setzte.
Kurz nach Mitternacht nahm die Nervosität meiner Mitreisenden zu. Ich erfuhr, dass man sich in der französischen Zone einem Kontrollposten bei Betzdorf nähere und die Franzosen den Zug gründlich durchsuchen würden. Da die Franzosen selbst nicht viel zu Essen hätten, nähmen sie den Reisenden zum Beispiel sämtliche den Tagesbedarf überschreitenden Lebensmittel ab. Personen, die sich ihrer Ansicht nach nicht hinlänglich ausweisen könnten, würden mit ungewissem Schicksal festgenommen. Aus dieser Lage gäbe es nur einen Ausweg: Vor dem Kontrollposten läge eine Steigungsstrecke, die die altersschwache Lokomotive nur im Schritttempo nehmen könne. Hier müsse man aus dem Zug springen und, während der Zug an dem Kontrollpunkt hielt, durch einen Wald laufen, um dann, wenn der Zug nach der Kontrolle und der Fahrt über die Zonengrenze auf der britischen Seite bei dem Ort Au für die Kontrolle durch die Engländer erneut hielt, wieder in den Zug einzusteigen. Angesichts meines nur vorläufigen Ausweispapiers konnte ich die Frage, ob ich mitmache, nur mit einem lauten Ja beantworten. Da mir die Mitreisenden erzählten, dass es nur noch wenige Kilometer bis Siegburg seien, hatte ich nicht die geringste Lust, so nahe vor dem Ziel in einem französischen Auffanglager zu landen. Also sprangen wir an der Steigungsstrecke aus dem Zug, liefen durch den Wald, sahen die Eisenbahngleise wieder und auch den Zug, der sich dem britischen Kontrollposten bei Au an der Sieg näherte und dort anhielt. Völlig außer Atem stiegen wir wieder in den Zug ein, wurden nur oberflächlich von den Engländern kontrolliert, die auch an meinem vorläufigen Ausweis nichts auszusetzen hatten.