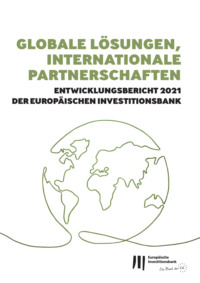Kitabı oku: «Globale Lösungen, internationale Partnerschaften», sayfa 2
IMPFSTOFF-SOLIDARITÄT
Eine wegweisende internationale Initiative soll armen Ländern in Afrika den Impfstoffzugang sichern, um gesundheitliche und wirtschaftliche Folgen der Coronapandemie abzufedern
Niemand ist sicher, bis alle sicher sind. Denn Infektionskrankheiten machen nicht an Grenzen halt. Deshalb müssen alle Länder, egal wie reich oder arm sie sind, Zugang zu einem Impfstoff gegen Covid-19 haben.
Das ist das Ziel von COVAX, einer globalen Initiative der Impfallianz Gavi, der Weltgesundheitsorganisation und der Koalition für Innovationen in der Epidemievorsorge. Mit Unterstützung der Europäischen Investitionsbank und der Europäischen Kommission will COVAX allen Ländern einen gerechten Zugang zu einem sicheren, wirksamen Impfstoff gegen Corona verschaffen.
„Nur durch eine faire und gerechte Verteilung der erfolgreichen Covid-19-Impfstoffe können wir die Pandemie überwinden und die schlimme Lage in den Entwicklungsländern verbessern“, erklärt Raffaele Cordiner von der Europäischen Investitionsbank, der an dem Projekt mitarbeitet. „Die gemeinsamen Anstrengungen der Europäischen Investitionsbank und der Europäischen Kommission als Team Europe unterstreichen, wie wichtig der multilaterale Ansatz für die Lösung weltweiter Gesundheitsprobleme ist. Europa setzt ein Zeichen der Solidarität mit unseren Mitmenschen, das in dieser schwierigen Zeit Hoffnung macht.“
Die Europäische Investitionsbank stellt 600 Millionen Euro für eine innovative COVAX-Abnahmegarantie für Impfstoffe (Advance Market Commitment, AMC) bereit. So sollen 92 Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen Zugang zu 1,8 Milliarden sicheren und wirksamen Impfdosen erhalten, finanziert aus Spendengeldern. Gemeinsam mit der Weltgesundheitsorganisation und UNICEF hilft Gavi den Ländern außerdem bei der Vorbereitung und Durchführung der Impfkampagne. Durch diese Kombination stellt COVAX sicher, dass die Schwächsten in allen Ländern, auch in armen, geimpft werden können. Das ist der bislang höchste Beitrag der EIB für die weltweite öffentliche Gesundheit.
Doch COVAX gewährleistet nicht nur den fairen Zugang. Die Initiative beschleunigt auch die Entwicklung und Herstellung der Vakzine. Außerdem hilft sie bei den Impfkampagnen und sorgt etwa für eine geschlossene Kühlkette bei der Verteilung der Impfdosen.
An der COVAX-Initiative beteiligen sich fast 100 finanzstarke Länder. Mit Geld und Know-how fördern sie gemeinsam die Entwicklung und den Kauf von Impfstoffen. Der Anteil der Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen, darunter Länder südlich der Sahara und in der südlichen Nachbarschaft der EU, die sich die Impfstoffe sonst nicht leisten könnten, wird über Geberbeiträge finanziert. „Die Initiative ist ein echtes Zeichen der Solidarität“, meint Anna Lynch, die als Expertin für Biowissenschaften bei der Europäischen Investitionsbank an der COVAX-Finanzierung mitwirkte. „Europa hat zwar zunächst die Grenzen dicht gemacht, um die Pandemie einzudämmen, war dann aber auch bereit, für einen gerechten Zugang zu Impfstoffen zu sorgen.“
Die Hälfte aller Länder mit niedrigem und ein Viertel der Länder mit mittlerem Einkommen müssen wegen der Coronakrise mit massiven Schäden für die Wirtschaft rechnen. Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation zufolge könnte die Zahl der Menschen, die weltweit hungern, durch die Pandemie um 132 Millionen wachsen. „Diese Krise ist beispiellos, weil sie weltweit und überall zeitgleich auftritt“, erklärt Debora Revoltella, Chefvolkswirtin der EIB. „Sie trifft nahezu alle Länder und Regionen der Welt. In den meisten, wenn nicht allen, hat Corona eine der schwersten Wirtschaftskrisen aller Zeiten ausgelöst.“
“ Wir haben unglaublich schnell und gut zusammengearbeitet, um die akute Phase der Pandemie zu beenden und die Wirtschaft wieder anzukurbeln. ”
Gleicher Zugang zu Impfstoffen für alle
Impfstoffe bieten mit die beste Chance, die Pandemie mit allen ihren Folgen für Gesundheit und Wirtschaft zu überwinden.
COVAX finanziert die Entwicklung mehrerer potenzieller Impfstoffe. Die Initiative unterstützt die Massenherstellung und handelt die Preise aus. Mit dem Geld von COVAX können die Hersteller sofort Produktionskapazitäten aufbauen und den Impfstoff produzieren, auch wenn die klinischen Studien noch laufen. Sobald der Impfstoff zugelassen ist, stehen die Dosen direkt bereit.
Durch COVAX soll sichergestellt werden, dass alle Länder rasch und in etwa zeitgleich Zugang zu sicheren und wirksamen Impfstoffen haben. Nur so lässt sich die Pandemie unter Kontrolle bringen und nur so können wir letztlich ihre Auswirkungen auf uns und auf Wirtschaft, Gemeinwesen, Handel und Reisen eindämmen.
In der akuten Phase der Pandemie soll COVAX vor allem gewährleisten, dass alle Länder ausreichende Lieferungen und Ressourcen erhalten, um die am stärksten gefährdeten Personen zu impfen – Angehörige der Gesundheits- und Sozialdienste, Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen. Die Impfstoffe werden nach dem Fair Allocation Framework der WHO gerecht zwischen finanzstarken Volkswirtschaften und Ländern verteilt, die im Rahmen der Impfstoff-Abnahmegarantie förderfähig sind.
Gemeinsam stark
Die Europäische Investitionsbank hat alles Menschenmögliche getan, um das COVAX-Paket so rasch wie möglich zu schnüren und auf den Weg zu bringen, versichert Raffaele Cordiner von der Bank der EU. „Wir haben unglaublich schnell und gut zusammengearbeitet, um die akute Phase der Pandemie zu beenden und die Wirtschaft wieder anzukurbeln.“
Das Darlehen der Europäischen Investitionsbank ist durch eine Garantie des Europäischen Fonds für nachhaltige Entwicklung besichert. Mit dem Fonds fördert die Europäische Kommission eine proaktive Entwicklungspolitik und unterstützt in erster Linie Investitionen in der Nachbarschaft der EU und in Afrika. Außerdem gibt die Europäische Union selbst noch 100 Millionen Euro für die COVAX-Initiative.
Durch dieses globale Handeln wird es für Wirtschaft und Gesellschaft hoffentlich bald wieder bergauf gehen, und ein erneutes Aufflammen der Pandemie sollte unwahrscheinlicher werden. COVAX zeigt: Gemeinsam sind wir stark.
SOFORTHILFE
Covid-19 stellt Marokkos Gesundheitssystem vor gewaltige Herausforderungen. Mit Soforthilfen der EIB kann das Land der Krise begegnen, medizinisches Personal schulen und die Lebensqualität verbessern
Im Universitätskrankenhaus Ibn Rochd in Casablanca sind mehr und mehr Betten mit Covid-19-Erkrankten belegt. Das Krankenhaus habe den Zustrom zwar soweit im Griff, sagt Professor Kamal Marhoum El Filali, der die Abteilung für Infektionskrankheiten leitet. Doch wenn noch mehr Patienten kommen, könnten die Intensiv- und Beatmungsbetten schnell knapp werden. „Die Lage spitzt sich zu“, mahnt Marhoum.
Im Frühjahr 2020 fuhr Marokko das ganze Land konsequent herunter, um die Pandemie einzudämmen. Touristische und andere Reisen wurden unterbunden. Doch dann kam wie in vielen anderen Ländern die zweite Infektionswelle. Im November 2020 hatten sich landesweit schon über 320 000 der 37 Millionen Einwohner mit dem Virus infiziert, etwa 5 000 waren daran gestorben. Das Gesundheitssystem stieß allmählich an seine Grenzen.
Das Universitätskrankenhaus nimmt nur noch schwere Covid-19-Fälle auf, die einen Intensiv- oder Beatmungsplatz brauchen. Außerdem eigenes Personal, das sich mit dem Virus infiziert hat. Eines der größten Probleme ist laut Infektionsexperte Marhoum, dass immer mehr Beschäftigte selbst erkranken oder mit dem Virus in Kontakt waren und sich deshalb bis zu 14 Tage isolieren müssen. „Wir haben sowieso schon zu wenig Personal. Das ist ein enormes organisatorisches Problem.“
Der Pandemie die Stirn bieten
Als Marokko im Frühjahr 2020 in den Lockdown ging, waren nur 77 Coronafälle bekannt. Die Regierung sah jedoch, wie das Virus in Teilen Spaniens wütete. Den Verantwortlichen war klar, dass das marokkanische Gesundheitssystem einer ähnlichen Welle nicht standhalten würde. „Wenn uns die Pandemie so schwer getroffen hätte wie Europa, hätten wir keine Chance gehabt“, räumt Marhoum ein.
Mit den drastischen Maßnahmen konnte Marokko die Todesfälle niedrig halten. Die Sterblichkeit – also der Anteil derer, die an der Infektion versterben – war in der ersten Welle im weltweiten Vergleich mit am niedrigsten. Wie in anderen Teilen Afrikas ist die niedrige Sterberate auch in Marokko auf die junge Bevölkerung zurückzuführen.
Durch den Lockdown gewann die Regierung auch wertvolle Zeit, um Testzentren, Websites und Hotlines einzurichten. Gemeinsam mit internationalen Einrichtungen wie der Weltgesundheitsorganisation entwickelte die Regierung einen Pandemieplan und nahm bei der Europäischen Investitionsbank und anderen internationalen Kreditgebern dringend benötigte Mittel auf. Von der EIB bekam Marokko ein Darlehen über 200 Millionen Euro für medizinisches Material, Schulungen und weitere Maßnahmen. Damit konnte das Land sein fragiles Gesundheitswesen stärken und die 9 200 Ärztinnen und Ärzte im öffentlichen Sektor entlasten.
Immer in Kontakt
In Marokko kam der Lockdown nur eine Woche nachdem EIB-Kreditreferent Hervé Guenassia von Casablanca nach Luxemburg zurückgekehrt war. Guenassia, der das Finanzierungsgeschäft der EIB in Marokko leitet, blieb auch nach Ausbruch der Pandemie ständig mit den marokkanischen Behörden in Kontakt. Und als das Land im März Hilfe beantragte, reagierte die Bank der EU sofort. Mit dem EIB-Kredit von 200 Millionen Euro werden medizinische Geräte, Verbrauchsmaterial und Ausrüstung finanziert. Durch die flexiblen Konditionen kann Marokko das Geld für alle coronabedingten Beschaffungen verwenden, die seit dem 1. Februar 2020 im Gesundheitswesen angefallen sind. Die Kaufbelege dafür können nachgereicht werden. Außerdem kann die EIB bis zu 90 Prozent der Projektkosten finanzieren, also weit mehr als die üblichen 50 Prozent.
“ Alles lief unter Hochdruck, schließlich ging es um Menschenleben. Es war ein Wettlauf gegen die Zeit. ”
Marokko bekam das Geld in Rekordzeit: 100 Millionen Euro in nur einem Monat. „Alles lief unter Hochdruck, schließlich ging es um Menschenleben“, so Guenassia. „Es war ein Wettlauf gegen die Zeit.“
Guenassia nutzte das Darlehen an Marokko als Ausgangspunkt für eine übergreifende Fazilität – das Programmdarlehen Neighbouring Countries COVID-19 Public Health Care, das EU-Nachbarländer in Osteuropa, dem Nahen Osten und Nordafrika bei der Bewältigung der Krise unterstützen soll. Der Verwaltungsrat der EIB gab dafür binnen eines Monats grünes Licht. Möglich wurde das Darlehen durch Team Europe, eine Initiative, die den EU-Partnerländern in der Pandemie helfen soll. Das Geld dafür stammt von der Europäischen Kommission, den Mitgliedstaaten, der Europäischen Investitionsbank und der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung.
Langjährige Partnerschaft
Seit 2006 finanziert die Europäische Investitionsbank mit einem Darlehen von 70 Millionen Euro und einem Zuschuss von 13 Millionen Euro ein umfangreiches Programm für den Wiederaufbau, die Sanierung und die Ausstattung von 16 Krankenhäusern. Bei diesem ambitionierten Projekt setzte sie neue Methoden und Instrumente ein, die in vielen Fällen auf die Beteiligung der Europäischen Kommission zurückgingen. Das Prince Moulay Abdellah Hospital in Salé zeigt exemplarisch, wie sich die langfristige Finanzierung der EIB konkret auf den Gesundheitssektor auswirkt. Auf dem Höhepunkt der Pandemie wurde das Krankenhaus durch eine Aufstockung von 159 auf 250 Betten zum regionalen Zentrum für die Patientenversorgung.
Marokko gehört zu den afrikanischen Ländern, die am stärksten von Corona betroffen sind. Wie Anna Barone, die Leiterin des EIB-Büros in Marokko, berichtet, hat die Pandemie eklatante Lücken im Gesundheitswesen des Landes aufgedeckt: unzureichende Krankenhausinfrastruktur, Mangel an geschultem medizinischen Personal und große Ungleichheiten in der Versorgung. Zu Beginn der Krise hatte Marokko eine der niedrigsten Bettendichten in der Region – nur 1,1 Bett pro 1 000 Einwohner. Auch die öffentlichen Gesamtausgaben für die Gesundheitsversorgung sind mit jährlich etwa 160 US-Dollar pro Person vergleichsweise niedrig.
Die mangelnde Infrastruktur bleibt zwar ein großes Problem, aber kurzfristig hat Marokko mit Geld und Know-how der internationalen Gemeinschaft die Krise erfolgreich in den Griff bekommen. Inzwischen konnte die Zahl der Krankenhausbetten auf rund 3 000 verdoppelt werden. Die Kredite der EIB und anderer Geldgeber haben geholfen, dringend benötigtes medizinisches Material, Ausrüstung und Medikamente sowie Schulungen für Fachkräfte zu finanzieren. Marokko hat relativ betrachtet nur rund ein Drittel so viele Ärztinnen und Ärzte wie das benachbarte Tunesien – 0,54 pro 1 000 Einwohner. Ein Teil des EIB-Darlehens wird für immaterielle Investitionen verwendet, wie die Ausbildung von Ärzteschaft, Fachpersonal und Verwaltungskräften in Krankenhäusern.
Der steinige Weg zur medizinischen Grundversorgung
2002 machte sich Marokko daran, eine allgemeine Gesundheitsversorgung aufzubauen. Heute steht das Land deutlich besser da. Die Lebenserwartung in Marokko ist hoch, und wichtige Indikatoren verbessern sich stetig. So halbierte sich die Säuglingssterblichkeit von 42 Todesfällen je 1 000 Lebendgeburten im Jahr 2000 auf 20 im Jahr 2017.
Die jüngste Initiative zur Ausweitung der Gesundheitsversorgung besteht in einer Fünfjahresstrategie (2017–2021): Die Kapazitäten in Krankenhäusern sollen ausgebaut, der Versicherungsschutz auf Selbstständige und Angehörige der freien Berufe ausgeweitet, mehr Personal im Gesundheitssektor beschäftigt und das Medizinstudium in Marokko standardisiert werden.
In der Praxis haben jedoch nach wie vor viele Menschen in Marokko keinen Zugang zum Gesundheitswesen, vor allem nicht zur Grundversorgung. Obwohl die Vereinten Nationen in ihrem Entwicklungsziel Nr. 3 zumindest einen allgemeinen Zugang zu medizinischer Grundversorgung fordern, bleibt er in Marokko vielen Menschen verwehrt, weil sie entweder in ländlichen Gebieten leben oder nicht unter die öffentliche Krankenversicherung fallen.
Die Krise als Chance für Reformen
Laut Barone könnte die internationale Pandemiehilfe Marokko den nötigen Schwung geben, um die noch übrigen Hürden auf dem Weg zu einer besseren Versorgung anzugehen: „Wir müssen die Krise für Reformen nutzen, die normalerweise viel länger dauern.“
Auch hier will die Europäische Investitionsbank mitziehen. Sie könne mit ihrem Fachwissen und technischer Hilfe die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteuren des marokkanischen Gesundheitswesens stärken, so Barone. Außerdem kann die Bank der EU finanziell helfen, damit vor allem in ländlichen Gebieten mehr Krankenhäuser gebaut und saniert werden.
Die Europäische Union und Marokko arbeiten derzeit an einer neuen Agenda für ihre Zusammenarbeit zwischen 2021 und 2027, die ebenfalls neue Impulse für Reformen geben könnte. Barone ist sich sicher: „Jetzt haben wir die Chance, Prioritäten zu setzen, um Marokkos Wirtschaft wieder anzukurbeln, die Gesellschaft zu stärken und insbesondere die Gesundheitsversorgung zu verbessern.”
SOFORTHILFE FÜR TRÄUME
Im Corona-Lockdown kommt Bildung leicht zu kurz, aber Marokko und Tunesien haben schnell gehandelt
Über 1,6 Milliarden junge Menschen weltweit konnten aufgrund der Pandemie nicht mehr in ihren Klassenzimmern lernen. Schulen mussten auf Digitalunterricht umstellen, was bestehende Ungleichheiten im Bildungssystem verschärfte. Und danach wartete ein hartes Stück Arbeit auf die Lehrkräfte: Es galt, den verpassten Stoff von Monaten aufzuholen.
Als Tunesiens Regierung die Schulen für die Abschlussexamina im Sommer 2020 wieder öffnete, widmete die Europäische Investitionsbank kurzerhand einen Teil eines ihrer Darlehen um. So konnten Masken und Handdesinfektionsmittel für eine sichere Rückkehr von 220 000 Schülerinnen und Schülern und 160 000 Lehrkräften gekauft werden.
Das 220-Millionen-Euro-Projekt zur Modernisierung von knapp einem Drittel aller weiterführenden Schulen des Landes wird von der Europäischen Investitionsbank, dem tunesischen Staat, der Kreditanstalt für Wiederaufbau und der Europäischen Union finanziert. 317 Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule von Azmour, einem Dorf im Nordosten Tunesiens, verdanken dem Großprojekt ein frisch renoviertes, top ausgestattetes Schulgebäude.
Weder Laptop noch Internet
Als Marokkos Schulen und Unis wegen der Pandemie schließen mussten, begann für viele Studierende der Euromed-Universität in Fez eine schwierige Zeit.
Sie hatten oft weder einen Laptop noch einen zuverlässigen Internetanschluss. Die Universität wandte sich an die Europäische Investitionsbank, die mit der Europäischen Union bereits ihre Gebäude finanziert hatte. Daraufhin spendeten die Bank und die EU-Delegation in Marokko 500 000 Euro von der Europäischen Kommission, damit Studierende von zu Hause aus lernen können.
Nur wenige Wochen später wurden 420 Laptops verteilt – an Studierende, die ohne Computer in abgelegenen Gebieten mit schlechter Internetanbindung leben. Ein Jahr unbegrenzter Internetzugang inbegriffen. Nouhayla Chahm darf den Laptop dank ausgezeichneter Noten mindestens drei Jahre behalten. „Die Universität und die Europäische Union haben mir Mut und Energie gegeben, um weiterzumachen. Dafür bin ich sehr dankbar“, sagt sie.
Die Universität kaufte mit dem Geld außerdem 3-D-Drucker, um Hunderte wiederverwendbare Masken und Einwegfilter für Studierende und das Universitätspersonal zu drucken. Mit dem effizienten Technologieeinsatz verbessert die Euromed-Universität gleichzeitig die Chancen ihrer Absolventinnen und Absolventen am Arbeitsmarkt. Die Pandemie hat die digitale Bildungsrevolution beschleunigt, und die Europäische Investitionsbank ist vorne dabei.
DIE VERMESSUNG DES KLIMARISIKOS
Wer Armut bekämpft, schützt das Klima. Denn einkommensschwache Länder sind nicht nur mit am stärksten von der Erderwärmung bedroht, ihnen fällt auch die Anpassung am schwersten. Die Bewertung des Klimarisikos zeigt, wo Hilfe am dringendsten benötigt wird
Von Matteo Ferrazzi, Fotios Kalantzis, Sanne Zwart und Tessa Bending
Die EIB ist die Klimabank der EU und ein wichtiger globaler Akteur in der Entwicklungsfinanzierung. Das Klimarisiko zu verstehen ist also ein zentraler Bestandteil unserer Arbeit. Wir überwachen den CO2-Fußabdruck unserer Projekte, wir forcieren die Bemühungen zur Emissionsminderung, und wir prüfen alle unsere Investitionen auf ihre Vereinbarkeit mit den Zielen des Pariser Abkommens. Vor allem stellen wir sicher, dass Klimarisiken schon bei der Projektplanung berücksichtigt werden. Dabei ermitteln wir auch gleich, welche Schutz- und Anpassungsmaßnahmen nötig sind. Anders ausgedrückt: Wir nutzen jede Gelegenheit, um die Klimaresilienz zu erhöhen.
Die Dimensionen des Klimarisikos
Für uns ist es wichtig zu wissen, was Klimawandel und Klimawende im Gesamtbild für Volkswirtschaften und Gesellschaften bedeuten. Daher haben wir neben wirtschaftlichen Analysen zum Klimawandel den
EIB-Klimarisikoindex erarbeitet. Der Index nutzt vorhandene Daten und neueste Studien zu den Auswirkungen des Klimawandels auf Länderebene.[9] Mit seiner Hilfe können wir durch Ländervergleiche ermitteln, wo die Risiken insgesamt am größten sind und wo Entwicklungsinterventionen für Klimaschutz und Klimaanpassung am meisten bewirken.
Wir untersuchen für jedes Land zwei Arten von Risiken: physische Risiken und Transitionsrisiken. Das physische Risiko umfasst alle Folgen des Klimawandels durch Naturkatastrophen („akutes Risiko“) sowie allmählichere Veränderungen („chronisches Risiko“). Transitionsrisiken entstehen aus politischen und regulatorischen Maßnahmen, etwa der Einführung strenger Klimaschutzvorschriften, mit denen Länder Paris-konform CO2-neutral werden sollen. Diese Vorschriften wirken sich auf die Unternehmenskosten und die Erträge nationaler Vermögenswerte aus. Sie erhöhen die Gefahr, dass CO2-intensive Assets zu „gestrandeten“ Vermögenswerten werden.
Die physischen Risiken des Klimawandels
Der Indexwert für das physische Risiko ergibt sich aus der geschätzten jährlichen Gesamtbelastung eines Landes durch klimabedingte Schäden, Kosten und Verluste. Er berücksichtigt die folgenden Elemente:
• akute Risiken extremer Wetterereignisse (Stürme, Hitzewellen, Nebel usw.) und anderer klimabedingter Katastrophen (Überschwemmungen, Erdrutsche, Dürren, Flächenbrände usw.)
• chronische Risiken als Folge langfristiger, allmählicher Änderungen der Klimamuster, nämlich:
• die Beeinträchtigung von Landwirtschaft und Lebensmittelerzeugung
• die Folgen steigender Meeresspiegel, die das Ergebnis schmelzender Gletscher und Eisschilde sind
• die Folgen für die Qualität der erforderlichen Infrastruktur. Infrastruktur ist nicht nur akut durch Naturkatastrophen gefährdet, sondern auch durch allmähliche Klimaveränderungen. Letztere erhöhen die Belastung von Straßen, Häfen, Telekommunikationssystemen etc. und machen Nachbesserungen erforderlich, was zu höheren Investitions- und Wartungskosten führt
• die Auswirkungen höherer Temperaturen auf die Arbeitsproduktivität, vor allem für Tätigkeiten im Freien
Diese Klimafolgen berechnen wir anhand empirischer Studien und anderer wissenschaftlicher Untersuchungen zu den wirtschaftlichen Kosten von Klimaereignissen und -veränderungen. Dabei stehen normalerweise die monetären Kosten oder die prozentualen Einbußen beim Bruttoinlandsprodukt im Mittelpunkt.
Außerdem bewerten wir bei der Ermittlung des physischen Risikos, inwieweit die einzelnen Länder in der Lage sind, sich auf den Klimawandel einzustellen. Je mehr sich Länder an den Klimawandel anpassen und damit ihre Anfälligkeit reduzieren, desto geringer dürften die Auswirkungen sein. Inwieweit ein Land finanziell in der Lage ist, sich an den Klimawandel anzupassen, wird anhand der Staatseinnahmen und des Länderratings gemessen. Auf institutioneller Ebene bewerten wir dies anhand von Governance-Faktoren und des Stands der menschlichen Entwicklung.
Die Risiken der Klimawende
Die Indexwerte für das Transitionsrisiko werden ähnlich ermittelt. Hier bewerten wir, wie anfällig ein Land für die wirtschaftlichen Folgen der globalen Klimawende ist, und inwieweit es diese Folgen zu mindern vermag (Minderungskapazität). Länder können Transitionsrisiken mindern, indem sie ihre Treibhausgasemissionen begrenzen oder reduzieren. Dort, wo schnell auf ein kohlenstoffärmeres Entwicklungsmodell umgestellt wird, sind die langfristigen wirtschaftlichen Auswirkungen der Klimawende geringer.
Die folgenden Faktoren beeinflussen das Transitionsrisiko:
• die Erträge aus dem Geschäft mit fossilen Brennstoffen. Diese dürften aufgrund strengerer Klimaschutzvorschriften und veränderter Verbraucherpräferenzen künftig sinken
• der aktuelle Treibhausgasausstoß. Hohe Emissionen dürften in Zukunft höhere Kosten bedeuten, Stichwort: CO2-Preis
Die Minderungskapazität basiert auf drei Größen:
• Erfolg beim Einsatz erneuerbarer Energieträger
• Erfolg bei der Verbesserung der Energieeffizienz
• Umfang des Engagements gegen den Klimawandel (gemessen an den nationalen Klimabeiträgen der Länder gemäß dem Pariser Abkommen)
Auf Basis wirtschaftswissenschaftlicher Fachliteratur und ökonometrischer Analysen haben wir diese Faktoren entsprechend gewichtet und daraus einen zusammengesetzten Indikator für das Transitionsrisiko der Länder gebildet.
Einkommensschwache Länder sind am anfälligsten für die physischen Risiken des Klimawandels
Kein Land ist immun gegen die Folgen des Klimawandels. Einige Länder und Regionen sind jedoch deutlich anfälliger für die direkten physischen Folgen der Klimaveränderungen als andere. Der EIB-Länderindex für das physische Risiko zeigt klar auf, welche Regionen am stärksten bedroht sind: Subsahara-Afrika (vor allem die Sahelzone), Süd- und Südostasien (hier insbesondere Länder mit viel Landwirtschaft und niedrig gelegenen Küstengebieten) sowie kleine Inselstaaten in der Karibik und im Pazifischen Ozean.

Die Anfälligkeit so vieler Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen ergibt sich teilweise aus ihrer geografischen und klimatischen Lage. Kleinen karibischen und pazifischen Inselstaaten droht besonders Gefahr von Hurrikans und Zyklonen sowie steigenden Meeresspiegeln. Viele asiatische und afrikanische Länder sind vor allem wegen der langfristigen Auswirkungen auf die Landwirtschaft und der Folgen exzessiver Temperaturen für die Arbeitsproduktivität gefährdet. In Asien und Südostasien droht die Gefahr meist durch steigende Meeresspiegel. Das gilt auch für einige afrikanische Küstenstaaten.
Auch die Fähigkeit, sich auf den Klimawandel einzustellen und sich besser dagegen zu wappnen, ist wichtig. Viele der Länder, die den direkten physischen Folgen der Klimaveränderungen am stärksten ausgesetzt sind, sind zugleich am wenigsten in der Lage, sich anzupassen. Hier ist vor allem Subsahara-Afrika zu erwähnen. Im Karibik- und Pazifikraum ist das Bild dagegen uneinheitlich. Viele weniger entwickelte Länder sind gerade wegen ihres geringeren Entwicklungsstands besonders anfällig für den Klimawandel. Die schlechte Qualität von Infrastruktur und Wohnraum verschärft die menschlichen und wirtschaftlichen Folgen von Naturkatastrophen wie Wirbelstürmen noch. Auch die zu starke Abhängigkeit von der Landwirtschaft macht Menschen und Volkswirtschaften verwundbar. Hinzu kommen eine hohe Staatsverschuldung und geringe Staatseinnahmen, die schnellen Investitionen in Anpassungsmaßnahmen im Weg stehen. Menschen mit geringem Einkommen, wenig Ersparnissen und schwacher Kreditwürdigkeit sind für jede Art von Krise anfällig.
Daher gehen die Reduzierung von Armut und die Bekämpfung der Folgen des Klimawandels Hand in Hand. Gefährdete Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen brauchen Hilfe für konkrete Anpassungsmaßnahmen, etwa für den Küstenschutz oder eine robustere Infrastruktur. Sie brauchen darüber hinaus Unterstützung in Entwicklungsfragen, um ihre Infrastruktur auszubauen, ihre Wirtschaft zu diversifizieren und die Einkommen zu erhöhen – Maßnahmen, mit denen sich die Klimafolgen oft besser in den Griff bekommen ließen.
Länder mit hohem Einkommen haben das größte Transitionsrisiko, einkommensschwache Länder mehr Probleme mit dem Klimaschutz
Verglichen mit dem physischen Risiko ergibt sich beim EIB-Index für das Transitionsrisiko ein anderes Bild. Hier sind vor allem Exporteure fossiler Brennstoffe am stärksten gefährdet. Für einkommensstarke Länder, die einen Großteil der weltweiten Ressourcen verbrauchen und erhebliche Emissionen verursachen, sind die Risiken aus der Umstellung auf eine emissionsarme Wirtschaft allgemein höher. Aber auch in Entwicklungsländern dürften die Transitionsrisiken in naher Zukunft steigen, weil sie versuchen, zu den Industriestaaten aufzuschließen und Wirtschaftswachstum und Treibhausgasemissionen bei ihnen nicht entkoppelt sind.

Doch auch für viele Länder mit niedrigem und mittlerem Einkommen ist das Transitionsrisiko insgesamt hoch – vor allem aufgrund ihrer geringeren Minderungskapazitäten. Einige afrikanische Staaten wie Tschad, Demokratische Republik Kongo oder Nigeria sind stärker gefährdet als einige europäische Länder. In bestimmten Fällen ist dies auf die hohe Abhängigkeit von Einnahmen aus fossilen Brennstoffen zurückzuführen. Hauptgrund ist jedoch die geringe Minderungskapazität: Erneuerbare Energiequellen sind bisher kaum vorhanden, ebenso wie der Wille zur Veränderung. Hinzu kommen fehlende Mittel. Und auch in den Entwicklungsländern mit niedrigem Transitionsrisiko sind grüne Investitionen immer noch dringend erforderlich. Hier besteht massiver Investitionsbedarf, um die Lücken in der Infrastruktur zu schließen, die Armut zu verringern und ordentliche Arbeitsplätze zu schaffen – und zwar so, dass die Treibhausgasemissionen in einem nachhaltigen Rahmen bleiben. Dieses Umdenken in der Entwicklungszusammenarbeit muss Teil der globalen Klimawende sein.
Grüne Entwicklungsfinanzierung wird dem Bedarf noch nicht gerecht
Die Klimarisiken der Entwicklungs- und Schwellenländer zeigen, wie wichtig es ist, ausreichend Klimafinanzierungen zu mobilisieren. Hier sind multilaterale Entwicklungsbanken wie die EIB gefragt. Im Jahr 2020 entfielen 30 Prozent der EIB-Finanzierungen außerhalb der Europäischen Union auf Klimaschutz und Klimaanpassung. Als Klimabank der EU werden wir spätestens ab 2025 50 Prozent unseres Finanzierungsvolumens für diese Ziele vergeben. Dies ist elementar wichtig. Denn in den Entwicklungsländern wird immer noch viel zu wenig Klimaschutz finanziert. Vor etwas mehr als zehn Jahren versprachen die Industriestaaten, ihre Mittel dafür bis 2020 auf jährlich 100 Milliarden US-Dollar zu erhöhen. Aktuellen Schätzungen zufolge wurde dieses Ziel verfehlt.[10]
Darüber hinaus kann das jährliche Ziel von 100 Milliarden US-Dollar nur ein Minimalziel sein. Jetzt, da das Jahr 2020 schon vorbei ist, muss die Latte noch höher gelegt werden: Dringlichkeit und Ausmaß der Klimarisiken für die Schwellenländer – und für die ganze Welt – lassen uns keine andere Wahl.
Matteo Ferrazzi, Fotios Kalantzis, Sanne Zwart und Tessa Bending arbeiten in der Abteilung Volkswirtschaftliche Analysen der Europäischen Investitionsbank.