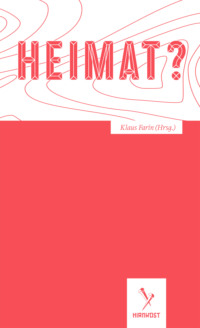Kitabı oku: «Heimat?», sayfa 2

Trap Heimat Klauen
von Olufemi Atibioke
Ich stehe unter der Dusche. Mein iPhone spielt Deutschlandfunk (mal wieder – warum, weiß ich auch nicht so genau). Es ist der Tag der Deutschen Einheit. In der Rubrik Essay und Diskurs geht es um Heimat, Untertitel: der offene Begriff. Der Beitrag beginnt mit Smetanas Moldau, dann ein tiefsinniges Zitat von Hölderlin, ein weiteres, noch tiefsinnigeres von Bloch. So klingt German Funk. Der Begriff ist nach drei Minuten schon zu. Dicht. Ich schalte ab. Das Radio läuft weiter im Hintergrund. Ich frage mich: Wer klaut eigentlich Bücher? Oder Texte? Keiner, oder? Außer irgendein sweetes Bohemian Child in irgendeiner mittelgroßen deutschen Universitätsstadt. Leicht angetrunken, höchst aufgeregt und irgendwas Rebellisches vom Merve Verlag in der Bootytasche als seelische Unterstützung dabei, tapst es durch die altlinke Buchhandlung seiner Wahl, steckt was Kleines, Flaches ein, kauft aus schlechtem Gewissen doch noch einen Bleistift mit Radiergummi und sitzt dann zwei Straßenecken weiter auf einer grünen Bank, blättert mit feuchten Händen durch das Buch und fühlt sich insgeheim einem seiner Lieblingsrapper um einiges näher. Wie er, nur anders.
Sehr sweet. Ist okay. Aber sonst? Wer klaut Bücher? Wer Texte? Keiner, Bruv. Keiner. Menschen, die aus freien Stücken Bücher lesen, sind brav. Wollen die Autorin unterstützen. Den Einzelhandel. Den Verleger. Und kaufen deshalb.
Ich steige aus der Dusche, trockne mich ab, putze Zähne.
Also warum schreiben? Nichts gegen die brave Leserschaft, sollen sie machen. Aber es sind die Klauenden, die ich als meine primäre und einzige Zielgruppe verstehe. Schade nur, dass sie mich nicht klauen werden. Mich nicht hören werden. Mich nicht verstehen und missverstehen werden. Und mir vor allen Dingen nicht sagen werden: Lass den Scheiß.
Auf sie würde ich hören. Nur auf sie. Denn die Klauenden sind meine Vorbilder. Seit meiner Kindheit brennt da ein Feuer der Sympathie in mir, das ich hege und pflege. Klauen war cool. Sehr cool sogar. Wenn man die Richtigen beklaute. Wenn man es schaffte, dem Klauen ein gesellschaftskritisches Theorem unterzujubeln. Ein Statement. Dann ist Klauen sehr, sehr cool für mich. Bis jetzt. Jay Rock, Basquiat.
Hip-Hop (suprise, suprise) ist Öl für dieses Feuer.1 Samplekultur verstehe ich als Klaukultur. Gefällt mir, nehme ich. Copyright? Wie wär’s erstmal mit Civil Rights, mein Jiggo? So ungefähr. Bis jetzt. Hito Steyerl, Negroman, Virgil Abloh. Letzterer schreibt eh nicht, tippt höchstens auf seinem iPhone. Ansonsten macht er Schuhe. Und klaut Ideen.
Der Kaffee ist etwas sauer, das Kaffeepulver zu kurz geröstet für die Caffettiera. Zu unrobust. Glaube ich. Keine Ahnung. Ich trinke zwei Schlucke und kippe den Rest in den Abfluss der Spüle.
Früher ging ich viel in die Bücherei. Lieh aus. Bücher, Ideen, Sätze. Schöne Sätze zitierte ich gerne genau, inklusive Urheber. Ich fühlte mich smart. Irgendwann hörte ich dann, dass exaktes Zitieren inklusive (meist männlichen) Urhebers sehr alphamännliches Verhalten sei, und (in meinem bestimmten Fall) checkte ich, dass Zitieren auch den jämmerlichen Versuch beinhaltete, irgendeinem Establishment zu gefallen. Ich ließ das genaue Zitieren weg (so gut wie). Sobald ich sie verstanden hatte (oder meinte, sie zu verstehen), wurde die fremde Idee einfach meine Idee. Ich lieh aus, aber gab nicht wieder zurück.
Geht das auch mit Heimat? Kann man sich Heimat klauen? Zusammenklauen? Zurückklauen? Allein? Als Gruppe? Ist das nicht der einzige Weg weg von Hölderlin & Co.? Ihn beklauen, alle Smarten und Reichen beklauen und dann abziehen? Einfach abziehen. Nach Italien oder so.
Klingt gut. Heimat kann man nicht schreiben. Wenn überhaupt, wenn man will, kann man Heimat machen.
Ich bin seltener in Büchereien. Was mich früher anzog (die Ruhe, die Ordnung, das Stöbern), kommt mir heute unnatürlich vor. Auch das Lesen kommt mir dieser Tage unnatürlich vor. Wie ein Fliehen. Zu einer lesenden Clique in der Diaspora. Man versteht sich. Labert, talkt und speakt (manchmal trendy subaltern) und hat kein anderes Gesprächsthema als die Realität, der man entflohen ist. Über Krieg, über Frieden. Über Angst, über Liebe. Über Ausland, über Heimat. Heimat, Heimat, Heimat. Trap.
Ich sitze in der Tram, werde kontrolliert. Bin nervös, obwohl es keinen Grund gibt. Mein Ticket ist gültig.
Der Stärkste ist der, dem die ganze Welt fremd ist. (Geklaut.)
Und das Paradies ist überall zu finden. (Auch geklaut.)
Urlaub: Vor ein paar Wochen war ich im Geburtsland meines Vaters. Ich lief durch Lagos. Und ich kam an meine performativen Grenzen. Ich war weiß. War vorher noch nie weiß. Wusste nicht, wie das geht, weiß sein. Versuchte es, fühlte mich unwohl. Wurde festgenommen, geschlagen, verhört. Mein nigerianischer Pass für die Cops eine Fälschung. Mein deutscher Pass nicht dabei. Meine Schwester kam, kaufte mich frei. Sie sagte mir: Welcome to Lagos. Ich sei jetzt ein richtiger Lagosian. Ich wurde ruhiger, vorsichtiger. Ich fing an mich anzuziehen wie ein Yoruba-Mann. Ich wurde dunkler. Ging langsamer. Lachte lauter und länger. Über Korruption und so. Steal your watch. And tell you what time it is. Ich buchte einen früheren Flug zurück. Meine Ankara-Stoffe zu dünn für das kalte Wetter hier. Ich zog mich wärmer an, wurde wieder heller. Ich packte die Stoffe weg. Mit einem Lavendelsäckchen gegen Motten. Konnte Europäisches nicht mehr wirklich ernst nehmen. Alles Hunde. Whack. Verwöhnt. Egozentrisch. Ich war nicht beeindruckt von Kultur. Sie begeisterte mich nicht. Sie war für mich genauso natürlich wie Natur. Auch sie begeisterte mich nicht. Dem Regen ausgesetzt zu sein, ist genauso nervig und oder schön, wie Worten ausgesetzt zu sein. Ich brauche einen Regenschirm. Gerne auch saurerregenresistent. Greta nervte mich. Wie über Klima geredet wurde, nervte mich. Man hatte wieder eine kollektive Moral in diesem Land. Man war sich einig. Gruselig. Heimat. Trap.
Ich steige aus der Tram. Atme durch. Eine mittelgroße deutsche Universitätsstadt um mich herum.
Ich schreie: „Was wir hier haben, ist ein Kommunikationsproblem!“
Vollkommen drüber. Unangenehm. Kitschkrieg.
Ich schreie natürlich nicht.
Ich lese nicht.
Ich schreibe nicht.
Warum nicht?
Ich habe keine Zeit zum Schreiben.
Keine Zeit für Heimat.
Ich setze mich in ein Café, unterhalte mich über Heimat. Mein Gesprächspartner sagt mir:
„Heimat ist mehr als Infrastruktur, mehr als Deutschlandfunk, Dusche, Kaffee, Tram. Heimat ist mehr als Deutschland.“

1 Es gab eine Zeit, da war es mir peinlich, dass ich Hip-Hop höre. Ich fand mich in einem Klischee wieder, das dem weißen Otto Normallaberer perfekt zuspielte. Dunkle Hautfarbe, sportlich (ich bin sogar sehr sportlich) und Hip-Hop-Fan? Check. Next. Gegen diese Scham- und Schutzkultur, die keinen Spaß macht und einen lähmt, half in meinem Fall Miles Davis („So What?“) und der performative Überexzess (eigenes Mixtape droppen.)

Görlitz I
von Roman Israel
die Straße ist ein hartes Pflaster
in Görlitzer Höfen findet ein hartes
Wettrüsten statt
wer hat den dicksten den längsten
den deepesten Docht mit dem niederfrequentesten
Brummen der
Sportauspuffwummen
das ist
angesagt wie warme Semmeln aber keine
warmen Semmeln
die holt man aus dem Froster
denn die Löhne sind niedrig im Vergleich
mit irgendwo (irgendwo darbt immer einer
muss ja aber doch nicht hier!) das nimmt mancher
sehr ernst und zum Anlass beim Wählen zu wählen
denn das Görlitzer Leben ist hard und behaart wovon
sich nur längere dickere Auspuffe leisten? das
wissen nur die Toten die dreisten
wäre es nur fri-er gewesen
jetzt kommen Fremde
Idioten die weitgereisten und nehmen den
Altfremden die Auspuffe weg denken
die und was bleibt ihnen dann noch
außer Hummer für den guten Zweck?
im Fernsehen kommt TV
tagsüber ficken Hunde
oder machen Fondue oben wohnen Polen
ebenfalls Auspuffjünger
allerdings anders in Klang und Design
ümmer weint ein Chinese an
Jakob Böhmes Grab und ein greiser Knab
Achselbehaart steht am
MacGeiz in einer Schlange
erstmal anstellen denkt er sich
dann weiter nicht umgekehrt
vllt. gibt’s ’nen Sack Auspuffhalter hier
oder Bier
in der Stadt ist es nicht still
auf dem Land ist es nicht laut
hier lebt es sich nicht schlecht
und dennoch weiden sich viele
am Leiden so erzählt man sich so
erzählt man sich wär’s doch nur
früher ein bisschen wieder früher
beizeiten

Görlitz II
von Roman Israel
ich habe den Fischen beim
Luftschnappen zugesehen und
den ruhigen Bewegungen des
Herbstes auf den Teichen
Blätter wirbelten wie kleine Galaxienleichen
umher ein Angler deutschte Polnisch
in sein Handy hinein Libellen
bewegten sich zahm neben seinem
Bein kaum in Sorge sie könnten
erschreckt werden
in der Ferne zeichneten sich die Gipfel
des Riesengebirges ab vor polnischer
Hochhaussilhouette
auf den Kämmen lag
schon etwas Schnee oder war es nur
ein Abglanz der Sonne? ein Mädchen
summte gaga Lady und sagte wie gerne
es hier sei daheim zwischen dem
Görlitzer Sonnenschein und den
anderen Welten und trotzdem
komme es so selten
hier her hier her
so selten so selten hierher
zwischen den Welten
sagte es als sei
es eine Kunst
davon zu sprechen
so selten so selten
zwischen den Welten
hier her
In Städten glaubt man, es gehöre zum guten Tone, nicht einmal zu wissen, wer in demselben Hause wohnt.
Adolph Freiherr Knigge
Adolph Franz Friedrich Ludwig Freiherr Knigge (1752–1796), deutscher Schriftsteller.


Heimat ist ein Tomatenbrotschnittchen
von Isobel Markus
Ich sitze an meinem Schreibtisch und mein Blick fällt auf eine Postkarte an der Wand.
Heimat ist da, wo dein Laptop steht.
Ich blicke unentschieden auf meinen Laptop und denke an meine alten Heimaten. Mir fällt auf, dass der Plural in diesem Zusammenhang wohl eher unüblich ist. Heimat verlangt nach einem Singular. Heimat will monogam geliebt werden, mit Sehnsucht und exklusiv. Heimat, oh du mein einziger BFF.
Heimat ist ein schwieriger Begriff. Ist Heimat ein Ort oder ein Gefühl, ein Geruch oder Geschmack oder eben alles zusammengenommen, ein sehr individueller Sehnsuchtsort? Ein Begriff zumindest, der bereits historisch missbraucht und derzeit wieder ideologisch aufgeladen ist.
Ich denke an die Spielplätze meiner Heimaten. Mir fallen eine Kiesgrube, ein Parkplatz und die Bahntrasse im Wald ein. Das war im Dorf meiner Kindheit, in dem mein liebster Freund ein paar Jahre später an der Bahntrasse starb. Ansonsten war das Dorf pittoresk mit roten Ziegeldächern und Jägerzäunen, die Vorgärten eher einrahmten als abschirmten. Ich erinnere mich an den Wind in den mannshohen Maisfeldern, an Straßen mit Kopfsteinpflaster oder wiederum an Bürgersteige, die so neu wirkten, als wäre noch nie jemand auf ihnen gelaufen. Einmal wurde in großen grünen Buchstaben PLO auf eine Straßenkreuzung gesprüht und die Gerüchteküche brodelte. Ich erinnere mich an die Straße, auf der ich mit nackten Füßen nach Hause lief, weil ich einmal meine Schuhe im Wald verloren hatte. Ich erinnere mich an das Gesicht meiner Mutter, als sie meine absonderliche Erklärung dazu hörte. Die Schuhe fanden wir nie wieder.
Heimat ist wahrscheinlich eine sehr fürsorgliche Geschichte.
Etwa, wenn man jetzt bei der Oma ins Haus kommt, wo es wie früher nach Holz, Honig und Klosterfrau Melissengeist riecht, man sofort wieder acht Jahre alt ist und auf die besten Bratkartoffeln der Welt wartet. Nur dass jetzt die Möbel geschrumpft wirken.
Heimat ist auch sehr intensiv, wenn sich jemand freut, dich wiederzusehen, und man spürt, dass man zu Hause ist. Oder wenn jemand sagt: „Fahr vorsichtig.“
Oder: „Bist du gut angekommen?“
Heimat ist, selbst im Dunkeln zu wissen, wo die Lichtschalter sind.
Ich denke an die Zeitabschnitte, an die mein heimatliches Gefühl gebunden war, an die Menschen und an mein Vertrauen. Mein unbedingtes Vertrauen.
Wir zogen aus dem Dorf weg und fortan häufig um, meine Eltern, meine Geschwister und ich. Nach meinem Auszug bei den Eltern machte ich das Umziehen dann zu meiner eigenen Gewohnheit. Es war mir wohl selbst ein Stück Heimat geworden, spätestens alle zwei bis drei Jahre die Bleibe zu wechseln. Und es gab immer einen guten Grund, weiterzuziehen, wobei das Wort weiter ja womöglich ein Ziel implizieren könnte, und das hatte ich nicht. Kein endgültiges zumindest. Ich wollte neu anfangen. Egal wie. Allein oder zu zweit mit meinem Freund. Zu zweit wollten er und ich nach Neuseeland auswandern, da waren wir etwa Anfang 20. Es war alles vorbereitet. Das Visum, die Arbeitserlaubnis, wir waren bereit. Aber dann wog bei ihm die alte Heimat doch plötzlich schwerer als meine Sehnsucht nach einem Neubeginn. Und damals war er meine Heimat.
Ich überlege, ob mein Umherziehen all die Jahre auch an den vielen Fluchterlebnissen in der Geschichte meiner Familie liegen könnte. Viel wurde davon erzählt. Flucht war ein großes Thema in unserer Familie. Man hatte alles zurücklassen müssen, nicht weil man sich wie ich freiwillig dazu entschied, sich voller Enthusiasmus auf zu neuen Ufern zu machen, sondern weil man vor Angst dazu gezwungen worden war, sein Leben und das seiner Lieben zu retten. Der Krieg machte meine Familie heimatlos. So lässt sich Heimat von vielen Seiten betrachten. Von der schmerzhaften Seite, die den Verlust beinhaltet oder der anderen, die geborgen heimatliche Gefühle hervorbringt.
Allerdings war mir Heimattümelndes stets unangenehm. Und damit meine ich weniger Bierzelte voller Lederhosen und Dirndl, Schlagerabende mit Betten in Kornfeldern oder schunkelnde Volksmusiksendungen. Mit diesen hatte ich keine Berührungspunkte.
Mir fielen eher Erlebnisse unangenehm auf, die, wie ich verwundert feststellte, andere in meinem Alter offenbar als angenehm empfanden.
Dazu gehörte der Postbote, der nach ein paar Tagen meinen Nachnamen kannte und daher genau wusste, dass ich vor allem Mahnungen erhielt. Ebenso wie die Frau auf ihrem Mickymaus-Kopfkissen am Fenster ganz unten, die kein Kommen oder Gehen unkommentiert ließ. Unangenehm, wenn mein Kommen unverhohlen erst morgens um sechs stattfand. An anderen Morgen traf man immer dieselben Gesichter in den öffentlichen Verkehrsmitteln, die mir nach ein paar Monaten grüßend zunickten oder, fast noch schlimmer, der Chef der Pizzeria, der neben seinen Stammgästen bald auch uns mit Handschlag begrüßen wollte. Der Grad zwischen Fürsorglichkeit auf der einen und Neugier und Kontrolle auf der anderen Seite erschien mir schmal. Heimattümelndes raubte mir das Gefühl, mich unbeobachtet zu wähnen. Wir gingen also woanders essen, ich nahm eine Bahn früher oder später oder wir zogen bald wieder um.
Merkwürdigerweise fühlten sich andere in diesem nachbarschaftlichen Verhältnis wohl. Sie genossen den Plausch beim Milchholen und empfanden den Kiez als heimelig. Ich dagegen wählte andere Wege, sobald sich heimatlich klebrige Gefühle einzustellen drohten.
Es war kein Zwang, bloß eine heimatliche Unverträglichkeit vielleicht. Eine Unverträglichkeit, die bei Nichtbeachtung in mir ein Gefühl auslöste, vor dem ich mich lieber in Acht nahm. Das Gefühl, als ich Freunde in ihrem neuen Reihenhaus in einer Vorstadtsiedlung besuchte. Sie waren glücklich, man sah es ihnen an. Sie strahlten und ich wusste, dass sie genau das, was sie immer suchten, endlich gefunden hatten: einen heimatlichen Ort in der zu großen Stadt. Ich freute mich für sie mit. Ich konnte gar nicht anders. Aber ich verabschiedete mich nach ein paar Stunden unter einem Vorwand und bekämpfte das beklemmende Gefühl, keine Luft mehr zu bekommen, mit schnellem Schritt zurück in die Stadt.
Heimat war für mich etwas anderes. Kein Ort, vielmehr ein Wir – mein Freund, meine Freunde, meine Familie und ich. Wir waren ein Zelt, das ich überall aufschlagen konnte. Es bot mir ortsunabhängig Schutz und verschaffte mir ein warmes Gefühl. Ich blickte selten mit einem wehmütigen Auge auf die alte Heimat. Ich freute mich auf das, was mich erwartete. Immer wieder.
Als dann die Kinder kamen, wusste ich erstaunlicherweise mit unserem allerersten Blick aufeinander, dass sich etwas ändern würde. Nach einer Weile bemerkte ich überrascht, dass ich sesshafter wurde und mich verortete. An den Ort, an dem die Kinder und mein Freund lebten, gehörte jetzt merkwürdigerweise auch ich. Plötzlich war es schön, wenn die neue Erzieherin sofort die Namen meiner Kinder kannte, und ich mochte es sogar, wenn uns der Mann am Gemüsestand „Schönen Tag“ hinterherrief, nachdem er jedem Kind einen Pfirsich in die Hand gedrückt hatte.
Und ich? Ich fand es nett. Irgendwie freundlich. Kaum mehr peinlich. Sogar rührend fürsorglich.
Vielleicht entsprach es einem sicheren Gefühl, das ich den Kindern bieten wollte. Wir schufen uns ein sicheres, heimatliches Gefühl, das an unseren Wohnort geknüpft war. Die Kita und später die Schule verstärkten das Phänomen und ließen mich meine üblichen Reflexe von Flucht vergessen. Der Ort mit den Kindern bot beiderseitige Geborgenheit, die ich warm spürte, wenn sie Mama riefen, mit verschmierten Gesichtern auf mich zuliefen und ihre klebrigen Finger an meinem Hosenbein abwischten. Ein Gefühl, das ein Vertrauen voraussetzte, und das im Kollektiv.
Inzwischen sind meine Kinder groß. Sie gehen mehr und mehr ihre eigenen Wege. Ich begrüße das und doch bemerke ich, wie wehmütig ich manchmal auf uns und unser kuscheliges Heimatgefühl zurückblicke.
Trotzdem musste ich neulich feststellen, dass sich bei mir erneut etwas verändert. Als die Verkäuferin beim Bäcker fragte, ob ich Laugenstangen wie immer wolle, sah ich mich kurz darauf verstohlen um, ob von dieser Stammkundschaftsszene jemand Zeuge geworden war.
Meine heimatliche Unverträglichkeit beginnt also wieder.
Vielleicht ist Heimat also kein Ort, sondern an Zeiten, Personen und Geschichten geknüpft. Es sind Menschen, die einem das Gefühl geben, man wäre zu Hause in der Heimat.
Meine Familie, meine Freunde und die gemeinsam erlebten Geschichten bieten mir ein heimatliches Gefühl, das nicht notwendigerweise an einen Ort gebunden ist, außer dem des vertrauten gemeinsamen Beisammenseins. Wir stellen wenig grundsätzliche Fragen oder uns in Frage, denn wir setzen uns heimatlich, nicht selten kritiklos, voraus.
Ich schaue auf die Postkarte.
Heimat ist da, wo dein Laptop steht.
Ein Freund ruft an. Ich frage recht unvermittelt:
„Was bedeutet Heimat eigentlich für dich?“
„Deine Tomatenbrotschnittchen. Die rühren mich zu Tränen“, sagt er.