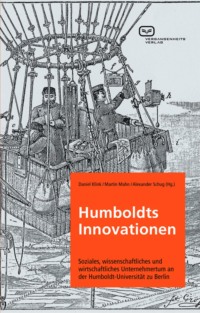Kitabı oku: «Humboldts Innovationen», sayfa 3
„Lassen Sie das, mit dem Gespüle ist ja doch nichts anzufangen!“
August Wilhelm
von Hofmann
(1818–1892)
von Daniel Kirchhof
Pechschwarz, zähflüssig und ätzend vernebelt der Teer mit seinem Gestank die Sinne. In den großen Fabriken der zur Mitte des 19.Jahrhunderts aufkommenden chemischen Industrie fiel er in großen Mengen an. Die Schadstoffemissionen der schwarz rauchenden Fabriken lagen weit jenseits unserer heutigen von Klimawandel und Emissionsdebatten geprägten Vorstellungskraft. Unter den industriellen Abfallprodukten wie Schwefelsäure, Chlorbleiche oder Sulfitlauge präsentierte sich der harzige, klebrige Teer als besonders problematisch. Es hätte wohl kaum jemand gedacht, dass sich gerade aus dem Teer der Steinkohle etwas Brauchbares gewinnen ließe. Schillernde, prächtige Farben, ästhetische Genüsse und sogar medizinisch-pharmazeutischer Fortschritt – dazu schien Teer wohl kaum geeignet zu sein. Das biss sich wie sein Gestank – ein Irrtum.
Als der junge August Wilhelm Hofmann sich während seines Studiums für die synthetische Chemie zu interessieren begann, war an die spätere Blüte dieses Zweiges noch nicht zu denken. Gerade einmal 18-jährig, aufgeweckt aber ohne einen klaren Lebensplan21 , schrieb er sich 1836 an der Giessener Universität ein. Wissensdurstig und beseelt von forschendem Drang, begann nach einer zähen Zeit des Studierens mit juristischen Schwerpunkten seine intensive Beschäftigung mit der Chemie. Als Schüler und späterer Assistent Justus von Liebigs wurde Hofmann bei ihm bereits nach fünf Studienjahren gleich promoviert. Seinen Forschungen über die Synthese von Anilin, das reichlich im Teer der Steinkohle vorkommt, und dessen Möglichkeiten, verdankte er seinen späteren länder- und disziplinübergreifenden Ruhm.
Sein Vater, der Giessener Hofkammerrat und Provinzialbaumeister, Johann Philipp Hofmann, war ein vorbildlicher Bildungsbürger seiner Zeit: voll ernsten Strebens und beseelt von der Liebe zu allem Edlem und Guten. Er rühmte sich der engen Freundschaft zu Justus von Liebig22 – man blieb gern unter Seinesgleichen. Er liebte das Reisen durch Europa und diente in mehreren europäischen Adelshäusern, zuletzt beim Großherzog von Hessen. Er leitete die Erweiterungsbaumaßnahmen des Liebigschen Labors, das durch den großen Andrang internationaler Studierender aus den Nähten zu platzen drohte. Für den Vater und dessen Statusdenken war der Sohn jedoch noch alles andere als satisfaktionsfähig. Dieser klagte bei Liebig über die Unentschlossenheit und die mangelnde Motivation seines Sohnes bei dessen Studium.23 Er hätte es gern gesehen, dass sein Sohn in seine Fußstapfen tritt, stattdessen interessierte dieser sich lieber für fremde Sprachen und gab sich den ästhetischen und musischen Genüssen hin, denen er auf den gemeinsamen Reisen mit dem Vater durch Italien und Frankreich begegnet war.24 Die romanischen Sprachen und die Künste übten auf ihn eine große Faszination aus, zu fremden Kulturen fand er sehr leicht Zugang.25 Nach Streitigkeiten zwischen Vater und Sohn belegte der junge August Wilhelm als Kompromiss widerwillig das Fach Jura mit der Aussicht auf ein Brotstudium zum Staatsbeamten. Damit konnte er sich nur schwer anfreunden, zog es ihn doch noch immer zu den romanischen Philologien und den Künsten zurück.
Doch Teil der universitären Ausbildung für zukünftige Verwaltungs- und Staatsbeamte war zu dieser Zeit auch der Erwerb chemischer Grund- und Fachkenntnisse. Liebig meinte ein großes Potenzial bei dem Jungen feststellen zu können und entgegnete dessen Vater: „Gib ihn mir, ich will sehen, was sich aus ihm machen lässt, er ist ja ein guter Bursche, und dumm ist er gewiss nicht, vielleicht hat er den richtigen Weg (noch) nicht gefunden.“26 Wie ein Magnet zogen Liebigs Lehrmethoden dann den jungen Studierenden an. In Liebigs Labor wurde Hofmann in die chemische Analytik eingeführt. Die dabei aufkommende Faszination des Neuen, des erlebbaren Forschens, beflügelte den jungen Hofmann. Vergessen waren die mühevollen Studien der Rechtswissenschaften. Künste und fremdsprachige Philologien fanden nur noch zu gelegentlicher Stunde des musischen Kusses Aufmerksamkeit. Die Begeisterung für naturwissenschaftliche Bereiche, allen voran der Chemie brach in ihm aus.27
August Wilhelm studierte bis zu seiner Promotion am 9.April 1841, einen Tag nach seinem 23.Geburtstag. Sein Doktorexamen bestand er summa cum laude und erlangte gleichzeitig die venia legendi, womit er fortan nicht nur lehrfähig, sondern auch lehrbefugt war.28 Auch nach der Promotion arbeitete der junge August Wilhelm nun als Liebigs Assistent forschend weiter.
Wieder war es der Zufall, der ihm den weiteren Weg ebnete. Den Liebigschülern Ernst Sell und Conrad Zimmer war in ihrer gemeinsamen Fabrik die Destillation von Teer gelungen. Ihrem Lehrmeister schickten sie eine Probe des dabei entstandenen Steinkohleteeröls. Diese gab Liebig an Hofmann zur Untersuchung weiter.29 Über dieses lästige Nebenprodukt der Koksherstellung und Gasbereitung war bislang nur wenig bekannt. Hofmann machte sich die Erkenntnisse, die von Runge und Laurent vorlagen, zunutze. Mit der Erlaubnis von Ernst Sell bereitete August Wilhelm Hofmann in der besagten Offenbacher Fabrik selbst größere Mengen des Basengemisches zu. Wenig später kehrte Hofmann mit zwei Kilogramm des Basengemisches30 nach Gießen zurück. Im Labor Liebigs gelang ihm der Nachweis der Anilinbase sowie der Leukolbase im Steinkohleteer. 1844 gelangte er zu dem Ergebnis, dass all jene Substanzen, die die russischen Chemiker Fritzsche und Zinin aus verschiedenen Benzolen gewonnen hatten, so verschieden ihre chemische Herkunft auch ist, dieselben chemischen und physikalischen Eigenschaften haben. Er hatte sich die tiefgreifende Erforschung der Teerbasen, deren Synthese und ihrer möglichen industriellen Verwendbarkeit in den Kopf gesetzt. Daran konnten die mahnenden Worte seines Professors und Lehrmeisters, Justus von Liebig: „lassen Sie das, mit dem Gespüle ist ja doch nichts anzufangen!“31 , nichts mehr ändern. Es stellte sich später heraus, dass sich der führende Chemiker seiner Zeit damit irrte. 1843 veröffentlichte Hofmann seine erste eigenständige Forschungsarbeit, in der er seine chemischen Untersuchungen der organischen Basen im Öl des Steinkohleteers verschriftlichte.32 Damit veröffentlichte er neueste Erkenntnisse über die Anilin-Base. Anilin besitzt eine ungeahnte Verwandlungskraft und wurde durch die Arbeit Hofmanns der Ausgangspunkt der modernen Farbchemie.
Der Name des Anilins leitete sich aus der arabischen Farbsilbe „anil“ für blau ab. Hofmanns Forschen und Wirken galt fortan nur noch dem Anilin und seiner abwandelbaren Stoffe. Seine Arbeiten waren für die aufkommende chemische Industrie von maßgeblicher, Impuls gebender Bedeutung. War Hofmann bis dahin von rein theoretischen Interessen und Erkenntnisdrang getrieben, so wurde sein Forschen in den Jahren nach der Promotion zunehmend praktischer ausgerichtet. Er erreichte als erster die direkte Chlorierung des Anilins über den Weg der gechlorten Anilinderivate. Hofmann gelang es dabei auch, weitere chemische Wesensmerkmale und Eigenschaften des Anilins herauszustellen.
Bei seinen Forschungen arbeitete Hofmann eng mit der Industrie zusammen. Das Öl des Steinkohleteers enthielt nur geringe Mengen des Anilins, so dass Hofmann mit industrieller Hilfe einen Weg finden konnte, den kostbaren Stoff Anilin leichter herzustellen. Dies gelang durch den Nachweis, dass die leicht siedenden Anteile des Teeröls große Mengen Benzol enthalten, dessen nahe Beziehung zum Anilin ihm bereits bekannt war. Indem er das Benzol in Gegenwart von Schwefelsäure mit starker Salpetersäure behandelte und das so gewonnene Nitrobenzol durch naszirenden Wasserstoff in Anilin verwandelte, beschritt er zuerst den Weg, auf dem noch bis weit nach seinem Tod die für die Teerfarbstoffe erforderlichen Anilinmengen gewonnen wurden.33
Hofmanns Ansehen wuchs. 1844, im Jahr nach dem Tod seines Vaters, veröffentlichte er seine Untersuchungen über Chloranil und im Jahr darauf eine Abhandlung „über die Metamorphosen des Indigos und die Erzeugung organischer Basen, welche Chlor und Brom enthalten“.34 Für diese Arbeit erhielt er von der Société de Pharmacie de Paris eine Verdienstmedaille und ein Preisgeld über 200 Francs. Hofmann gelang es, fachübergreifende Kontakte zu knüpfen. 1845 hielt er ein kurzes Gastspiel an der Bonner Universität. Hofmanns Werk war die Voraussetzung für weitere medizinische und pharmakologische Forschungen wie sie dann Robert Koch, Ernst Schering oder Paul Ehrlich durchführten. Teer war durch die Arbeit Hofmanns zum Ausgangsmaterial der industriellen organischen Chemie geworden.
Ein weiterer Zufall sollte den Weg Hofmanns bahnen. Zu den Beethoven-Feierlichkeiten im Herbst 1845 stellte sich bei einem Besuch des englischen Königspaares in Bonn heraus, dass August Wilhelm Hofmann dieselben Zimmer bewohnte, die der Prinzgemahl seiner Zeit als Student innegehabt hatte. Bei der königlichen Visite der Zimmer begegneten sich Hofmann und der Prinzgemahl erstmals. Diese Gelegenheit nutzte er zu einer Versuchsvorführung verschiedener Experimente. Das Königspaar war beeindruckt. Den Prinzgemahl imponieren die Erscheinung und die Kompetenz Hofmanns sogar so sehr, dass er ihn ausdrücklich nach England wünschte. In London sollte ein College of Chemistry gegründet werden. Auf Empfehlung Liebigs und durch die Zimmeranekdote wurde Hofmann mit dem Vorsitz des Gründungskomitees betraut. Von 1845 an war er Lehrstuhlinhaber und Rektor des „Royal College of Chemistry“. Seine Lehre brachte in der Folgezeit zahlreiche bedeutende Persönlichkeiten hervor. Eine gute Beobachtungsgabe, Freude an wissenschaftlicher Forschung, seine Didaktik und die fürsorgliche Betreuung seiner Schüler zeichneten ihn aus. Als englischer Staatsbeamter profitierte er von seinen ehemals erworbenen ausgeprägten Fremdsprachenkenntnissen. Er bereiste – wann immer es möglich war – den europäischen Kontinent, den Orient, Teile Afrikas und Nordamerikas. 1851 gelang es ihm, bei der Eröffnung der North-Pacific-Bahn anwesend zu sein. In England war seine Vertrauenswürdigkeit so hoch, dass er schließlich auch königlicher Vertrauter wurde.
Hofmann setzte in England seine früheren Untersuchungen zum Anilin fort. Er entdeckte das Umwandlungspotenzial der reaktionsfreudigen Base. Er wies die Existenz zahlreicher Derivate und Abwandlungsformen des Anilins nach und entdeckte den Anilinfarbstoff, mit dem es gelang, Textilien, Papier, Leder, Federn und andere wertvolle Stoffe mit prächtigen und schillernden Farben zu versehen. Durch seine Forschungen verhalf Hofmann der Teerfarbenindustrie zu einem ungeahnten Boom.35 Nun war Hofmann ein gemachter Mann von Wohlstand und Ansehen. Die hofmannschen Anilinfarben wurden in der Lederverarbeitung, im Papierdruck, in der Textilfärbung und schließlich auch in der Pharmakologie verwendet. Hofmann hatte daran entscheidenden Anteil. Das nach ihm benannte „Hofmann-Violette“ dominierte mehrere Jahre die Mode.36 Er hätte „Global-Player“ in England bleiben können, er wäre wohl immer gebraucht worden. Doch das Heimweh in deutschsprachige Gefilde und der späte Ruf an die Berliner Universität führten ihn in seine Heimat zurück.
Kaiser Wilhelm I. hatte Hofmann 1867 nach Berlin geholt. Hofmann entsprach mit seinem Forschergeist und unternehmerischen Gespür den Humboldtschen Idealen von Forschung, Lehre sowie umfassender Bildung bei gleichzeitiger Spezialisierung in der eigenen Disziplin. In Berlin ging es weiter wie bisher: Auch hier wurde er kaiserlicher Berater. 1867 gründete Hofmann zusammen mit Adolph von Baeyer, C.A. Martius, C. Schäbler und Ernst Schering die Deutsche Chemische Gesellschaft nach dem englischen Vorbild der ebenfalls durch Hofmann gegründeten Royal Society of Chemistry.37 Auch über die Deutsche Chemische Gesellschaft arbeitete Hofmann in enger Verknüpfung mit der Industrie. Durch die von ihm erforschten Kenntnisse des Anilins profitierten unter anderem die 1873 gegründete Aktiengesellschaft für Anilin-Farbstoffe (Agfa) und die fünf Jahre nach seinem Tode ins Leben gerufene Badische Anilin- und Soda-Fabrik (BASF).
Die Berliner Friedrich-Wilhelms-Universität bereicherte Hofmann schließlich durch seine insgesamt 25 Jahre währende Lehre und ein kurzes Rektorat, das er 1880/81 innehatte. Trotz großer Skeptiker und Widersacher aus anderen Disziplinen bewirkte er die Gründung des ersten Chemischen Labors an der Universität zu Berlin und stockte den damals schon sehr knapp bemessenen Etat oft aus eigenen Mitteln auf – Geld, das er oft nicht wieder sah. Der Bau des Laborgebäudes in der Georgenstraße zog sich durch Mangel an Etatzuschüssen über mehrere Jahre hin, da die Baukosten möglichst gering gehalten werden sollten, weil der Chemie im Vergleich zu anderen Disziplinen keine große Bedeutung beigemessen wurde.38 Dank Hofmann, der 1888 auch noch geadelt wurde, sollte sich das über die folgenden Jahre aber noch gehörig ändern. Am 5. Mai 1892 verstarb er, der Arbeitswütige, natürlich während seiner Arbeit in Berlin.
„Ein Leben voller Arbeit und Mühe ist keine Last, sondern eine Wohltat.“
Rudolf Virchow
(1821–1902)
von Henriette Schulz
1856 gründete Gustav Langenscheidt seinen bis heute weltweit bekannten Verlag, Werner von Siemens erfand den Doppel-T-Anker für den elektrischen Dynamo und schuf so die Grundlage der industriellen Stromproduktion, Heinrich Heine starb in Paris – und Rudolph Virchow hielt in Würzburg seine letzte Vorlesung als Professor für pathologische Anatomie. Einige Monate später sollte er nach Berlin zurückkehren, in die Stadt, die ihn sieben Jahre zuvor als unliebsamen Rebellen am liebsten in der Spree versenkt hätte.
Der Hörsaal in Würzburg applaudierte und jubelte, nachdem Rudolph Virchow mit seinen Ausführungen über die pathologische Gewebelehre geendet hatte. Die Schar der Zuhörer war von Woche zu Woche gewachsen und Ernst Haeckel, Assistent des Professors, hatte arge Bedenken, dass die Beschaffenheit des Raumes den Massen an Menschen nicht mehr lange Stand halten würde. Diese Befürchtung hegte er schon, seit er Virchows Vorlesung das erste Mal 1853 besucht hatte.39 Während Haeckel die sorgsam gehüteten Materialien des Mediziners zusammensammelte und die Fragen der neugierigen Studenten abwimmelte, dachte er an das bevorstehende Abschiedsessen im „Englischen Garten“ und die Dinge, die noch zu erledigen waren. Virchow wollte fast alle seine Kollegen einladen und sein Assistent hatte alle Hände voll zu tun: Tische mussten zusätzlich organisiert werden, der Koch brauchte neue Instruktionen und weitere Räume mussten gefunden werden, falls es in den Abendstunden zu kühl sein würde, um im Freien zu speisen.
Sein „Meister“ war ein Forschertyp par excellence. Lachen sah man ihn selten. Stattdessen befasste sich sein scharfer und klarer Verstand beinahe immerzu mit neuen Forschungsfragen. Leicht gewann man den Eindruck, dass sein sturer Enthusiasmus für eine Sache beinahe schon zwanghaft war. Aber genau aus diesem Grund hatte man ihn ja an die Würzburger Universität geholt. Man wollte von seiner „Genialität an Auffassung“ und seiner „gediegenen Gelehrsamkeit“ profitieren. Dies hatte man zwar nie offen ausgesprochen, aber Haeckel kannte die Absicht der Universität. Mit einem Arzt, der bereits in der kurzen Zeit seiner Karriere so deutlich für seine Ziele eingetreten war, konnte man einen „beträchtlichen Zuwachs von Lehrkraft und Talent“40 erwarten. Haeckel erinnerte sich gut, dass Virchow diesem Ruf damals nur zu gern gefolgt war. Nicht immer war Virchow so hochgelobt worden. Seine Stellung in Berlin, wo er zuvor tätig gewesen war, wurde für ihn aufgrund politischer Querelen unhaltbar. Er hatte sich mit seinen Unternehmungen für eine soziale Reform ein wenig zu weit aus dem Fenster gelehnt.
Ein Sprung zurück: Nach Beendigung seines Studiums an der Berliner militärärztlichen Bildungsanstalt 1847 wurde der junge Arzt von der Preußischen Regierung beauftragt, die Ursachen einer Flecktyphusepidemie in Oberschlesien zu untersuchen. Bereits während seiner Ausbildung an der Akademie hatte er die alteingesessenen Militärärzten ein ums andere Mal gehörig vor den Kopf gestoßen. In Briefen an seinen Vater beklagte sich Virchow, da seiner Meinung nach „nichts ordentlich untersucht ist, alles muss man selbst und von vornher wieder selbst durcharbeiten, und das ist so viel, dass man manchmal wirklich den Mut verliert“.41 Haeckel erinnerte sich auch an eine Anekdote, von der ihm der Arzt immer wieder erzählt hatte. Bei der Geburtstagsfeier des Gründers des Friedrich-Wilhelms-Institut 1845 hielt Virchow eine flammende Rede „Über das Bedürfnis und die Richtigkeit einer Medicin vom mechanistischen Standpunkt“ und löste damit eine kleine Revolution aus. Es sei eine ungeheuerliche Anmaßung gewesen, dass sich ein so junger und unerfahrener Arzt gegen die vorherrschende Naturphilosophie Schellings und Hegels42 stellte. Virchow vertrat selbstbewusst seine Ansichten einer Medizin auf der Grundlage von Mechanik und Physik, was zwar eine interessante Innovation war, jedoch damals auf wenig Gegenliebe stieß. Seiner wissenschaftlichen Karriere konnte das noch keinen Schaden zufügen, auch weil Virchow sich gerade mit der Herausgabe des „Archivs für pathologische Anatomie und Physiologie und für klinische Medizin“ einen Namen gemacht hatte.
Nach der Beauftragung durch die preußische Regierung packte er umgehend seine Sachen, um sich auf den Weg zu machen. In Oberschlesien wurde er alsdann mit der „Sozialen Frage“ konfrontiert. Überall sah er die Folgen von Volkselend und ausbeuterischen Arbeitbedingungen in den Fabriken. Ganze Familien konnten ihre Kinder nicht ernähren, Krankheiten entwickelten sich zu Seuchen. Doch aus der Sicht Preußens gehörte dies zum normalen Lauf der Industrialisierung, den man weder aufhalten wollte noch konnte. Virchow, der sehr neugierig auf die Erfahrung in Oberschlesien gewesen war, war schockiert. Das erlebte Elend machte ihn wütend. Irgendwer musste für die Menschen dort doch eintreten. In seinem abschließenden Bericht legte er der Regierung eine „volle und unumschränkte Demokratie“ sowie „Bildung mit ihren Töchtern Freiheit und Wohlstand“ ans Herz, da dies seiner Meinung nach der einzige Ausweg aus der gesellschaftlich verschuldeten Krankheit des Volkes sei. Virchow charakterisierte die Epidemie in Oberschlesien als künstliche Seuche, geschaffen durch die gesellschaftlichen Umstände, an denen die Regierung ihre Mitschuld trage.43 Dies war eine ungeheuerliche Anschuldigung zum damaligen Zeitpunkt und dann auch noch durch einen von der Regierung beauftragten Arzt. Es war eine höchst explosive Behauptung, die Virchow da vorbrachte. Wie konnte ein Angestellter des Preußischen Staates so unverfroren in die Hand beißen, die ihn eigentlich füttern wollte? Doch wirklich ernst genommen wurden seine Schlussfolgerungen aus der Untersuchung der Epidemie nicht. Zudem konnte man auch gar nicht „angemessen“ reagieren, da in Berlin bereits ganz andere Dinge drunter und drüber gingen. Kaum war Virchow nach Berlin zurückgekehrt, wurde er sofort von den Ereignissen um die Märzrevolution aufgesogen, die bereits seit dem 6. März 1848 in Berlin brodelten.
Doch die Forderungen nach einem einheitlichen, parlamentarischen Nationalstaat als auch der Lösung der Sozialen Frage ließen Virchow gerade nach den Erlebnissen in Oberschlesien nicht unberührt. Er ging selbst auf die Barrikaden und schlug sich auf die Seite der radikalen Linken. Im Zuge dieser Verwicklungen wurde für Virchow die Forderung nach einer Lösung der sozialen Missstände und der Beginn eines „sozialen Zeitalters“ immer wichtiger. In seiner eigenen Wochenzeitschrift „Die medicinische Reform“, die er zusammen mit dem befreundeten Psychiater Rudolf Leubuscher kurze Zeit herausgab, forderte er u.a. eine einheitliche medizinische Gesetzgebung, ein Reichsministerium für die öffentliche Gesundheitspflege und eine radikale Reform des Gesundheitswesens. Sein anfänglich ausschließlich medizinisches Glaubensbekenntnis ging immer stärker in seinen politischen und sozialen Überzeugungen auf. „Wer kann sich darüber wundern, dass die Demokratie und der Sozialismus nirgend mehr Anhänger finden, als unter den Aerzten? Dass überall auf der äussersten Linken, zum Theil an der Spitze der Bewegung, Aerzte stehen? Die Medicin ist eine sociale Wissenschaft, und die Politik ist weiter nichts, als Medicin im Grossen.“44 Virchow kämpfte für seine Ideen und er fand eine Vielzahl von Mitstreitern, die er im Laufe der Zeit immer und immer wieder motivieren konnte, sich auf seine Seite zu schlagen und seinem „sozialen Zeitalter“ anzuschließen. Trotz allem Enthusiasmus erwiesen sich seine ersten politischen Unternehmungen jedoch zunächst als Fehlschläge und Virchow, bereits unbeliebt durch seinen Oberschlesien-Report, hatte nun den Bogen gehörig überspannt. Das hauptstädtische Pflaster wurde ihm entschieden zu heiß. Man hatte ihm bereits sein Amt als Prosektor an der Charité45 entzogen und so nahm er dankbar den Ruf an die Universität in Würzburg an.
Auch sein Beginn in Würzburg, Haeckel konnte sich nur zu gut daran erinnern, war nicht ganz so einfach, wie erwartet. Als er im November 1849 seine Arbeit am Juliusspital aufnahm, war sein Ruf ihm bereits vorausgeeilt und man beäugte den Rebellen aus Berlin äußerst kritisch. Bevor man ihn anstellte, musste er versichern, dass er „bei sich etwa ergebener Gelegenheit nicht auch Würzburg zum Tummelplatz seiner früheren kundgebenden radikalen Tendenzen“46 machen würde. Virchow gelobte keine radikalen oder revolutionären Ausbrüche, sondern versprach: „Ich habe keine Absichten, Politiker der Profession zu werden. – Bis jetzt habe ich keinen politischen Ehrgeiz“.47
In seinen „sieben fetten Jahren“ in Würzburg schuf Virchow den größten Teil seines gesamten medizinischen Vermächtnisses. Er gab 1851 die „Jahresberichte über die Leistungen und Fortschritte der gesammten Medicin“ heraus, sowie vier Jahre später das „Handbuch der speciellen Pathologie und Therapie“, welches die Grundidee der modernen Medizin prägte, dass Krankheiten allein auf der Störung von Körperzellen basieren und Zellen somit die kleinsten autonomen Einheiten des gesunden und kranken Lebens sind. Sein medizinisches Werk war vollbracht. Die Jahre in Würzburg hatten ihn zu einem allseits anerkannten Pathologen und Professoren mit einem hoch angesehenen Kollegium gemacht. Seine Studenten verehrten ihn für seinen Forschergeist und seine modernen politischen Auffassungen, die er natürlich auch weiterhin nicht verschwieg, wenn er sie auch nicht so offen zu Schau trug, wie in Berlin. Nur hin und wieder ließ er sich noch zu kleinen politischen Spitzen hinreißen. In Haeckels Augen wurde er zum Prototyp eines objektiven, sachlichen und nüchternen Wissenschaftlers. In einem Brief an seine Eltern schrieb der Assistent: „Kann Virchow wohl je so eines entzückenden Genusses sich erfreuen wie ich ihn so oft in meiner subjektiven Naturbetrachtung, sei es einer schönen Landschaft oder eines allerliebsten Tierchens oder einer niedlichen Pflanze genießen? Sicher nicht! Auch müsste es schrecklich auf der Welt sein, wenn alle Männer so nüchtern und verständig wären […].“48 Auch an die Verbohrtheit und die stoische Gelassenheit, mit der sich Virchow der Dinge annahm, konnte sich Haeckel nur zu gut erinnern. Schließlich widersprach dieser Wesenszug des Professors seinem eigenen von Grund auf. Vermutlich wurden sie deshalb auch nie richtig warm miteinander. Dennoch hoffte Haeckel, dass eben diese Eigenschaften des Arztes irgendwann auch auf sein eigenes hitziges, unruhiges und emotionales Gemüt abfärben würden. „Alles sieht er so fabelhaft ruhig, ungerührt und objektiv passiv an, daß ich seine [Virchows] außerordentliche stoische Ruhe und Kaltblütigkeit täglich mehr bewundern lerne und bald ebenso hoch schätzen werde wie die außerordentlich klare Schärfe seines Geistes und den Überfluß seines Wissens. Wenn er meinem überschäumenden Sprudelgeist nur etwas abgeben könnte.“49 Und obwohl Haeckel Virchows Distanz und Gefühlskälte immer sehr bedauerte und in seinen Briefen auch oft kritisierte, lobte er vor jedermann die „göttliche Ruhe, seine Kälte und Konstanz mit der er [Virchow], immer gleich bleibend, alle Dinge höchst objektiv und klar auffasste.50 Gerühmt wurde er außerdem von seinen Studenten für seine Gradlinigkeit und seine Fähigkeit, Kritik an seiner Person zu respektieren.
1856 bat man ihn, an die Charité in Berlin zurückzukehren. Man wollte dem rebellischen Arzt von damals eine weitere Chance geben, nun, da er einiges an Bekanntheit erlangt hatte. Außerdem war die Revolution von 1848 jetzt eine geschlossene Akte. Die Monarchie war wieder gefestigt und man war sich sicher, dass Virchow sich seine revolutionären Hörner endlich abgestoßen hatte. Zu diesem Zweck schuf man ihm und seinen Mitarbeitern ein eigenes Pathologisches Institut an der Charité. Bereits zwei Jahre später konnte er vor den Berliner Ärzten seine Vorlesung über „Die Cellularpathologie in ihrer Begründung auf physiologischer und pathologischer Gewebelehre“ halten, aus welcher noch im selben Jahr sein weltbekanntes Werk: „Die Cellularpathologie“ hervorging. Mit diesem innovativen Konzept prägte er eine vollkommen neue Krankheitslehre. Zudem war der sture Arzt ein leidenschaftlicher Sammler pathologischanatomischer Präparate. Virchow bezeichnete sie als sein „liebstes Kind“, denn für ihn waren sie eine Dokumentation des erreichten Wissensstandes seines Fachgebietes. Inspiriert durch britische Ärzte, die ebenfalls medizinische Präparate sammelten, wollte er seine Sammlung vergrößern und ausbauen, um sie später auch der Öffentlichkeit vorführen zu können. Sein aufklärerischer Gedanke hinter dieser Anhäufung von Feucht- und Trockenpräparaten war so einfach wie einleuchtend: Er wollte der breiten Bevölkerung das Wissen und Verständnis um Gesundheit und Krankheit anschaulich machen, denn dies war in seinen Augen ein wesentlicher Bestandteil der menschlichen Kultur. Heute ist das eine der natürlichsten Vorstellungen der Welt. Zu Virchows Zeiten war die Verbreitung von Wissen innerhalb der ungebildeten und unterprivilegierten Öffentlichkeit jedoch ein Novum. Wissen stand bis dato nur den Bevölkerungsschichten zu Verfügung, die es sich leisten konnten, Universitäten zu besuchen. Die Fabrikarbeiter aus Oberschlesien zählten nicht dazu.
Die anfängliche Sammlung der Charité bestand aus 1.500 Objekten und reichte Virchow bei weitem nicht aus. Sein erklärtes Ziel war es, jede damals bekannte Krankheit mit einem charakteristischen Präparat darzustellen. So wuchs die Sammlung innerhalb von rund 30 Jahren auf 19.000 Präparate an. Virchow, überzeugt von der Notwenigkeit dieser Sammlung, ersuchte um den Bau eines eigenen Museums für seinen Schatz und fand erstaunlich schnell Zustimmung. Bereits 1899 weihte er sein Museum an der Charité ein. Auf fünf verschiedenen Etagen drängten sich fast 21.000 Präparate dicht an dicht. Lange nach Virchows Tod und kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges war die Präparatensammlung auf 26.000 Exemplare angewachsen. Durch zahlreiche Bombenschäden und einen Dachstuhlbrand in den 1950er Jahren wurde die Sammlung medizinischer Präparate jedoch so stark dezimiert, dass man heute nur noch 750 Objekte zeigen kann.
Überhaupt war Virchow ein großer Freund und Förderer von Museen. Seiner engen Freundschaft zu Schliemann ist es zu verdanken, dass dieser seine trojanische Sammlung dem Berliner Völkerkundemuseum schenkte. An dessen Gründung war Virchow 1886 zusammen mit Adolf Bastian, einem Kollegen aus der Berliner Gesellschaft für Anthropologie beteiligt. Das Museum gehört mit seinen über 500.000 Exponaten zu den weltweit bedeutendsten, größten und ältesten Völkerkundemuseen.
Auf den erworbenen Lorbeeren wollte sich Virchow jedoch nicht ausruhen, sondern nahm gleich sein nächstes Ziel in Angriff. Er hatte die „soziale Frage“, die ihn schon zu Beginn seines politischen Wirkens nicht in Ruhe gelassen hatte, nie aus den Augen verloren und gedachte nun, mit neuem Ansehen und stärkerem Rückhalt, erneut einen Vorstoß für eine medizinische Grundversorgung der Bevölkerung zu wagen. Im Juli 1859 ließ er sich in den Berliner Stadtrat wählen, um noch einmal seinen politischen Ansichten Gehör zu verleihen. Sein unermüdliches Streben galt vor allem der Einführung einer öffentlichen Gesundheitspflege. Auch im Kampf um die preußische Verfassung wirkte er entscheidend mit. So gründete er 1861 mit u.a. Theodor Mommsen, Paul Langerhans und Franz Duncker die Deutsche Fortschrittspartei und sah sich fortan als Opposition zu Otto von Bismarck. Konflikte waren in dieser Konstellation vorprogrammiert, denn der eigensinnige Arzt wollte seinen Kurs für das gesellschaftliche Gemeinwohl und für soziale Verantwortung nicht aufgeben. Schon am 2. Juni 1865 brachte ihn sein ungestümer Geist erneut in arge Bedrängnis. In einer Debatte im Preußischen Landtag verglich er Bismarcks Politik mit einem Schiff, dass von allerlei Winden in verschiedenste Richtungen gedrängt werde und zweifelte an der Wahrheitsliebe des Kanzlers.51 Das brachte das Fass für diesen zum Überlaufen. Bismarck forderte Virchow zum Duell heraus. Dank des beherzten Vermittelns durch den Kriegsminister von Roon konnte dieses jedoch mit Müh und Not verhindert werden.
Dennoch blieb Virchow weiter in seiner oppositionellen Rolle und verlieh seinen unnachgiebigen Forderungen beständig Ausdruck. Ihm ging die kriegerische Politik Bismarcks und das Bestreben ständig weitere Kolonien zu erwerben gehörig gegen den Strich. Als einer der wenigen Politiker dieser Zeit war er der Ansicht, dass man zuerst dem eigenen Volk helfen müsse und scheute auch nicht davor zurück, seine Anhänger und Bewunderer für dieses Ziel zu mobilisieren. So setze er sich für die Abrüstung des Reiches zugunsten eines Ausbaus des Verkehrsnetzes, zusätzlicher Kanalbauten und stärkerer Investitionen ins Hochschulwesen ein. 1874 verfasste er den Generalbericht über die Berliner Kanalisation mit dem Resultat, dass bereits drei Jahre später der erste Abschnitt eines neuen Kanalsystems fertig gestellt wurde. Berlin wurde, durch Virchows Beharrlichkeit, die erste europäische Großstadt mit einer Kanalisation mit Rieselfeldern. Es war ein Erfolg für Virchows politische Karriere. Dadurch beflügelt und dem Drängen seiner Freunde nachgebend, ließ sich Virchow 1880 in den Reichstag wählen, obwohl ihm diese „Scheininstitution“ gar nicht gefiel. Viel sinnvoller erschien ihm hingegen der Posten als Vorsitzender der Rechnungskommission des Preußischen Landtags, da er hier eine gewisse Kontrolle über das Parlament ausüben konnte.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.