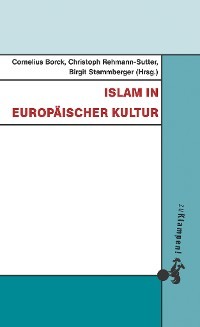Kitabı oku: «Islam in europäischer Kultur», sayfa 2
Der Schleierdiskurs
Der Schleier- oder Kopftuchdiskurs wurzelt in einem kolonialistischen Diskurs. Am Beispiel von Indien vereinfacht ausgedrückt, ging dieser Diskurs so: Die Briten kamen nach Indien und erkannten die Verderbtheit von purdah (Geschlechtertrennung), Witwenverbrennung, Kindesheiraten und weiblichem Infantizid. Vernünftige Inder wiederum erkannten die Überlegenheit der westlichen Kultur sofort und machten sich dank britischer Unterstützung und Anleitung unverzüglich an die dringend notwendige Regeneration ihrer verdorbenen Kulturen. Indische Historiker_innen, wie beispielsweise Lata Mani, haben inzwischen hinlänglich nachgewiesen, dass die Praxis des Sati (Witwenverbrennung), mit welcher die Briten ihre mission civilisatrice und ihre Herrschaft begründeten, unter den bengalischen Hindus von ausgesprochen marginaler Bedeutung war und nur einen winzigen Teil der Bevölkerung überhaupt betroffen hatte.21
Nach dem damaligen britischen Verständnis von Kultur repräsentierte die Viktorianische Mittelklassegesellschaft mit ihren Weltanschauungen, Wertvorstellungen, Sitten und Bräuchen den Gipfel des Evolutionsprozesses schlechthin und damit auch einen zivilisatorischen Höhepunkt. Die viktorianische Frau wiederum war die Verkörperung der idealen Frau. Von diesem Blickwinkel aus legitimierte die britisch-europäische kulturelle Überlegenheit die Dominanz und Unterwerfung der kolonialisierten Völker. Mit ihrer militärischen Unterlegenheit bewiesen die Unterworfenen ihre Inferiorität und bestätigten damit die These der britischen Überlegenheit. Gemäß der kolonialen These waren die kolonisierten Gesellschaften zwar alle minderwertig, differierten aber hinsichtlich ihrer spezifischen Inferiorität. Kolonialer Feminismus respektive Feminismus, welcher gegen andere Kulturen im Dienste des Kolonialismus eingesetzt wurde, stützte sich auf eine Reihe unterschiedlicher Konstruktionen, die auf die jeweilige Kultur zugeschnitten waren, die es zu unterwerfen galt. Das Muster war zwar das gleiche, ob es nun auf Indien, Afrika oder die islamische Welt abzielte, aber die Inhalte waren verschieden. In Indien beispielsweise konzentrierte man sich – wie schon erwähnt – auf das Ritual des Sati, auf welches sich auch Spivak in ihrem Essay Can the Subaltern Speak? bezog.22 In Bezug auf die islamische Welt – für die christlich-abendländische Welt seit den Kreuzzügen der Feind schlechthin – fokussierte man sich auf den Schleier und die Geschlechtertrennung, wobei man auf ein großes Reservoir von Vorurteilen, Falschinformationen und Bigotterie zurückgreifen konnte.
Gemäß Leila Ahmed, Professorin für Women’s Studies an der Harvard University, besagte dieser Diskurs, der kolonialistisches Überlegenheitsdenken mit Feminismus mischte und sich auf die Frau fokussierte, dass der Islam von Grund auf und unveränderbar frauenunterdrückend sei, dass diese Unterdrückung durch die Geschlechtertrennung und den Schleier versinnbildlicht werde und dass darin der Grund für die allgemeine Rückständigkeit der islamischen Welt zu suchen sei. Nur wenn diese Praxis, welche dem Islam inhärent sei (also das Wesen des Islam an sich ausmache), abgeschafft würde, stehe den muslimischen Gesellschaften der Weg in die Zivilisation offen. Die Verschleierungspraxis wurde so zu einem Symbol für die Unterdrückung der Frauen im Islam und für die Rückständigkeit des Islam generell. Und sie wurde zum offen deklarierten Ziel von kolonialen Angriffen und die Speerspitze bei Attacken auf muslimische Gesellschaften.23
Lord Cromer, der von 1883–1907 britischer Generalkonsul in Ägypten war, scheute sich nicht zu behaupten, das Christentum lehre im Unterschied zum Islam den Respekt gegenüber Frauen, weswegen christliche europäische Männer die Frauen erhöhen würden. Der Islam hingegen degradiere Frauen. Für Cromer war es deshalb unbedingt notwendig, dass die ägyptischen Männer überzeugt oder notfalls gezwungen werden müssten, sich dem wahren Geist westlicher Zivilisation zu öffnen und diesen in sich aufzunehmen. Nur wenn sie diese schändliche Verschleierungspraxis aufgäben, wären sie zur geistigen und moralischen Höherentwicklung fähig, welche Cromer sich für sie vorgeblich wünschte. Doch allem Gerede von der Erhöhung der muslimischen Frauen zum Trotz war die Politik Cromers für einen Großteil der ägyptischen Frauen eine Katastrophe: Die Briten schränkten den Zugang zu den öffentlichen Schulen ein, indem sie die Schulgebühren drastisch erhöhten. Dies wirkte sich vor allem auf die Möglichkeit des Schulbesuchs von Mädchen aus. Auch die Ausbildung von Medizinerinnen wurde verunmöglicht. Frauen konnten nicht mehr wie bisher eine zwar von den Männern getrennte, aber doch gleichwertige Ausbildung zur Ärztin absolvieren, sondern allenfalls noch Hebamme werden. Sie verloren auch ihre Geschäftsfähigkeit in finanziellen Angelegenheiten, etwa das Recht auf Beteiligung an Banken und Finanzinstitutionen, und konnten auch nicht mehr selbständig vor Gericht auftreten. Zudem wurden ihnen unter englischem Recht etliche ihrer vom Islam garantierten Rechte genommen, zum Beispiel der Erbanspruch.24 Dass derselbe Lord Cromer, dem das Wohl muslimischer Frauen angeblich so sehr am Herzen lag, zuhause in England zu den führenden Gegnern des Frauenstimmrechts gehörte und die Men’s League for Opposing Women’s Suffrage nicht nur mitbegründete, sondern zeitweise auch präsidierte, passt zwar ins Bild, steht aber auf einem anderen Blatt.
Cromer hat seine Thesen vor über hundert Jahren formuliert. Aber seine Argumentation ist erstaunlich aktuell. In einem Interview mit dem amerikanischen Soziologen David Jacobson, das 2013 im Zürcher Tages-Anzeiger veröffentlicht wurde, heißt es: »Die Stellung der Frau ist der Lackmustest. Je schlechter der Status von Frauen, desto gefährlicher ist dieses Land. Nicht nur für die Frauen, die dort leben. Sondern für die ganze Welt.«25
Die Diskussionen um Minarette, die in der Schweiz 2009 zu dem erwähnten Minarettverbot führten, folgten exakt diesem Schema: Ausgerechnet die Schweizerische Volkspartei SVP und andere Rechtspopulisten, die sich sonst keinen Deut um Frauenrechte scheren, wie ein Blick auf ihre Abstimmungsparolen betreffend Mutterschutzregelungen oder der Lohngleichheit von Mann und Frau zeigen, mutierten zu Kämpfern für die Rechte der unterdrückten muslimischen Frauen in der Schweiz. Die angebliche Unterdrückung der Frauen im Islam diente also als wohlfeiler Vorwand für ein Verbot von Minaretten. Noch erstaunlicher war es, dass Feministinnen wie Alice Schwarzer oder Julia Onken ins gleiche Horn stießen. Für Schwarzer und Konsorten symbolisiert das Kopftuch, der Hijab, die Rückständigkeit des Islam und der muslimischen Gesellschaften generell. Argumente von Frauen und ihre Motive, ein Kopftuch zu tragen, nahmen sie nicht zur Kenntnis. Sie bestätigten damit den Verdacht, dass es bei ihrem Engagement weder um Empathie mit ihren muslimischen Schwestern noch um Feminismus im Sinn von Gleichberechtigung und weiblicher Selbstbestimmung geht, sondern um die Anmaßung einer Deutungshoheit als Ausdruck eines hegemonialen westlichen Denkens. In einem offenen Brief schrieb Julia Onken im Vorfeld der Minarettabstimmung unter anderem: »Der Koran, der für Moslems als Gesetzesquelle gilt, schreibt frauenfeindliche und Frauen verachtende Regeln vor, z. B. Verhüllung des ganzen Körpers, außer Hände und Gesicht. Zwangsheirat. Ehrenmord.« Diese Äußerungen von Onken blieben zwar nicht unwidersprochen. In einer Stellungnahme des Interreligiösen Think-Tank hieß es an die Adresse von Onken gerichtet: »Sie können selbstverständlich für die Annahme der Minarettverbotsinitiative werben. Sie können sich aber nicht zugute halten, damit gegen die Unterdrückung von muslimischen Frauen zu kämpfen. Im Gegenteil. Zudem ist dies eine neue Art der Bevormundung durch ChristInnen, diesmal im Namen der Frauenbefreiung.«26 Am Ausgang der Abstimmung änderte dies freilich nichts. Das Plakat, welches die multiple Bedrohung der Schweiz durch den Islam und/oder die Muslime suggeriert, wurde zudem ein gefragter Exportartikel für rechtspopulistische Kreise in ganz Europa für ihre Propaganda gegen die muslimische Minderheit.

Abb. 1 Wahlplakat der SVP (Schweizerische Volkspartei) des Kantons Aargau, 2009

Abb. 2 Wahlplakat der SVP (Schweizerische Volkspartei) anlässlich der Abstimmung für ein Minarettverbot, 2009
Der Schleierdiskurs in der Schweiz
In der Schweiz wie auch im übrigen Europa ist die Muslimin mit Kopftuch zum Symbol für Fremdheit geworden. Nach Birgit Rommelspacher liegt eine der Provokationen des islamischen Kopftuchs unter anderem darin, dass es das westliche Emanzipationskonzept infrage stellt und seine Selbstverständlichkeit zurückweist.27 Dazu gehört beispielsweise die Geschlechtertrennung: Die muslimische Frau mit Kopftuch signalisiere eine eindeutige Verschiedenheit der Geschlechter. Diese Frage sei im westlichen Feminismus bisher ungeklärt geblieben. Allgemein gehe man zwar davon aus, dass es nur eine Frage der Zeit sei, bis die Tatsache, einem bestimmten Geschlecht anzugehören, keine gesellschaftliche Relevanz mehr habe. Andererseits werde aber die Grenzziehung zwischen den Geschlechtern in der Erwerbssphäre ebenso wie im privaten Bereich vielfach aufrechterhalten. Indem die muslimische Frau mit Kopftuch eindeutig die Verschiedenheit der Geschlechter betone, berühre sie einen allergischen Punkt in der westlichen Debatte.
Die muslimische Frau mit Kopftuch sei auch ein Symbol für gelebte Religiosität. Dies wiederum tangiere Konflikte einer Gesellschaft, die sich einerseits als säkular begreife und andererseits das Christentum oder doch wenigstens christliche Werte als für sich bestimmend erkläre. Diese inkohärente Haltung wird am Beispiel der aus Afghanistan stammenden muslimischen Lehrerin Fereshta Ludin deutlich: Ihr wurde vom Land Baden-Württemberg das Tragen eines Kopftuchs im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit verboten. Einmal wurde das Verbot damit begründet, dass Ludin (als bekennende Muslimin) ihre Schülerinnen und Schüler nicht nach christlichen Grundsätzen unterrichten und erziehen könne, wie das in der baden-württembergischen Landesverfassung vorgesehen sei. Im anderen Fall begründete das Mannheimer Verwaltungsgericht das Verbot damit, dass mit dem islamischen Kopftuch die Neutralitätspflicht von Beamt_innen verletzt werde.
In der Schweiz ist das Kopftuch seit 1996 ebenfalls aktenkundig. Den Anfang machte das Schweizerische Bundesgericht, welches in einem Entscheid von 1996 eine Anordnung der Genfer Behörden schützte, die einer zum Islam übergetretenen Primarschullehrerin untersagt hatten, im Unterricht ein Kopftuch zu tragen. Das Bundesgericht erachtete das Tragen des Kopftuchs als unvereinbar mit der staatlichen Neutralitätspflicht. Dabei legte es Wert darauf, dass es sich bei der Lehrerin um eine Person handelte, die als Vertreterin des Staates auftritt. In ihrer Funktion habe sie gegenüber den ihr anvertrauten Kindern – namentlich in der Unterstufe – eine besondere Autoritätsstellung und könne die Kinder durch ihr Verhalten beeinflussen. Unter solchen Umständen sei die staatliche Neutralitätspflicht gegenüber dem Grundrecht der Lehrerin auf Religionsfreiheit, welches das religiös motivierte Tragen bestimmter Kleidungsstücke einschließt, stärker zu gewichten. Bemerkenswert an diesem Urteil ist die Tatsache, dass die Lehrerin längere Zeit mit Kopftuch unterrichtet hatte, ohne dass es zu irgendwelchen Klagen von Seiten der Eltern gekommen war. Geklagt hatte eine unbeteiligte Drittperson.
Ebenfalls unbeantwortet bleibt die Frage, wie sich die staatliche Neutralitätspflicht zu den Zielsetzungen von Volksschulgesetzen verhält, beispielsweise zu Artikel 2 des Volksschulgesetzes des Kantons Zürich, wo es ausdrücklich heißt: »Die Volksschule erzieht zu einem Verhalten, das sich an christlichen, humanistischen und demokratischen Wertvorstellungen orientiert. Dabei wahrt sie die Glaubens- und Gewissensfreiheit und nimmt auf Minderheiten Rücksicht.«
Im Kanton Tessin haben die Stimmberechtigten im Herbst 2013 einer kantonalen Initiative zugestimmt, die ein »Vermummungsverbot im öffentlichen Raum« vorsieht. Um das Diskriminierungsverbot zu umgehen, orientierten sich die Initiant_innen am französischen Beispiel und strebten ein »allgemeines Verhüllungsverbot« an. Im Vorfeld der Abstimmung war aber offensichtlich, dass es dabei ausschließlich um die Burka ging.

Abb. 3 Der ehemalige Journalist und Politiker Giorgio Ghiringhelli auf Stimmenfang anlässlich der Initiative für ein Burkaverbot im Kanton Tessin © Ti-Press
Bisher wurden im Tessin allerdings keine dort ansässigen Burkaträgerinnen gesichtet. Wie schon die Minarettinitiative will auch die Burkainitiative ein Problem lösen, das als solches gar nicht existiert. Eine Zielscheibe für die Vorstöße gibt es aber sehr wohl, nämlich die muslimische Bevölkerung in der Schweiz als Ganzes. Die Kopftuch- und Burkadiskussion entwickelt sich in der Schweiz mehr und mehr zu einer Debatte, die gegen eine Minderheit gerichtet ist, wie es die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus (EKR) in ihrer Stellungnahme vom Juni 2011 gegen ein Kopftuchverbot an Schulen ausgeführt hat. Alle Maßnahmen, Gesetze und Erlasse, die allein gegen den Islam als Religion und die Muslime als religiöse Minderheit gerichtet seien, verletzten nach Meinung der EKR die Grundrechte, hier insbesondere die Glaubens- und Gewissensfreiheit, das Diskriminierungsverbot, das Rechtsgleichheitsgebot und das Recht auf allgemeine Religionsfreiheit. Gegen den Islam gerichtete »Sonderrechte« seien verfassungswidrig. Zudem würden sie eine andauernde muslimfeindliche Stimmung in der Bevölkerung begünstigen und so dem Ziel eines friedlichen Zusammenlebens schaden.28
In der polemisch aufgeladenen Diskussion um Kopftuch und Burka wird man jedenfalls den Eindruck nicht los, dass die Verschleierung nicht so sehr ein Problem der Musliminnen ist, sondern vor allem ein Problem der westlichen Gesellschaft, oder wie es die pakistanische Psychoanalytikerin Durre Ahmad formulierte: »The West is infatuated with the veil.«29 Ein Blick in die Medienlandschaft, in welcher sich nicht nur Boulevardmedien, sondern auch seriöse Tageszeitungen wie der Tages-Anzeiger oder Die Zeit seitenweise den verschiedenen Typen islamischer Frauenbekleidung und Kopfbedeckungen inklusive Abbildungen widmen, bestätigt ihre Diagnose. Hijab, Niqab, Burka oder Khimar gehören plötzlich zum alltäglichen Wortschatz einer Gesellschaft, die ansonsten vom Islam so gut wie keine Ahnung hat.
Es geht bei der ganzen westlichen Debatte um Frauen in den islamischen Gesellschaften daher auch nicht so sehr darum, eine tatsächliche oder vermeintliche Unterdrückung zu bekämpfen und zu eliminieren, sondern vielmehr darum, diese immer wieder von Neuem festzustellen. Es ist auch viel bequemer, die eigenen Unzulänglichkeiten in Sachen Gendergerechtigkeit – Stichworte Lohndiskrepanz, Zugang zu Leitungsfunktionen, Sexismus – zu verdrängen und auf die Anderen zu projizieren.
Das Gleiche gilt mit umgekehrten Vorzeichen allerdings auch für die Gegenseite. Teile der muslimischen Gemeinschaft sind nur allzu sehr geneigt, den freien Umgang der Geschlechter und die herrschende Promiskuität in der westlichen Gesellschaft als unumstößlichen Beweis für deren moralische Verkommenheit und Dekadenz zu werten. Auch hier werden die eigenen Defizite in Sachen Gendergerechtigkeit verdrängt und auf die Anderen projiziert. Was bei den einen Rückständigkeit ist, ist bei den anderen moralischer Verfall. Diese Projektionen versperren allerdings nicht nur eine realistische Sicht auf das Andere, sondern ebenso sehr eine kritische Sicht auf das Eigene.
Die öffentlichen Debatten über Muslim_innen folgen zunehmend einem Muster, welches der französische Islamwissenschaftler Olivier Roy als »Neoethnisierung« bezeichnet. Er meint damit die Konstruktion einer muslimischen Gemeinschaft (community) von innen und außen, vergleichbar mit der Konstruktion von ethnischen Gemeinschaften: »construction of an ethnic group which previously did not exist as such«.30 Dieser Prozess geht einher mit der Abwertung der regionalen bzw. ethnischen Wurzeln. Die Herkunftskultur ist nicht länger relevant, sondern wird ersetzt durch den Bezug auf eine neu konstituierte Gruppe: nämlich die Gemeinschaft der Muslime. Die Zugehörigkeit zu dieser Gemeinschaft werde als unabhängig vom Glauben und den religiösen Praktiken des Menschen gesehen. Vielmehr richte sie sich nach einem »set of cultural patterns that are assumed to be inherited«.31
Diese Neoethnisierung betrifft aber nicht nur die Muslime: Eine Studie von Janine Dahinden, Professorin für Transnational Studies an der Universität Neuchâtel, zur Bedeutung von Religion und Ethnizität in Bezug auf Praktiken, Identitäten und Grenzziehungen zeigt, dass Religion im Kontext von Migration vor dem Hintergrund mangelnder gesellschaftlicher Anerkennung oder gar Diskriminierung nicht selten eine kompensierende Funktion haben kann. Aber auch mit Blick auf die Mehrheitsbevölkerung besagt das Fazit der Studie, dass Religion, ungeachtet der Tatsache, dass sie im Lebensalltag eine eher untergeordnete Rolle spielt, jedoch auch bei Jugendlichen im Sinne der sozialen Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft von großer Bedeutung ist. Eine solche Zugehörigkeit ist gleichbedeutend mit einer spezifischen Position im sozialen Raum. Das zeigt sich beispielsweise daran, dass Jugendliche angaben, ihre Religion später an die Kinder weiterzugeben, auch wenn sie selber nicht religiös waren. Es geht dabei auch nicht in erster Linie um Weitergabe von religiösen Inhalten wie Glaubensvorstellungen oder religiöse Praktiken, sondern primär um die Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Zu einer ›etablierten‹– das heißt protestantischen oder katholischen – Religion zu gehören, hat zur Folge, dass man die Reihen gegenüber Neuzugezogenen schließt. Die Etablierten bemühen sich, ihre gesellschaftliche Stellung zu halten und zu verbessern, indem sie versuchen, ihr ›Etabliert-Sein‹ weiterzugeben. Es geht um Grenzziehungsprozesse. Postulierte und positiv aufgeladene Offenheit und Toleranz und ein multireligiös und plurikultureller Schul- und Lebensalltag schließen also eine Grenzziehung entlang ethnischer und religiöser Kategorien nicht aus. »In der Schweiz lebende KosovoalbanerInnen und MuslimInnen werden von einer grossen Mehrheit kategorisch als ›anders‹ wahrgenommen und gegenüber SchweizerInnen und ChristInnen als moralisch minderwertig abgewertet.«32 Das bedeutet, dass der ›Fremdheitsdiskurs‹ auch in der nächsten Generation weitergehen wird und damit ebenso die daraus resultierende potenzielle Diskriminierung von Muslim_innen.
Zum Muslim gemacht werden
Es versteht sich von selbst, dass die Wahrnehmung ihrer Religion und Kultur durch die Mehrheitsgesellschaft insbesondere für die Identitätsbildung der jungen Muslim_innen Konsequenzen hat. Die Mediendiskurse zum Thema ›Wir und die Muslime‹, das weit verbreitete und gesellschaftlich akzeptierte Klischee vom Islam als gewalttätiger, blindwütiger und vernunftwidriger Religion der Unfreiheit sowie das Gefühl, permanent unter Verdacht zu stehen, sind nicht gerade hilfreich für den Aufbau einer positiven muslimischen Identität. Sie führen letztlich zu einer apologetischen und polemischen Haltung. Apologetisch, weil sich die Muslime gegen die Unterstellungen und Verdächtigungen verteidigen müssen, polemisch, weil sie dabei dazu neigen, Vorwürfen auszuweichen oder sie zurückzugeben, statt die Diskussion auf einer inhaltlichsachlichen Ebene zu führen.
Der gesamte Diskurs um Muslim_innen in Europa zeigt, dass die Bedeutung religiöser Zugehörigkeit derzeit deutlich steigt. Die Etablierung von Identitäten, die eine religiöse Zuordnung außer Acht lässt, scheint dabei für Migrant_innen und ihre Nachkommen aus mehrheitlich muslimischen Ländern kaum mehr möglich. »Die von muslimischer und nicht-muslimischer Seite betriebene Konstruktion der Gruppe der Muslime führt zu Selbst- und Fremdwahrnehmung in den gegensätzlichen Kategorien ›Ihr‹ und ›Wir‹, ›unsere Gemeinschaft‹ und ›eure Gemeinschaft‹ auf beiden Seiten. Andere Identitäten, wie soziale, berufliche, lokale oder nationale scheinen weniger wichtig und durch die (teils lediglich angenommene) religiöse Zugehörigkeit in den Hintergrund gedrängt.«33 Die Publizistin Hilal Sezgin hat in einem Interview für das Recht plädiert, über die eigene Religion zu schweigen, also nicht ständig als Mitglied einer bestimmten Religion angesprochen zu werden oder sich erklären zu müssen. Das Recht, selbst zu bestimmen, in welchen Kontexten die eigene Religionszugehörigkeit von Bedeutung ist und wann nicht.34
Zusammenfassend lässt sich zur Frage »Wie öffentlich darf Religion sein?« Folgendes feststellen: Erstens steht der Zugang zum öffentlichen Raum nicht allen in gleichem Maße offen. Zweitens ist der Konflikt zwischen Christentum bzw. dem christlichen Abendland und der islamischen Welt bzw. dem Islam ein uralter, dessen Zerrbilder jederzeit reaktiviert werden können. Drittens bildet die Genderfrage spätestens seit der kolonialen Epoche die Projektionsfläche für einen andauernden Fremdheitsdiskurs. Und viertens ist – last but not least – der Kampf um die Deutungshoheit in Sachen Islam, Muslime und muslimischer Identität in vollem Gange: Einerseits unter den Muslimen selber, andererseits aber auch von Seiten der Mehrheitsgesellschaft. Die Mehrheitsgesellschaft und ihre Institutionen nehmen massiv Einfluss auf diesen Prozess. Was heißt, dass sich der Islam und die Muslime im Europa von morgen nicht im Reagenzglas unter Laborbedingungen entwickeln. Sie sind in hohem Maße abhängig von gesellschaftspolitischen und soziopolitischen Einflüssen. Dadurch stehen Staat und Gesellschaft, aber auch die Medien in einer Verantwortung, der sie sich weit stärker als bisher bewusst sein sollten.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.