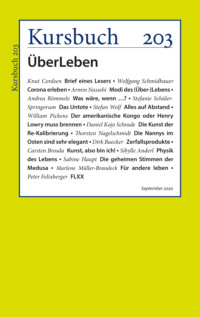Kitabı oku: «Kursbuch 203»
Inhalt
Armin Nassehi Editorial
Knut Cordsen Brief eines Lesers (30)
Wolfgang Schmidbauer Corona erleben Ein notwendiger Zwischenruf
Armin Nassehi Modi des (Über-)Lebens Passen wir überhaupt in diese Welt?
Andrea Römmele Was wäre, wenn …? Drei Szenarien zum Überleben der Demokratie
Stefanie Schüler-Springorum Das Untote Warum der Antisemitismus so lebendig bleibt und ist
Stefan Wolf Alles auf Abstand Eine konsumkritische Einmischung
William Pickens Der amerikanische Kongo oder Henry Lowry muss brennen
Daniel Kojo Schrade Die Kunst der Re-Kalibrierung Alltäglichen Rassismus überleben
Thorsten Nagelschmidt Die Nannys im Osten sind sehr elegant
Dirk Baecker Zerfallsprodukte Perspektiven einer soziologischen Theorie
Carsten Brosda Kunst, also bin ich! Ein Gespräch mit Peter Felixberger und Armin Nassehi
Sibylle Anderl Physik des Lebens Reflexionen kosmischen Ausmaßes
Sabine Haupt Die geheimen Stimmen der Medusa Wie Frauen in der Wissenschaft überleben
Marlene Müller-Brandeck Für andere leben Möglichkeitsräume aktueller Care-Arbeit
FLXX Schlussleuchten von und mit Peter Felixberger
Autorinnen und Autoren
Impressum
Armin Nassehi
Editorial
Leben oder Überleben – das könnte einen Unterschied ausmachen, den Unterschied zwischen ob überhaupt und wie. Oder es geht generell übers Leben – als biologisches, als psychisches, als soziales, als kulturelles, als logisches Problem. Die Beiträge dieses Kursbuchs versammeln all diese unterschiedlichen Perspektiven aufs ÜberLeben. Im Gespräch erklärt der Hamburger Kultursenator Carsten Brosda die Überlebensbedingungen der Kultur in schwierigen Zeiten, Wolfgang Schmidbauer lotet aus, wie sehr sich die Wertigkeit und Bedeutung des Überlebens über die unterschiedlichen Krisen verändert hat, Andrea Römmele sorgt sich um das Überleben der Demokratie, Sabine Haupt um das der Frauen in der Wissenschaft, und Marlene Müller-Brandeck vergleicht familiale und palliative Formen der Sorge ums Überleben. Mein eigener Beitrag macht auf die gesellschaftlichen Bedingungen des Überlebens aufmerksam. Stefan Wolf macht sich aus Anlass der Corona-Krise Gedanken um den Stellenwert des Konsums.
Warum überlebt der Antisemitismus in so unterschiedlichen Kontexten? Das ist die Grundfrage des Beitrags von Stefanie Schüler-Springorum, den man parallel zu William Pickens Bericht über einen angekündigten Lynchmord lesen sollte. Pickens war ein amerikanischer Bürgerrechtler, Linguist und Journalist, dessen Text der 1934 erschienenen, legendären Anthologie Negro von Nancy Cunard entnommen ist, die gerade, herausgegeben und ins Deutsche übersetzt von Karl Bruckmaier, in der kursbuch.edition erschienen ist. Der Antisemitismus und der Rassismus sind die offenen Wunden einer Moderne, die jedem Individuum das Recht auf Leben und Strukturen des Überlebens garantiert, aber selbst Ausnahmen schafft, die geradezu eine Dementierung ihrer eigenen Versprechen sind – bis heute.
Dirk Baeckers Beitrag setzt grundlegender an, indem er das Ereignishafte sowohl des sozialen als auch des psychischen Geschehens und das Überleben als zeitliche Form nicht kontrastiert, sondern systematisch in Beziehung setzt. Und noch grundlegender geht es bei Sibylle Anderl zu, die nach den Bedingungen des Lebens im Universum sucht, nicht um sich von unserem Leben zu entfernen, sondern um die Frage danach stellen zu können, warum es überhaupt Leben auf der Erde gibt.
Besondere Aufmerksamkeit verdienen die Beiträge von Thorsten Nagelschmidt und Daniel Kojo Schrade. Nagelschmidt inszeniert literarisch sehr eindringlich die Situation in Chile zwischen Protest und einem autoritären Staat, zwischen sozialer Ungerechtigkeit und dem Versuch, darin zu überleben – buchstäblich und überhaupt. Der Text – als Gespräch junger Chilenen gestaltet – fesselt. Nicht weniger eindringlich sind die Bilder des Künstlers Daniel Kojo Schrade, denen als Echos kurze Textpassagen gegenübergestellt sind. Sie berichten von Episoden, in denen Schrade die Versuche des Überlebens in alltäglichen Rassismuserfahrungen in ihrer Brutalität und Banalität darstellt. Beides, die literarische und bildlich-textliche Form sind von einer Intensität, die dieses Kursbuch sehr bereichern.
Den Schluss bildet wieder Peter Felixbergers Kolumne FLXX, diesmal mit einem Stück über Komplexität, unter anderem aus der Perspektive von Ameisen betrachtet. Und den Anfang macht mit dem 30. Brief eines Lesers Knut Cordsen. Vielen Dank dafür.
Knut Cordsen
Brief eines Lesers (30)
Auch das Kursbuch ist eines: ein Überbleibsel. Ein »Überlebsel«, wie man einst das englische Wort »survival« eindeutschte – seinerzeit, als der britische Anthropologe Edward Burnett Tylor, im 19. Jahrhundert war das, über Handlungen, Sitten und Gebräuche schrieb, die einer verklungenen Kulturepoche, einem »erloschenen Kultus« (Meyers Großes Konversations-Lexikon, 1909) und »früheren Culturgrad« (Friedrich Nietzsche, in dessen Nachlass sich eine Notiz zum »Überlebsel« findet) entstammten und deren Sinn sich den Nachgeborenen kaum mehr erschließe, ja »oft ganz unverständlich geworden« sei. Gut, ganz so ist es bei dieser altehrwürdigen Zeitschrift, dem Überlebsel Kursbuch, glücklicherweise noch nicht gekommen.
Gegründet wurde es von einem, der sich heute selbst als »ein Relikt aus dem zwanzigsten Jahrhundert« bezeichnet in seinem Buch Fallobst. Seltsamerweise empfindet Hans Magnus Enzensberger diesen Status als Relikt weder als Nachteil noch als Defekt – »eher so, als hätte man den Jüngeren etwas voraus«. Vielleicht wird gerade in unseren Zeiten etwas voreilig geurteilt, dies oder das habe »sich überlebt«: Das Bargeld ist es für die einen, ganze Geschäftsmodelle sind es für die anderen. Oft steckt Wunschdenken dahinter. Ganz deutlich ist das an einem viel zitierten Satz Wladimir Putins von 2019 abzulesen: »Die liberale Idee hat sich endgültig überlebt.« Kaum hatte die Pandemie in diesem Frühjahr ganze Bürotürme und also auch den Post Tower in Bonn verwaisen lassen, gab der Personalvorstand der Deutschen Post, Thomas Ogilvie, in der Süddeutschen Zeitung zu Protokoll: »Das starre Präsenzmodell hat sich überlebt, es geht um eine bedarfsgerechte Anwesenheit.«
Als Konsumenten werden wir seit Langem schon darauf konditioniert, Dinge für veraltet zu halten: Bereits beim Kauf von Laptops und Smartphones wissen wir um deren vom Hersteller bei der Fertigung einprogrammierten Verschleiß, wofür Ökonomen schon in den frühen 1930er-Jahren den Begriff »geplante Obsoleszenz« oder – schöner – »Produktvergreisung« erfunden haben. Das »Endgerät« heißt schließlich nicht umsonst so. Dass auch jedem Denkmal eine – freilich nicht so leicht abzuschätzende – Obsoleszenz eingeschrieben ist und es somit ein historisches Relikt par excellence darstellt, zeigen die Sockelstürze der vergangenen Monate. Die in den Vereinigten Staaten wie in Europa einsetzende Denkmälerdämmerung, die Kritik an Heldenstatuen für Sklavenhalter und brutale Kolonisatoren, rief einem jene Zeilen in Erinnerung, die Robert Musil am 10. Dezember 1927 in einem Feuilleton in der Prager Presse geschrieben hatte. Er störte sich an der Machart der überlebensgroßen Standbilder und daran, »wie rückständig unsere Denkmalskunst ist, verglichen mit der zeitgenössischen Entwicklung des Anzeigenwesens« (eine bemerkenswert hellsichtige Feststellung). Musil weiter: »Mit einem Wort, auch Denkmäler sollten sich heute, wie wir es alle tun müssen, etwas mehr anstrengen. Ruhig am Wege stehen und sich Blicke schenken lassen, könnte jeder; wir dürfen heute von einem Monument mehr verlangen … Warum greift der in Erz gegossene Held nicht wenigstens zu dem anderwärts längst überholten Mittel, mit dem Finger an eine Glasscheibe zu klopfen? Weshalb drehen sich die Figuren der Marmorgruppe nicht umeinander, wie es bessere Figuren in den Geschäftsauslagen tun, oder klappen wenigstens die Augen auf und zu? Das Mindeste, was man verlangen dürfte, um die Aufmerksamkeit zu erregen, wären bewährte Aufschriften wie ›Goethes Faust ist der beste!‹ oder ›Die dramatischen Ideen des bekannten Lyrikers X. sind die billigsten!‹. Leider wollen das die Bildhauer nicht. Sie verstehen, wie es scheint, nicht unser Zeitalter des Lärms und der Bewegung. Wenn sie einen Herrn in Zivil darstellen, dann sitzt er reglos auf einem Stuhl oder steht da, die Hand zwischen dem zweiten und dritten Knopf seines Rockes, auch hält er zuweilen eine Rolle in der Hand, und es zuckt keine Miene in seinem Gesicht. Er sieht gewöhnlich aus wie die schweren Melancholiker in den Nervenheilanstalten. Wenn die Menschen nicht für Denkmale seelenblind wären und bemerken würden, was oben vorgeht, so müßten sie, wenn sie vorbeikommen, das Gruseln haben wie an den Mauern eines Irrenhauses.«
Natürlich ist all das mit ironischem Soupçon formuliert. Man kann nur hoffen, dass die Ironie zu Musils Lebzeiten einen besseren Stand hatte als heute, wo ihr Reliktcharakter vor allem in den todernsten sogenannten sozialen Medien (»irony off«) jeden Tag aufs Neue offenbar wird. Man darf davon ausgehen, dass der alte Otto-Gag der Autorengruppe Gernhardt/Eilert/Knorr aus dem Seniorenheim – »›Seid ihr alle da?‹ – ›Jaaaa!‹ – ›Aber nicht mehr lange!‹« – heutzutage als »Altersrassismus« diskutiert werden würde. Es gibt einfach sehr viele »Berufsernstbolde« (Otto Waalkes) unter den Twitterati.
Ein Lob des Relikts, das in der Rubrik »Brief eines Lesers« erscheint, muss nicht zuletzt natürlich das Überlebsel des Leserbriefs als unbedingt erhaltenswert verteidigen. Bei all dem Hass und der Häme, die sich im digitalen Raum breitmacht, lernt man den vordem als oberlehrerhaft bespöttelten Leserbriefschreiber auf einmal wieder schätzen. Die allermeisten Hörerbriefe, die einen beim Rundfunk erreichen, sind von ausgesuchter Höflichkeit und Klugheit. Man kann dem Philosophen Markus Gabriel nur zustimmen, wenn er in seinem jüngsten Buch Moralischer Fortschritt in dunklen Zeiten. Universale Werte für das 21. Jahrhundert eine Gefahr darin erkennt, »dass moralische Selbstverständlichkeiten wie der Wert des Respekts gegenüber Menschen, die wir (noch) gar nicht kennen, online außer Kraft gesetzt sind. Das beweisen die Kommentarspalten jedes sozialen Mediums genauso wie diejenigen, die von traditionellen Presseportalen freigeschaltet werden. Die Bereitschaft, fremde Menschen zu beschimpfen, ohne irgendeinen Versuch zu unternehmen, sie zu verstehen, ist deutlich höher als bei klassischen Leserbriefformaten, was einfach daran liegt, dass es online keinerlei zeitlichen Abstand und keinen Filter gibt zwischen dem Impuls, seine Meinung zu äußern, und der Möglichkeit, sie umgehend publik zu machen.« Möge also auch dem klassischen Leserbrief sein Überleben, sein »Überlebnis« (Ulla Unseld-Berkéwicz) gesichert sein – nicht nur im Kursbuch.
Wolfgang Schmidbauer
Corona erleben
Ein notwendiger Zwischenruf
1969 saß ich an meiner Promotion über die psychologische Deutung von Mythen und verdiente meinen Lebensunterhalt als Medizinjournalist. In diesem und im folgenden Jahr forderte eine Influenza-Pandemie, deren Ursprung in Hongkong lag, weltweit mindestens zwei Millionen Todesopfer. In der Bundesrepublik Deutschland starben etwa 40 000 Menschen mehr als sonst. Auf dem Gebiet der DDR schätzte man ebenfalls viele Tausend Opfer. Statistiken darüber lieferte das sozialistische System ebenso wenig, wie es Aussagen über die Suizidrate seiner Bürger traf.
Kopfschmerzen, Schnupfen, Husten, Schluckbeschwerden und Brustschmerzen waren die ersten Symptome. Das Fieber stieg rasch auf bis zu 40 Grad. Spezifische Medikamente oder einen Impfstoff gab es nicht. Die Krankenhäuser waren überfüllt, die Patienten lagen auf den Gängen, die Weihnachtsferien 1969 wurden verlängert, weil wegen der hohen Krankenzahlen kein geregelter Unterricht möglich war.
Die Meldungen zur Pandemie blieben im Kleingedruckten. »Katastrophale Lage durch Grippe in den USA«, »Zwölf Millionen Italiener grippekrank« oder »Legt Grippe Trambahn lahm? 490 Fahrer und Schaffner erkrankt« waren damals Randnotizen in der Süddeutschen Zeitung. Sie alarmierten niemanden. Ich nahm an den Redaktionskonferenzen des Ärztemagazins Selecta teil, dessen Mitarbeiter ich war. Für die Grippewelle interessierte sich niemand. Die Themen am Tisch waren die Transplantationschirurgie und die Contergan-Affäre; Grippeviren und die von ihnen verursachte Übersterblichkeit konnten das Interesse der Chefredaktion nicht wecken.
Ebenso wie die Asiatische Grippe rund zehn Jahre zuvor galt die Hongkong-Grippe nicht als Gefahr, vor der man sich schützen muss, eher als Schicksal, das die Bevölkerung schon irgendwie bewältigen würde. Dass die echte Grippe eine schwere Erkrankung ist, war allgemeines medizinisches Wissen. Es führte aber zu keinerlei Maßnahmen zur Vorbeugung. Die Wirtschaft litt, viele Mitarbeiter waren im Krankenstand, Todesfälle häuften sich. Das wurde hingenommen. Ich kann mich nicht erinnern, dass in der Fachliteratur, die ich zwischen 1960 und 1970 gut kannte, auch nur ein Autor davon gesprochen hätte, dass es sinnvoll sein könnte, in der Öffentlichkeit eine »chirurgische« Maske zu tragen. Ihr Ort war der Operationssaal, draußen hatte sie nichts zu suchen.
Angesichts der Corona-Pandemie knapp 50 Jahre später ist alles anders. Während die früheren Epidemien als »Wellen« angesprochen wurden (und damit ein Naturphänomen imaginiert wird), beherrscht jetzt eine (Corona-)»Krise« über Monate hin alle Medien – führende Politiker bemühen gar Kriegsrhetorik. Ansteckungen und Todesfälle wurden 1969/70 geschätzt und nachträglich aus dem Vergleich mit dem Durchschnitt der Todesfälle objektiviert. Jetzt werden Infektionen und Todesfälle von Anfang an gezählt; alle Länder, die Statistiken liefern, werden verglichen. Die internationale Aufmerksamkeit für diese Vergleiche lässt sich durchaus mit der für den Medaillenspiegel der Olympischen Spiele vergleichen – die wegen der Pandemie aber abgesagt wurden. Auch das wäre in den 60ern undenkbar gewesen.
Nicht weniger dramatisch als die wirtschaftlichen Folgen, die aus dem Umgang mit dem neuartigen Virus resultieren, ist heute die hohe und ganz anders gelagerte Betroffenheit der Menschen. Sie führt zu einer emotionalen Verunsicherung, die wohl noch über die Folgen des Selbstmord-Terrorismus zur Jahrtausendwende oder der Bankenkrise ein knappes Jahrzehnt später hinausgehen. Bereits nach SARS-Infektion (schweres akutes respiratorisches Syndrom), dessen Erreger dem Corona-Virus ähnlich ist, wurden die psychischen Folgeschäden als gravierender eingeschätzt als die organischen, nachzulesen etwa in Steven Taylors Die Pandemie als psychologische Herausforderung.1
Während die früheren Grippewellen in ihrer durchaus gravierenden Bedrohung erfolgreich verdrängt werden konnten, ist 2020 die Verdrängungsdecke gerissen. Jetzt diskutieren wir, ob wir in die Welt »vor Corona« zurückkehren können – und ob wir das überhaupt wollen.
Die wissenschaftlichen – und zum Teil umstrittenen – Kritiker und Kritikerinnen des Lockdowns wie Wolfgang Wodarg, Karin Mölling und Sucharit Bhakdi hatten die Zeit der epidemischen »Wellen« noch miterlebt. Die jüngeren Forscher, die im Verlauf der »Krise« sehr populär wurden, waren zur Zeit der Hongkong-Grippe noch nicht geboren (Christian Drosten etwa ist Jahrgang 1972). Die Vertreter des »neuen« Umgangs stehen im Zenit ihrer Karriere, Mölling und Bhakdi sind emeritiert.
Vom Fatalismus zur Erregung
Die Haltung der Ärzte wie der Bürger blieb 1970 fatalistisch. Sie lässt sich so zusammenfassen: Gegen Viren kann man wenig machen. Die körpereigene Abwehr der Gesunden reicht aus, um die Infektion zu überleben. Die Opfer unter den bereits Erkrankten nehmen wir in Kauf.
Nachdem Christiaan Barnard 1967 das erste menschliche Herz erfolgreich transplantiert hatte, wurde die Aufmerksamkeit der medizinisch Interessierten allein von der Chirurgie beherrscht. Um die durch immer gewagtere Eingriffe über Tage hin in einen Zustand zwischen Leben und Tod versetzten Transplantationspatienten am Leben zu erhalten, wurde die Intensivmedizin gefördert und weiterentwickelt. Diese Disziplin spielt im Umgang mit Covid-19 eine wichtige Rolle. Staatliche Eingriffe in die Freiheitsrechte der Bürger werden jetzt damit gerechtfertigt, dass ohne eine Kontrolle der Epidemie die intensivmedizinische Versorgung zusammenbricht. Auf die Paradoxie, dass Menschen plötzlich Opfer für ein Gesundheitssystem bringen sollen, das doch eigentlich für die Menschen da ist, hat jüngst der Züricher Philosoph Olivier Del Fabbro hingewiesen.2
In der Diskussion zwischen Jürgen Habermas und Klaus Günther in der ZEIT vom Mai 2020 wurde deutlich, dass die Väter des Grundgesetzes keine Ahnung von den Möglichkeiten der Intensivmedizin hatten. Aus diesem Grund war auch keine politische Situation denkbar, die verlangen würde, Grundrechte einzuschränken, um die Verfügbarkeit einer optimalen medizinischen Versorgung zu sichern.
In einer technisch-wissenschaftlich aufgeklärten Welt schmilzt der Fatalismus dahin wie die Gletscher im Klimawandel. Naturkatastrophen bedeuteten jahrhundertelang nichts außer der Nichtigkeit des Menschen im Angesicht der Naturgewalten. Heute ruft der Mensch die Naturkatastrophen selbst hervor. Sie sind mit moralischer Bedeutung aufgeladen und strapazieren nicht nur die materielle Leidensfähigkeit, sondern auch die seelische durch Schuldgefühle und Zorn.
Forscher leben riskant, wenn sie uns den Spiegel vorhalten und das gute Gewissen rauben. Sie wecken den Affekt, einen Boten für seine Botschaft zu strafen. Inzwischen gibt es Eiferer, die Virologen mit Morddrohungen verfolgen. Plakate, auf denen »Corona-Kritiker« hierzulande Immunologen beschimpfen, wirken geradezu zivilisiert gegenüber einer Aktion im afrikanischen Womé, wo 2014 acht Experten verschwanden, die über Ebola forschen wollten. Suchtrupps fanden die Leichen später in einer Zisterne.
In der Tat haben Forscher düstere Botschaften überbracht, von denen wir 1970 nichts wussten. Der Blick auf Viren hat sich radikal verändert. Den wichtigsten Einbruch in eine Front der Sorglosigkeit verursachte das HIV-Virus. Es hat dem Mythos vom starken Immunsystem als Schutzmacht ein ebenso jähes Ende bereitet wie der angstfreien Promiskuität.
Eine HIV-Infektion wird ganz und gar nicht von einem intakten Immunsystem »hinweggefegt«. Im Gegenteil: Die Erreger dringen in die Zellstrukturen der körpereigenen Abwehr ein und legen diese lahm. Zum ersten Mal wurde bei HIV ein Test zum Orakel über Gesundheit oder Siechtum.
Der Mythos des todbringenden Virus
Obwohl HIV-Infizierte heute behandelt werden können und die Ansteckung nicht mehr tödlich ist, hat dieser Schock das Bild der Virusinfektion ebenso radikal verändert, wie er die Forschung auf diesem Gebiet beschleunigte und intensivierte. Von da an ist der Mythos vom todbringenden Virus in den Medien fest verwurzelt; er kann auf Leinwand und Bildschirm jederzeit epidemisch werden.
Im Kinofilm Outbreak – Lautlose Killer will ein General eine Stadt bombardieren, um die menschliche Quelle einer tödlichen Epidemie auszuradieren, ehe sie das ganze Land erfasst. Glücklicherweise entdecken die Spezialisten gerade noch rechtzeitig das Gegenmittel. Im Fernsehen gefährden Terroristen das Leben von Millionen mit einem gefüllten Reagenzglas und werden in letzter Minute abgehalten, es über New York auszukippen.
Waren deshalb 2020 so viele Regierende bereit, die wirtschaftlichen Interessen ihrer Länder zurückzustellen? Vermutlich nicht nur, aber auch. Ich denke nicht, dass sich der radikale Schritt »von der Welle zur Krise« allein darauf zurückführen lässt, dass seit Aids und Ebola die Menschen mehr Angst vor Viren haben. Auch die zwischenmenschliche Haltung und das gesellschaftliche Klima haben sich verändert. Seelische Verletzungen spielen heute eine größere Rolle. Sexuelle Übergriffe auf Kinder galten in den 1960er-Jahren als ekelhafte Bagatelle, manchmal sogar als »Befreiung« der kindlichen Sexualität. Heute alarmieren sie die Bevölkerung; der Strafrahmen wurde erweitert und verschärft.
Als ich 1948 eingeschult wurde, war es noch selbstverständlich, dass sich die Lehrerin durch den »Tatzenstock« Respekt verschaffte. Schläge auf die flache Hand galten als legitimes Erziehungsmittel. Wir haben langsam, Schritt für Schritt, die teils militärisch geprägten, teils faschistisch akzentuierten Vorstellungen über die Privilegien der Starken abgebaut.
Wer auch immer die körperliche und seelische Integrität anderer verletzt, wie auch immer er oder sie es tut – weit über die Gesetze hinaus, die solche Täter verfolgen, greifen auch die Medien nach diesen Fällen und prangern sie an. Der Staat darf nicht mehr träge sein, wie er es in diesen Punkten früher war.
Das Verbot von physischen Strafen, ein anderes Verständnis von Sexualität, die Einsicht, dass Vergewaltigung auch in der Ehe ein Verbrechen ist, das geschärfte Bewusstsein für den Missbrauch von Kindern, für die sexuelle Nötigung in Abhängigkeitsverhältnissen – das alles waren Schritte zu mehr Empathie in Schwächere, Schranken gegen den Vorrang der Starken. Es war ein langer und langsamer Weg. Gebahnt haben ihn mehrere Generationen in wachsendem Gefühl für die Verletzlichkeit des Lebens.
Die fatalistische Haltung gegenüber Epidemien läuft auf das soldatische Motto hinaus: Der Gute hält es aus; um den Schlechten ist es nicht schade. Der Gedanke, dass jedes einzelne Leben kostbar ist und die Rede von Kollateralschäden inhuman, hat mehr und mehr an Macht gewonnen. Wer – wie ich – im Krieg geboren und in der Nachkriegszeit aufgewachsen ist, spürt diese Veränderungen deutlicher als andere. Vielleicht ist das, was 2020 geschehen ist, auch ein Zeichen dafür, dass die Nachkriegszeit (die ja, anders als der Krieg, kein fassbares Ende hat) definitiv vorbei ist. Der Gedanke, das Volk hart zu machen für den nächsten Krieg, hat keine Schlagkraft mehr. Es dominiert die Sehnsucht nach sicheren Grenzen, nach einer wieder überschaubaren Welt.
Die Bedingungen der Immunabwehr
Zwischen dem Problem und dem Dilemma zu unterscheiden, ist ein Denkmodell, das uns in schwierigen Situationen weiterhilft. Während das Problem gelöst werden kann, ist das Dilemma unlösbar. Grundsätzlich ist die Struktur eines Problems also einfach. Beim Dilemma wird es kompliziert. Die Corona-Krise der vergangenen und der aktuellen (Sommer-)Monate demonstriert die Schwierigkeiten, vor denen wir stehen, wenn wir mit der Struktur des Dilemmas konfrontiert sind und darüber hinaus das fatalistische Denken einem empathischen gewichen ist.
Ansteckung ist ein typisches Problem mit klarer Ansage: Ich bin entweder infiziert oder nicht. Das Dilemma meldet sich, sobald wir uns über die komplexen Bedingungen der menschlichen Immunreaktion informieren, die darüber entscheidet, ob und wie wir eine Virusinfektion bewältigen. Wenn ich kategorisch verbiete, dass alte Menschen in Heimen von ihren Angehörigen besucht werden, schütze ich sie hoffentlich vor Covid-19. Gleichzeitig löse ich aber womöglich eine Depression aus, die ihre Abwehr so sehr schwächt, dass sie einem der Keime erliegen, die schon vorher im Heim zirkulierten.
Die Indifferenz des fatalistischen Denkens konnte Normalität erhalten, die heute durch perfektionistischen Eifer eingeschränkt wird. Auf dem Weg zum einfühlenden Denken haben wir erst den halben Weg zurückgelegt. Es wurde und wird nach wie vor über Maßnahmen debattiert, die für einen minimalen Gewinn an Kontrolle den Menschen Möglichkeiten rauben, sich überhaupt noch sicher und geborgen zu fühlen in dieser neu geschaffenen Sozialwelt. Jogger im Stadtpark festnehmen? Verbieten, dass mit Hunden Gassi gegangen wird? Vor allem in Ländern, die erneut steigende Fallzahlen berichten, flammen solche Diskussionen über Maß und Mitte wieder auf.
Obwohl der Fatalismus der vergangenen Jahrzehnte passé ist, hat der hohe Organisationsgrad des modernen Zusammenlebens eine wenig reflektierte Entwicklung hin zu einem eher kalten Denken in simplen Alternativen induziert. Eine auf plakative Vereinfachung zielende Konstruktion des medialen Events gibt vor, wir könnten ein Dilemma in ein Problem zurückverwandeln – mit schwerwiegenden Folgen. Wer in Zeiten großer Unsicherheit die Gefahr erst verleugnet und dann durch »radikale« Gegenmaßnahmen wieder Punkte gewinnen möchte, tut den Bürgern keinen Dienst.
Die Ansteckung ist ein Problem – die Unterstützung des Immunsystems ein Dilemma
Nicht die realistische, sondern die dramatische Gefahr, nicht der statistisch viel häufigere Autounfall, sondern der unwahrscheinlichere Flugzeugabsturz stimuliert unsere Fantasie und prägt unsere Ängste. Die Nachrichten im März von Überlastung der Kliniken, einer riesigen Zahl drohender Todesfälle und jetzt im Sommer von wirtschaftlichem Niedergang nie da gewesenen Ausmaßes waren und sind unter dem Gesichtspunkt des kalten, problemlösenden Denkens korrekte Warnungen.
Wenn wir aber nicht problemlösend, sondern empathisch denken, bemerken wir den Schaden, den solche Bilder anrichten. Nur weil er sich schlechter objektivieren lässt, muss er nicht geringer ausfallen als das Risiko durch den Kontakt mit dem Virus.
Wenn ich von vielen Tausend Corona-Toten in den unterschiedlichsten Erdteilen lese oder höre, wird auf den subtilen, aber unzweifelhaft belegten Wegen der Psychoimmunologie mein Glaube gebrochen, dass ich selbst eine Ansteckung verkraften kann. Da nützt es nicht viel, wenn sich bei genauerem Hinsehen zeigt, dass Verstorbene überwiegend schon vor der Infektion geschwächt waren.
In den Ermutigungsansprachen der politischen Führer weltweit dominiert eine schiefliegende Sicherheit, die oberste Priorität für Gesundheit und Leben zu kennen und sich energisch für sie zu entscheiden. Der populärste Mann ist nun, von der Welle des Events nach oben gespült, derjenige Landesvater, der das Gemeinwohl durch harte Restriktionen sichert. Leben vor einem schnellen Tod an definierter Ursache zu bewahren, schenkt den Virologen weltweit eine Expertenmacht, um die sich etwa die Klimaforscher seit Jahren vergeblich bemühen.
Wir werden erst in den kommenden Jahren einigermaßen beurteilen können, welche der politischen Entscheidungen, die in der Corona-Krise getroffen wurden, für die Gesundheit der Menschen auf dem Planeten segensreich, welche schädlich waren. Je länger wir mit dem Virus leben, desto stärker wird sich Covid-19 in Einzelschicksale auflösen, desto mehr werden neben den Virologen auch Forscher zu Wort kommen, die sich theoretisch und praktisch mit der menschlichen Widerstandskraft beschäftigen.
Sicher wissen wir schon heute, dass Ängste und Depressionen das Immunsystem schwächen. Es wurde viel versprochen, um die Menschen zu entlasten, die um ihre Zukunft bangen, weil ihre wirtschaftliche Existenz und ihre Aussicht auf einen anerkannten Ort in der Gesellschaft gefährdet wurden. Aber Reden über unbürokratische Hilfe lösen keine individuellen Krisen, sie machen sie nur kurze Zeit erträglicher – und diese Entlastung schlägt in ihr Gegenteil um, wenn zu viel versprochen wurde. Ein Künstler, dem staatliche Verbote Auftritts- und Verdienstmöglichkeit genommen haben, stellt zuversichtlich einen Antrag. Er gerät unter eine Lawine von Formularen, die Zuständigen sind ins Homeoffice verschwunden und schicken erst einmal seitenweise Text, fordern ein Dutzend Bestätigungen in beglaubigter Abschrift.
Unter rascher Hilfe stellt sich ein geplagter Mensch vor, dass er zu einem anderen Menschen Kontakt findet, der ihm zuhört, sich in seine Lage versetzt, vielleicht das eine oder andere Dokument studiert, um Missbrauch auszuschließen. Nach ein paar Stunden wird die Hilfe bewilligt.
Das kalte Denken geht immer vom Negativen aus und sucht Kontrolle um jeden Preis. Das warme Denken orientiert sich an der Empathie. Es leugnet nicht die Gefahr, aber auch nicht die Tatsache, dass die meisten Menschen Vertrauen verdienen und es erst einmal darauf ankommt, ihnen Sicherheit zu geben. Es fließt leicht von den Lippen und in die Tastaturen, dass der Staat für die Bürger da ist. Wer aber etwas von einem Staat möchte, der in der Krise behauptet hat, alles für die Bürger tun zu wollen, stößt auf jenes kalte System, dessen Überwindung ihm soeben zugesagt wurde.
Die Corona-Krise produziert Gewinner und Verlierer in einer bisher nie da gewesenen Selektion und Intensität. Wer mit einem kleinen Laden, einer Ich-AG als Musiker, Theatermacher, Autor bisher gut durchgekommen ist, sieht bedroht, woran sein Herz hängt. Wer sich über den Trott als Beamter geärgert hat, sieht nun den Segen eines festen Gehalts und einer sicheren Pension in leuchtenden Farben.
Kinder bewältigen die Infektion beileibe nicht nur deshalb am besten, weil ihr Immunsystem gut trainiert ist. Sie machen sich in der Regel auch weniger Sorgen als die Erwachsenen, sie fühlen sich krank, wenn sie krank sind, legen sich ins Bett, wenn sie fiebern, und stehen auf, wenn es ihnen besser geht.
Anders die ehrgeizigen, sportlichen Erwachsenen, die schon in Vor-Corona-Zeiten lebensgefährliche Verläufe von Lungenentzündungen provozierten. Sie reden ihre Grippe klein und unterdrücken die Symptome mit schnell eingeworfenen Medikamenten, um weiterarbeiten zu können.
Wenn sie dann mit schwersten Symptomen zusammenbrechen, wird das gegenwärtig gerne der Unberechenbarkeit des Erregers zugeschrieben, nicht der Unfähigkeit der Erkrankten, ihren inneren Zustand ernst zu nehmen. Wenn die Corona-Krise der Menschheit hilft, sich ein wenig von dem Raubbau an seelischen Ressourcen zu distanzieren, kann sie auch eine wohltätige Seite haben.