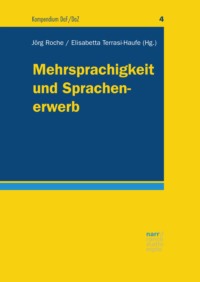Kitabı oku: «Mehrsprachigkeit und Sprachenerwerb», sayfa 6
1.3.2 Sprachenpolitik und deren Einfluss auf Machtverhältnisse zwischen Sprachen
Der verfassungsmäßige Status einer Sprache hat einen Einfluss darauf, in welchen Situationen eine Sprache benutzt wird und welche Einstellungen die Bürger und Bürgerinnen eines Landes zu dieser Sprache haben. Daneben spiegelt er nicht immer die tatsächliche Sprachensituation wider. Sogar Staaten, die sich als absolut einsprachig bezeichnen, müssen sich mit der Frage nach dem Umgang mit Minderheitensprachen in der Bildung, in der öffentlichen Verwaltung und in den kulturellen Domänen auseinandersetzen, um mögliche Sprachenkonflikte zu lösen oder ihnen vorzubeugen. Die Aufteilung von Staaten in verfassungsmäßig einsprachige oder mehrsprachige Gemeinschaftsordnungen ist daher wenig relevant für unsere Analyse des Vorkommens von Mehrsprachigkeit und für den tatsächlichen (nicht den beschriebenen) Umgang der Staaten mit diesem Umstand. Unsere Analyse beruht darauf, welche Formen die Machtverhältnisse zwischen Sprachen in mehrsprachigen Gesellschaften annehmen, und wie die Staaten auf diese Verhältnisse reagieren, ungeachtet dessen, ob die Staaten offiziell ein- oder mehrsprachig sind.
Wenn wir nun die Machtverhältnisse betrachten, unterscheiden wir zwischen mehreren Arten mehrsprachiger Muster. Eines davon beinhaltet Situationen, in denen zwei oder drei Sprachen mehr oder weniger friedlich nebeneinander koexistieren, wie die offiziellen Sprachen in der Schweiz und in Belgien. Zu demselben Muster zählen wir auch die Situationen, in denen zwei oder mehr Sprachen nebeneinander koexistieren, aber doch in Konkurrenz treten, allerdings ohne um ihr Überleben zu kämpfen. Dies ist beispielsweise beim Englischen und Französischen in Kanada der Fall. Hier sind die betroffenen Sprachen nicht vom Aussterben bedroht und ihre Sprecher und Sprecherinnen gehören nicht zur Kategorie der Sprachminderheiten.
In anderen Fällen geht es um Situationen, in denen eine der Weltsprachen, zum Beispiel die ehemalige Kolonialsprache oder Englisch, die keine Erstsprache innerhalb des Staates darstellt, als Kolonialsprache fortbesteht. Im Falle von Englisch spricht man hier häufig vom Englischen als associate official, also als angegliederte Amtssprache, wie es in Indien der Fall ist (vergleiche Spolsky 2004: 173). In diesem Fall ist es ebenfalls so, dass diese Sprache keinen politischen Druck ausübt und deshalb keine große Gefahr für den Erhalt der Mehrsprachigkeit darstellt. Die Dominanz solcher Sprachen, wie im Falle Indiens, ist zum Beispiel auf die Wirtschaft beschränkt (oder sie wird als eine Instanz des globalen sprachlichen Imperialismus klassifiziert) und wird kaum die linguistic human rights bedrohen. Die einstige Kolonialsprache spielt aber aufgrund ihrer zahlreichen Sprecher und Sprecherinnen, wegen ihres offiziellen Status und sozialen Prestiges, immer noch eine wichtige Rolle. Mehrsprachige Leitlinien dieser Staaten berücksichtigen die Position ehemaliger Kolonialsprachen sowohl in der Sprachenpolitik, als auch im politischen Diskurs und deshalb ist die neue Mehrheitssprache weniger stark, als sie trotz ihres offiziellen Status erscheinen mag. Kasachstan und Kirgisistan, in denen Russisch immer noch eine Amtssprache ist und unter anderem in Bildung und Medien weit verbreitet ist, sind dafür typische Beispiele.
Es gibt noch eine weitere Situation, in der es um die Interaktion zwischen Lokalsprachen (oder einer Lokalsprache) und einer Handelssprache geht: Sie kann heute fast ausnahmslos in jedem Teil der Welt beobachtet werden, wo Englisch unter anderem für geschäftliche Zwecke, in einigen Medien, bei sozialen Ereignissen und in bestimmten Bildungseinrichtungen verwendet wird. Die Frage, ob die Position der englischen Sprache in solchen Situationen guten oder schlechten Einfluss auf die Sprachenvielfalt in der entsprechenden Umgebung nehmen kann, ist nicht leicht zu beantworten.
1.3.3 Von der territorialen Einsprachigkeit hin zur Mehrsprachigkeit
Als nationalstaatliche Vorstellungen im Europa des 18. Jahrhunderts aufkommen, wird Sprache zumeist als Marker der nationalen Identität angesehen (vergleiche auch Lerneinheit 1.2). Zu späteren Zeitpunkten wird diese Vorstellung sogar noch stärker, als sich Nationalstaaten herausbilden. Neben anderen Mitteln nutzen Nationalstaaten die Sprachen, um ihre Existenz aufzuwerten und zu legitimieren sowie um verschiedene Gruppen unter einem nationalen Kollektiv zu vereinen. Aus diesem Grund werden Sprachen standardisiert, oder manchmal sogar erfunden, so wie im Falle einiger zentralasiatischer Sprachen in der ehemaligen Sowjetunion, um als Zeichen der Mitgliedschaft zu einer größeren (nationalen) Gruppe zu dienen. Shohamy stellt dazu fest:
Um seine Existenz zu beschützen, musste der Nationalstaat strikte Regeln, Regulierungen und eine Anzahl symbolischer Marker erfinden, um bei seinen Mitgliedern festzustellen, wer dazugehörte oder nicht. Die erste Vorgabe war „biologischer“ Natur, d.h., man war Deutsch, Spanisch oder Chinesisch, wenn man in den ‚Stamm‘ hineingeboren wurde, oder ‚vom selben Blut war‘. Aber der Nationalstaat suchte kontinuierlich nach zusätzlichen symbolischen Markern als klarere und deutlichere Kennzeichen der Zugehörigkeit. Zu den Markern, die zusätzlich zu den biologischen und physiognomischen Indikatoren genutzt wurden, zählten jene einer gemeinsamen Geschichte, einer gemeinsamen Kultur, gemeinsamer Vorfahren, einer gemeinsamen Religion und […] einer gemeinsamen Sprache. (Shohamy 2006: 26)
Die Förderung nicht nur der Nationalsprachen, sondern auch ihrer Standardvarietäten war laut Spolsky essenziell für die nationalstaatliche Idee:
Sowohl die Französische Revolution als auch die deutsche Romantik vertraten eine Auffassung von Nationalismus, dem die Annahme zugrunde lag, dass eine einzige vereinende Sprache die beste Definition und der beste Schutz für die Nationalstaatlichkeit sei. Eine angemessene Nationalsprache auszuwählen und sie von ihren ausländischen Einflüssen zu bereinigen, war eine bedeutende Leistung. (2004: 57)
Die Tendenz zur Förderung von Standards ist während der Periode zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg und auch danach immer noch sehr ausgeprägt. Doch die schwindenden nationalstaatlichen Vorstellungen in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts fördern den Diskurs zur Sprachenvielfalt und zu den sprachlichen Menschenrechten. Internationale politische Organisationen, die zum Ende der Kolonialzeit und des Zweiten Weltkriegs entstehen, legen strikte Regeln zur Sicherung der Menschenrechte fest. Sowohl die jungen postkolonialen Staaten, als auch die Staaten mit einer bereits länger währenden Eigenstaatlichkeit, die traditionsgemäß einsprachige Richtlinien verfolgen, werden unter Druck gesetzt. Letztere werden dafür kritisiert, dass sie keine soliden Mechanismen etabliert haben, um für den Schutz und die Förderung von Minderheitensprachen zu sorgen, um sprachliche und kulturelle Vielfalt zu erhalten und um die Verwendung von Minderheitensprachen im Bildungswesen, am Arbeitsplatz und in den Medien zu fördern. Zusammen mit den internationalen Organisationen übt zu diesem Zeitpunkt auch die Zivilgesellschaft Druck aus, die sich nach dem Scheitern des radikalen Nationalismus im neuen Europa lautstark Gehör verschafft. Junge postkoloniale Staaten sind diesem Druck ebenfalls ausgesetzt, da ihre Sprachenpolitik den Minderheitensprachen fast ausnahmslos keinen Platz einräumt (insbesondere zur Zeit ihrer Gründung).
Der verstärkte Ruf nach Demokratisierung in den vergangenen Jahrzehnten hat die Frage nach den Minderheiten höchst dringlich werden lassen. Respekt und Akzeptanz von Minderheitensprachen waren und sind einige der Anforderungen, die internationale Institutionen sowohl an neue Staaten, als auch an jene mit einer längeren Nationalstaatsgeschichte stellen. Die Reaktionen der unterschiedlichen Staaten fallen ungleich aus, aber insgesamt ist die Tendenz dahin gegangen, ein neues Grundgerüst für die Gesetzgebung und die Umsetzung zu schaffen, das zwar den unterschiedlichen Sprachen nicht immer den gleichen Status, aber immerhin eine wesentliche Funktion einräumt.
1.3.4 Sprachenpolitik und Mehrsprachigkeit: historische Meilensteine
Obwohl die gesellschaftliche und staatliche Befürwortung von Mehrsprachigkeit insgesamt einen Meilenstein in den vergangenen Jahrzehnten darstellt, hat der Umgang mit Minderheitensprachen innerhalb politscher und rechtlicher Systeme bereits eine längere Geschichte. Schon früh sind die Angelegenheiten der Minderheiten Diskussionsthemen internationaler Versammlungen, wie auf dem Wiener (1814) und auf dem Berliner Kongress (1878) sowie während der Pariser Friedenskonferenz (1919). In Russland, Österreich und Preußen werden beispielsweise 1815 die Rechte der polnischen Minderheiten, die zu diesem Zeitpunkt in diesen Staaten leben, anerkannt. Im Rahmen des Berliner Abkommens von 1876 verpflichten sich die Balkanstaaten dazu, das Leben und die Freiheit ihrer Minderheiten zu respektieren. Gemäß dem Abkommen von 1881 wird Muslimen in Griechenland Religions- und Sprachenfreiheit gewährt (Castellino 2000: 49ff). Im Rahmen der Pariser Friedenskonferenz nach dem Ersten Weltkrieg, müssen die Staaten, die Mitglied des Bundes werden wollen, Verträge, die eine neue Phase für den Schutz der Minderheitenrechte einläuten, einschließlich des Rechtes auf Verwendung der Erstsprache, unterzeichnen.
Die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ist ein weiterer wichtiger Abschnitt in der Entwicklung internationaler Instrumente zum Schutz der Minderheiten, die in diesen Staaten leben. Das Verbot der Diskriminierung auf Basis einer Sprache ist Bestandteil der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (UN 1948). Auch die Konvention der UNESCO gegen Diskriminierung im Jahr 1960 (UNESCO 1960) räumt den Minderheitensprachen Platz ein und schreibt vor, dass Kinder aus Minderheitengruppen in ihren eigenen Sprachen unter der Bedingung unterrichtet werden dürfen, dass sie dies nicht davon abhält, die Mehrheitssprache und die Kultur zu erlernen und kennenzulernen. Der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte (Zivilpakt 1966) beinhaltet eine spezifische Verfügung, die voraussetzt, dass Vertretern einer Minderheit ein Dolmetscher beziehungsweise eine Dolmetscherin ihrer eigenen Sprache zur Verfügung gestellt werden soll, falls sie wegen irgendeiner Sache gesetzlich belangt werden sollten.
Die nächste wichtige Phase der Wiederaufnahme und Verbesserung des internationalen Engagements gegenüber den Rechten von Minderheiten wurde in den 1990er Jahren eingeläutet, als das sowjetische Reich kollabiert und sich neue Staaten auf dem Territorium des einstigen Reiches herausbilden. Akademische Bemühungen zur Wiederbelebung von Sprachen, zur Umkehr des Sprachwechsels und zur Rettung von Sprachen vor dem Verfall hatten bereits den Höhepunkt erreicht. Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen warben aktiv für die linguistic human rights und für die Sprachenvielfalt. Das Bewusstsein für bedrohte Sprachen auf der ganzen Welt stieg an und es wurde ernsthaft an die Regierungen appelliert, die sprachenpolitischen Richtlinien und Mechanismen zum Schutz der Minderheitensprachen zu verbessern (vergleiche Simons & Lewis 2013: 3).
In dieser Zeit entstehen mehrere grundlegende internationale Dokumente: Die Europäische Charta der Regional- oder Minderheitensprachen (1992), das Rahmenübereinkommen zum Schutz Nationaler Minderheiten (1995), die Kopenhagener Dokumente (1990) sowie die Charta der Grundrechte (2000). All diese Dokumente tragen zur Bewahrung der Minderheitensprachen bei und schützen vor der Diskriminierung aufgrund sprachlicher Unterschiede. Die Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen wird aufgesetzt, um einheimische Sprachen zu schützen, die traditionsgemäß in den Staatsgebieten gesprochen werden. Die Charta spricht mehrere mit diesen Sprachen verbundene Probleme an, einschließlich der grundsätzlichen Sprachenrechte, Sprachen im Bildungswesen, Sprachenverwendung in den Medien und in kulturellen Bereichen sowie Sprachen als kulturelles Erbe.
1.3.5 Mehrsprachigkeit als ein „Muss“ in der modernen Sprachenpolitik: Was haben die Sprachen und ihre Sprecher und Sprecherinnen davon?
Wenn sprachenpolitische Richtlinien bewertet werden, sind mehrere Aspekte zu berücksichtigen. Erstens versteht man unter einer mehrsprachigen politischen Richtung, dass ein Staat den Minderheitensprachen einen gewissen Platz einräumt. Zweitens werden die Richtlinien aus der Perspektive beurteilt, ob sie wirksame Instrumente zum Schutz der Sprachenvielfalt bieten, ob sie dem SprachenerhaltSprachenerhalt beitragen und ob sie ausgestorbene oder im Verfall begriffene Sprachen vor dem Sprachentod bewahren können beziehungsweise wiederbeleben können. Dabei handelt es sich um einen traditionellen Ansatz, der Mehrsprachigkeit in der Sprachenpolitik mit Fragen nach den Menschenrechten, der Menschenwürde und dem kulturellen Erbe verbindet. Dieser Ansatz hat Entscheidungsträger in der Sprachenpolitik dazu ermutigt, sich mit den unterschiedlichen Dimensionen von Mehrsprachigkeit aus Perspektiven wie ‚Sprache als Menschenrecht‘, ‚Sprache als ein Mittel zum Ausdruck der nationalen Identität‘, ‚Sprache als kulturelles Kapital‘, ‚Sprache und ihr Wert aus wirtschaftlicher Perspektive‘ sowie ‚die ökologische Stellung der Sprache in einem Ökosystem‘ auseinanderzusetzen. Diese Betrachtungsweise lässt, sowohl im politischen als auch im akademischen Diskurs, neue Bezugspunkte zum Vorschein treten. Zum Beispiel reichen die Argumente zur Verfechtung der Mehrsprachigkeit nun vom Erhalt der Menschenwürde bis hin zur Rolle der Sprache in der wirtschaftlichen Stellung der Einzelnen. Der Diskurs zu Sprache als ein grundlegendes Menschenrecht überlagert nun den abstrakteren Diskurs zur Rolle der Sprache in der politischen oder sozialen Integration. Ein allgemeineres Verständnis der Sprache als ein Symbol der nationalen Identität wird von einer konkreteren und greifbareren Auffassung von Sprache als Ausdruck der persönlichen beziehungsweise gruppenbezogenen Identität ersetzt. Diese Betrachtungsweise lässt andere Perspektiven zu: ‚Sprache als Teil eines Wertesystems‘, ‚Sprache als kulturelles Erbe und als Träger indigenen Wissens‘ und ‚Sprache als ein Schlüsselfaktor in der persönlichen Entwicklung‘. Die Entwicklung der ÖkolinguistikÖkolinguistik als ein neues Feld in der Soziolinguistik hat für weitaus mehr Aufmerksamkeit für den Stellenwert von Sprache im gesamten Ökosystem gesorgt.
Warum machen sich Wissenschaftler beziehungsweise Wissenschaftlerinnen und Entscheidungsträger beziehungsweise Entscheidungsträgerinnen in der Politik Sorgen um den Fortbestand einer mehrsprachigen Welt und ihrer Förderung durch Sprachenpolitik, insbesondere da Sprachen (und kulturelle Gruppen) seit dem ersten Erscheinen unserer menschlichen Vorfahren kommen und gehen (siehe Ricento 2006: 232)? Erstens gibt das Schicksal der Sprachen Linguisten und Linguistinnen Grund zur Sorge, da Sprache ihr direktes Forschungsfeld darstellt. Zweitens geht es beim Verfall und beim Verlust von Sprachen nicht nur um die Sprachen an sich, sondern auch um Kulturen, kulturelles Erbe und um indigenes Wissen. Wenn eine Sprache stirbt, dann reißt sie eine gesamte Kultur und ein reichhaltiges Depot indigenen Wissens mit wertvollen Informationen über lokale Gesellschaften mit sich. Mit dem Verlust einer Sprache bricht auch die Weitergabe traditionellen Wissens und sozialer Werte an die nächsten Generationen ab. Und die Aussichten sehen nicht gerade rosig aus. Wie Krauss (2007: 2) feststellt, liegt die Anzahl der Sprachen, deren Erhalt als gesichert bezeichnet werden kann, bei etwa 300, was circa 5 % aller existierenden Sprachen entspricht.
Das Scheitern des Schutzes der Sprachenvielfalt führt zum Verlust vieler Sprachen, was in direkter Verbindung zur Problematik der Menschenrechte steht. Normalerweise handelt es sich bei den rückläufigen Sprachen um solche, die von Minderheiten gesprochen werden. Die Sprachen von Mehrheiten sind besser durch sprachenpolitische oder andere politische Richtlinien geschützt und deshalb genießen Sprecher und Sprecherinnen von Mehrheitssprachen weitaus mehr Vorteile als jene der Minderheitensprachen, sei es in der Politik, in der Bildung, in der Wirtschaft oder in soziokulturellen Bereichen. Aus dieser Perspektive wird der Schutz von Mehrsprachigkeit zu einer Frage des Beschützens von Minderheitensprachen und kulturellem Erbe.
Experiment
Stellen Sie sich vor, Ihre Familiensprache ist in ihrer Existenz bedroht oder würde nicht weiterexistieren. Was würde passieren? Was würde verloren gehen? Wie würde sich Ihr Leben verändern?
Einer der Schwerpunkte in der Verfechtung solcher Schutzmaßnahmen ist die bewusste staatliche Intervention im Namen der schwächeren Sprecher- und Sprecherinnengruppe. Wie groß auch immer der Wille und die Entschlossenheit einer Minderheitensprachgruppe selbst sein mögen, ohne die bewusste staatliche Einflussnahme (welche die funktionale Inklusion und die finanzielle Unterstützung der entsprechenden Minderheitensprache einschließen sollte), wird die Sprachpflege nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen. Wie maßgeblich der Wunsch und Wille der Gemeinschaft selbst auch sein mag, so ist der Gemeinschaft möglicherweise nicht in allen Fällen vollends bewusst, welchen Wert der Erhalt ihrer eigenen Sprache und Kultur hat, insbesondere, wenn die durch die Mehrheitssprache angebotenen Möglichkeiten sehr einladend sind. Ein anschauliches Beispiel für eine solche Einflussnahme war die maßgebliche Unterstützung der Regierung für die Wiederbelebung der irischen Sprache, die nach der irischen Unabhängigkeit 1922 zu einer Amtssprache erhoben wird. Trotz der Tatsache, dass die Motivation der irischen Bevölkerung zur irischen Sprache zu wechseln, aufgrund der sich wandelnden wirtschaftlichen, sozialen und demographischen Verhältnisse geringer ist als erwartet, ist die Unterstützung durch die Regierung entscheidend für den Erfolg dieser Maßnahme. Andere Beispiele sind die Wiederbelebung des Maorischen in Neuseeland, oder des Hebräischen in Israel (vergleiche Spolsky 2004: 44f).
Fishman identifiziert das Fehlen staatlicher Einflussnahme als eine „Null-Politik-Politik“ gegenüber schwächeren Sprachen, und stellte fest, dass „die meisten Sprachverschiebungen von formaler und schriftlicher Sprache verursacht oder bewusst erleichtert wird (zum Beispiel durch Eroberung oder andere bedeutende Verschiebungen des Status Quo), anstatt dass sie einfach passieren“ (Fishman: 2006: 318). Zum Beispiel erleichterten die Entscheidungsträger und -trägerinnen in der Sprachenpolitik den Umstieg von den Lokalsprachen zum Russischen, indem sie die Qualität russischer Schulen gegenüber den lokalsprachlichen verbessern und diese damit aufwerten, die russische Sprache am Arbeitsplatz fördern und die Bildungspolitik so gestalten, dass die Verwendung von Lokalsprachen in fortschrittlicher Wissenschaft und Technologie beschränkt ist.
Experiment
Führen Sie Interviews mit 20 Personen, die sich selbst als zweisprachig oder mehrsprachig bezeichnen. Erstellen Sie eine Liste der Sprachen, die jeder beziehungsweise jede von ihnen kennt. Wie viele von ihnen beherrschen ‚weniger bekannte Sprachen‘ (oder solche, die benachteiligt sind) als ihre eigene? Fragen Sie diese Personen nach den Gründen, aus denen sie diese Sprachen gelernt haben. Analysieren Sie Ihre Daten und identifizieren Sie die Hauptmotive, die zum Erlernen einer Sprache führen (ohne zu verallgemeinern).
Vermutlich wird Ihre Liste mehrsprachige Personen umfassen, die sich um das Erlernen von Sprachen bemüht haben, die bekannter sind als ihre eigene. Dies zeigt auch, warum Einsprachigkeit am weitesten unter Sprechern und Sprecherinnen der bekanntesten Sprachen verbreitet ist.