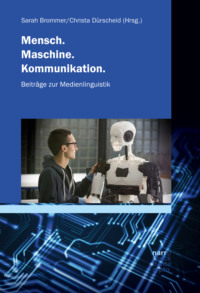Kitabı oku: «Mensch. Maschine. Kommunikation.», sayfa 3
Bibliographie
Antos, Gerd (2017). Wenn Roboter «mitreden» … Brauchen wir eine Disruptions-Forschung in der Linguistik? Zeitschrift für germanistische Linguistik 45:3, 392–418.
Bendel, Oliver (2020). Sexroboter light. Pflegeroboter mit sexuellen Assistenzfunktionen. In: Bendel, Oliver (Hrsg.). Maschinenliebe. Liebespuppen und Sexroboter aus technischer, psychologischer und philosophischer Perspektive. Wiesbaden: Springer Gabler, 219–236.
Bendel, Oliver (Hrsg.) (2019). Handbuch Maschinenethik. Wiesbaden: Springer VS.
Bentele, Günter (1994). Öffentliches Vertrauen – normative und soziale Grundlage für Public Relations. In: Armbrecht, Wolfgang/Zabel, Ulf J. (Hrsg.). Normative Aspekte der Public Relations. Grundlagen und Perspektiven. Eine Einführung. Opladen: Springer VS, 131–158.
Blöbaum, Bernd (2018). Bezugspunkte von Medienvertrauen. Ergebnisse einer explorativen Studie. Media Perspektiven 21:12, 601–607.
Blöbaum, Bernd (Hrsg.) (2016). Trust and Communication in a Digitized World. Models and Concepts of Trust Research. Cham et al.: Springer International Publishing.
Burger, Harald/Luginbühl, Martin (2014). Mediensprache. Eine Einführung in Sprache und Kommunikationsformen der Massenmedien. 4., neu bearbeitete und erweiterte Auflage. Berlin/Boston: de Gruyter.
Christaller, Thomas et al. (2001). Robotik. Perspektiven für menschliches Handeln in der zukünftigen Gesellschaft. Berlin/Heidelberg: Springer.
Donick, Mario (2019). Die Unschuld der Maschinen. Technikvertrauen in einer smarten Welt. Wiesbaden: Springer.
Engel, Uwe (2019). Blick in die Zukunft. Wie künstliche Intelligenz (KI) das Leben verändern wird. Ein Delphi-Survey über KI und das Zusammenleben von Menschen und Robotern in der digitalisierten Welt von Morgen. Abrufbar unter: https://www.researchgate.net/publication/339252899 (Stand: 19.06.2021)
Fuchs, Thomas (2020). Verteidigung des Menschen. Grundfragen einer verkörperten Anthropologie. Berlin: Suhrkamp.
Habscheid, Stephan (2000). ‹Medium› in der Pragmatik. Eine kritische Bestandsaufnahme. Deutsche Sprache 28:1, 126–143.
Holly, Werner (1997). Zur Rolle von Sprache in Medien. Semiotische und kommunikationsstrukturelle Grundlagen. Muttersprache 1, 64–75.
König, Lars/Jucks, Regina (2019). When do information seekers trust scientific information? Insights from recipients’ evaluations of online video lectures. International Journal of Educational Technology in Higher Education 16:1, 1–21. Abrufbar unter: https://doi.org/10.1186/s41239-019-0132–7 (Stand: 19.06.2021)
Lotze, Netaya (2016). Chatbots. Eine linguistische Analyse. Frankfurt am Main: Lang.
Luginbühl, Martin/Schneider, Jan Georg (2020). Medial Shaping from the Outset: On the Mediality of the Second Presidential Debate, 2016. Journal für Medienlinguistik 3:1, 57–93. Abrufbar unter: https://jfml.org/article/view/34/70 (Stand: 19.06.2021)
Marquardt, Manuela (2017). Anthropomorphisierung in der Mensch-Roboter Interaktionsforschung: theoretische Zugänge und soziologisches Anschlusspotential. Working Papers kultur- und techniksoziologische Studien 1. Abrufbar unter: https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-57037–3 (Stand: 19.06.2021)
McEwan, Ivan (2019). Machines like me. New York: Penguin Random House.
Misselhorn, Catrin (2019). Grundfragen der Maschinenethik. 3., durchgesehene Auflage. Stuttgart: Reclam.
Möllering, Guido (2006). Trust. Reason, Routine, Reflexivity. Amsterdam: Elsevier.
Posner, Roland (1985). Nonverbale Zeichen in öffentlicher Kommunikation. Zu Geschichte und Gebrauch der Begriffe ‹verbal› und ‹nonverbal›, ‹Interaktion› und ‹Kommunikation›, ‹Publikum› und ‹Öffentlichkeit›, ‹Medium› und ‹Massenmedium› und ‹multimedial›. Zeitschrift für Semiotik 7:3, 235–271.
Remmers, Peter (2018). Mensch-Roboter-Interaktion. Philosophische und ethische Perspektiven. Berlin: Logos Verlag.
Schäfer, Pavla (2014). Durch Angemessenheit zur Vertrauenswürdigkeit. Angemessener Sprachgebrauch als Mittel zum Zweck. Aptum. Zeitschrift für Sprachkritik und Sprachkultur 10, 240–261.
Schnabel, Ulrich (2018). Künstliche Intelligenz. Was macht uns künftig noch einzigartig? DIE ZEIT Nr. 14/2018, 28. März 2018. Abrufbar unter: https://www.zeit.de/2018/14/kuenstliche-intelligenz-menschen-maschine-verhaeltnis (Stand: 19.06.2021)
Thimm, Caja/Bächle, Thomas C. (2018). Autonomie der Technologie und autonome Systeme als ethische Herausforderung. In: Rath, Matthias/Krotz, Friedrich/Karmasin, Matthias (Hrsg.). Maschinenethik – Normative Grenzen autonomer Systeme. Wiesbaden: Springer VS, 73–90.
Thimm, Caja et al. (2019). Die Maschine als Partner? Verbale und non-verbale Kommunikation mit einem humanoiden Roboter. In: Thimm, Caja/Bächle, Thomas Christian (Hrsg.). Die Maschine: Freund oder Feind. Mensch und Technologie im digitalen Zeitalter. Wiesbaden: Springer, 109–134.
Vickers, Ben/K Allado-McDowell (Hrsg.) (2020). Atlas of Anomalous AI. London: Ignota Books.
Westphal, Sarah/Hendriks, Friederike/Malik, Maja (2015). Vertrauenswürdigkeit ohne Vertrauen? Wie die Kommunikation wissenschaftlicher Unsicherheiten die Bewertungen und Entscheidungen von Rezipienten beeinflusst. In: Schäfer, Mike S./Kristiansen, Silje/Bonfadelli, Heinz (Hrsg.). Wissenschaftskommunikation im Wandel. Köln: Herbert von Halem Verlag, 340–364.
Woopen, Christiane/Jannes, Marc (Hrsg.) (2019). Roboter in der Gesellschaft. Technische Möglichkeiten und menschliche Verantwortung. Berlin/New York: Springer.
Zeifman, Igal (2016). Bot Traffic Report 2016. Abrufbar unter: https://www.imperva.com/blog/bot-traffic-report-2016/?redirect=Incapsula (Stand: 19.06.2021)
A Mensch-Mensch-Kommunikation via Maschine
WhatsAppWhatsApp, iMessageiMessage und E-MailE-Mail
Ein Vergleich des technischTechnik Möglichen mit dem tatsächlich Realisierten
Linda Bosshart
1 Einleitung
Die internetbasierte Kommunikation ist ein beliebter Untersuchungsgegenstand der Medienlinguistik, und dies nicht zuletzt deswegen, weil das Feld sehr produktiv ist und sich stetig wandelt. Entsprechend löst die sprachwissenschaftliche Forschung dazu nicht nur Konsens im fachwissenschaftlichen Diskurs aus. So weist beispielsweise Androutsopoulos (2010: 425) darauf hin, dass es falsch sei, in linguistischen Untersuchungen «technisch-mediale[n]» Kontextaspekten gegenüber «sozialen» den Vorrang zu geben – wie dies seiner Meinung nach allzu häufig getan wird. Demgegenüber stellt er die Forderung auf, dass sprachanalytische Zugänge zur Internetkommunikation sowohl die technischenTechnik als auch die soziokulturellen Umstände und die entsprechende Verwobenheit zu berücksichtigen haben (vgl. ebd.: 419). Ziel des vorliegenden Beitrags ist, das Verhältnis zwischen den technischen Gegebenheiten (den ‹Affordanzen›) und dem tatsächlichen (empirisch belegbaren) kommunikativen Verhalten kritisch zu reflektieren. Dazu werden die zwei Messaging-Dienste WhatsAppWhatsApp und iMessageiMessage sowie die Kommunikationsform E-MailE-MailE-Mail1 auf zwei Aspekte hin untersucht und miteinander verglichen: den ‹Grad an SynchronizitätKommunikationsynchrone› und die ‹Verfügbarkeit semiotischer Ressourcen›. Ersteres bezieht sich auf die Frage, in welcher Geschwindigkeit Konversationen ablaufen (können), Letzteres auf die unterschiedlichen multimedialen und multimodalenMultimodalität Möglichkeiten der Textgestaltung.
Die hier vorgenommene Auswahl (WhatsAppWhatsApp, iMessageiMessage und E-MailE-Mail) ist nicht zufällig: Betrachtet man die Literatur der letzten zehn Jahre, so lässt sich feststellen, dass sich medienlinguistische Untersuchungen zu nicht-öffentlicher Kommunikation im Internet zu einem auffallend hohen Anteil dem Thema WhatsApp widmen (vgl. z.B. Arens 2014, Dürscheid/Frick 2014, Pappert 2017). Dieser Messenger-Dienst wurde 2009 von Brian Acton und Jan Koum gegründet und erfreut sich bis heute grosser Beliebtheit. So wurden im Jahr 2020 weltweit 2 Milliarden monatliche NutzerNutzer*in*innen gemessen (vgl. statista.com). Dafür gibt es vermutlich zwei ausschlaggebende Gründe: Erstens vereint WhatsApp die Mobilität der SMS und die quasi-synchrone KommunikationKommunikationquasi-synchrone, wobei die Dienstleistungen den Nutzenden kostenlos zur Verfügung gestellt werden (vgl. Arens 2014: 82). Zweitens ist es irrelevant, ob die Nutzer*innen iOS, Androidandroid oder ein anderes Betriebssystem verwenden, jede*r Smartphonebesitzer*in kann es nutzen. Diese Beliebtheit und die weite Verbreitung der AppApp führten dazu, dass die Kommunikation über WhatsApp zu der zu untersuchenden Kommunikationsform in linguistischen Arbeiten wurde. Mit anderen Worten: Allein schon die Tatsache, dass WhatsApp so viele aktive User*innen hat, macht den Dienst zum legitimen Ausgangspunkt von Untersuchungen.
iMessageiMessage bietet hinsichtlich der Affordanzen sprachwissenschaftlich sogar noch mehr Untersuchungsfelder als WhatsAppWhatsApp, und trotzdem finden sich kaum linguistische Untersuchungen dazu. Das geht vermutlich mit der geringeren Popularität dieses Dienstes einher. In diesem Beitrag wird deshalb auch der Frage nachgegangen, warum iMessage weniger genutzt wird als WhatsApp, obwohl es technischTechnik mehr Möglichkeiten bietet.
Die E-MailE-Mail-Kommunikation gehört klassischerweise nicht zu den Instant-MessagingInstant-Messanging Kommunikationsformen. Es wird sich allerdings zeigen, dass diese Einordnung der E-Mail als asynchroneKommunikationasynchrone Form der Kommunikation heute überholt ist oder zumindest hinterfragt werden muss. Die E-Mail-Kommunikation hat sich in den vergangenen zehn Jahren stark verändert und ist in spezifischen Kontexten mit WhatsAppWhatsApp und iMessageiMessage durchaus vergleichbar, weswegen sie in der folgenden Untersuchung ebenfalls berücksichtigt wird.
Der vorliegende Beitrag ist thematisch zweigeteilt. Zunächst werden die Termini ‹Synchronie› und ‹semiotische Ressourcen› bzw. ‹Multimedialität› und ‹MultimodalitätMultimodalität› aus medienlinguistischer Sicht reflektiert und auf die drei hier zur Diskussion stehenden Messaging-Dienste angewendet: Welchen Grad an SynchronizitätKommunikationsynchrone erlauben die Dienste? Welche Möglichkeiten der multimedialen bzw. multimodalenMultimodalität Kommunikation werden geboten (und welche nicht)? Der zweite Teil ist empirisch bzw. analytisch ausgerichtet. Anhand von je acht Beispielen aus einer privaten Textsammlung wird untersucht, ob die technischenTechnik Möglichkeiten (so) genutzt werden, wie dies erwartbar wäre. Dazu sei an dieser Stelle bereits angemerkt: Natürlich lässt ein aus 24 Beispielen bestehendes Korpus keine verallgemeinerbaren Aussagen zu, Tendenzen und Trends sind jedoch ablesbar. Zum aktuellen Zeitpunkt stehen leider keine im deutschsprachigen Raum erfasste, umfassende Korpora zur Verfügung, die dem gegenwärtigen technischenTechnik Stand entsprechen würden und die sich auf alle drei hier untersuchten Kommunikationsformen beziehen. Die häufig verwendeten Daten des Dortmunder-Chatkorpus2 beispielsweise wurden in den Jahren 2002 bis 2008 erhoben und sind damit für gegenwartsbezogene Fragestellungen nur bedingt aussagekräftig (vgl. Storrer 2017: 257). Ein SNF-Projekt3 widmete sich dem Erstellen eines SMS-Korpus’. Das Projekt dauerte von 2011 bis 2014 und startete damit kurz bevor die SMS als mobile Kommunikationsform des Alltages deutlich an Relevanz zu verlieren begann. Einzig interessant für die Forschungsinteressen dieses Beitrags ist ein Korpus, das aus WhatsAppWhatsApp-Daten besteht.4 Dieses Korpus war zum Zeitpunkt der Abfassung des vorliegenden Beitrags jedoch noch nicht verfügbar.
2 Das technischTechnik Mögliche
2.1 Synchronie
In sprachwissenschaftlichen Abhandlungen zu digitaler KommunikationKommunikationdigitale wird dem Grad an SynchronizitätKommunikationsynchrone eine bedeutende Rolle zugeschrieben. Dabei handle es sich, so wird argumentiert, um einen wesentlichen Einflussfaktor auf den sprachlichen Duktus. So heisst es z.B. bei Storrer (2017: 272): «Insbesondere die synchronenKommunikationsynchrone internetbasierten Kommunikationsformen sind in vielen Merkmalen der Nähekommunikation zuzuordnen». Dürscheid (2016: vgl. 367) wirft in diesem Zusammenhang die grundsätzliche Frage auf, ob in der internetbasierten Kommunikation Nähe über sprachliche Mittel hergestellt wird oder ob die sprachlichen Mittel der Nähe aus dem Umstand resultieren, dass es sich um eine quasi-synchrone KommunikationKommunikationquasi-synchrone handelt. Anders formuliert: Ist SynchronieKommunikationsynchrone ein Mittel zum Zweck, um Nähe auszudrücken, oder ist sie der Auslöser für den nähesprachlichennähesprachlich Duktus? Das ist auch die Leitfrage im vorliegenden Beitrag: Motiviert alleine die Technologie zu einem spezifischen (nähesprachlichen) Sprachhandeln und unterwirft die NutzerNutzer*in*innen damit den Affordanzen? Oder nutzen sie diese aktiv und bewusst, um damit ein bestimmtes kommunikatives Ziel zu erreichen?
Der Faktor ‹SynchronieKommunikationsynchrone› bezieht sich bekanntlich auf die Geschwindigkeit eines möglichen Feedbacks innerhalb einer Kommunikationsform. Bei einem Face-to-Face-GesprächFace-to-Face-Gespräch ist diese Geschwindigkeit maximal hoch. Gesprächsteilnehmer*innen können die sprechende Person noch während der Produktion eines sprachlichen Inhalts unterbrechen und an Gesagtes anknüpfen. Man spricht in diesem Fall von einer «synchronenKommunikationsynchrone mündlichen Kommunikation» (Dürscheid 2003: 9). Asynchrone KommunikationKommunikationasynchrone hingegen liegt vor, wenn die Sprechsituation «zerdehnt» ist (Ehlich 1981, zitiert nach Dürscheid 2003: 9), wenn also zwischen Produktion und Rezeption eines Inhaltes ein bestimmter Zeitraum liegt. Ein weiteres Merkmal asynchroner KommunikationKommunikationasynchrone besteht darin, dass kein gemeinsamer Kommunikationsraum vorliegt, der Kanal folglich immer nur von einer Seite her geöffnet ist (vgl. ebd.): Produktion und Rezeption finden zeitlich versetzt statt. Obwohl Beiträge in Chats durchaus in sehr hoher Geschwindigkeit aufeinander folgen können, können die Gesprächsteilnehmenden während der Produktion eines Beitrages nicht unterbrochen werden: «Eine Äußerung kann erst nach Abschluss des Produktionsvorgangs vom Partner rezipiert und somit von diesem auch nicht unterbrochen oder sprachbegleitend kommentiert werden» (Thaler 2007: 158). Gesprächslinguistisch fasst Dürscheid (2003: 8) die Situation folgendermassen zusammen: «Die SynchronieKommunikationsynchrone gilt also nur turnweise, nicht zeichenweise». Die Gesprächsteilnehmenden werden stets mit einem Schreibprodukt, nicht aber mit der Schreibaktivität des oder der Produzent*in konfrontiert (vgl. ebd.: 9). Um diese – damals – neue Situation sprachwissenschaftlich fassbar zu machen, führte Dürscheid (2003) den Ausdruck ‹quasi-synchronKommunikationquasi-synchrone› ein.
Mit Bezug auf Dennis/Valacich (1999) diskutiert Thaler (2007) drei Faktoren, die sich auf die SynchronieKommunikationsynchrone auswirken. Zunächst nennt sie die ‹Überarbeitbarkeit›: Je leichter ein Beitrag im Nachhinein oder während der Produktion überarbeitet werden kann, desto ‹asynchronerKommunikationasynchrone› ist die Kommunikation. Ein weiterer Faktor ist die ‹Parallelität›. Je mehr schriftliche DialogeDialog parallel ablaufen können, desto ‹asynchronerKommunikationasynchrone› werden sie. Bei der ‹Wiederverwertbarkeit› geht es darum, dass eine Kommunikation umso ‹asynchronerKommunikationasynchrone› ist, je besser im Nachhinein auf einen Beitrag zurückgegriffen werden kann (vgl. Thaler 2007: 167–175).
Halten wir fest: Je stärker die Faktoren in die eine oder andere Richtung ausgeprägt sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich dies auf den sprachlichen Duktus auswirkt. Grundsätzlich gilt: Je ‹synchronerKommunikationsynchrone›, desto spontaner, sprachlich weniger reflektiert und weniger geplant (vgl. Dürscheid 2003: 11).
2.1.1 WhatsAppWhatsApp
TechnischTechnik gesehen erlaubt es WhatsAppWhatsApp, mit Gesprächsteilnehmenden sowohl quasi-synchronKommunikationquasi-synchrone wie auch asynchronKommunikationasynchrone zu kommunizieren. Wenn beide (oder mehrere) Gesprächsteilnehmende die AppApp und die entsprechende Konversation gleichzeitig geöffnet haben, kommunizieren sie quasi-synchronKommunikationquasi-synchrone. Die Gesprächsteilnehmenden können solch eine quasi-synchrone KommunikationKommunikationquasi-synchrone an der entsprechenden Anzeige identifizieren: Produziert der oder die Kommunikationspartner*in gerade einen Beitrag, wird vom System darüber informiert. Dabei unterscheidet WhatsApp auch zwischen den Medialitäten. So kann es sein, dass es heisst, xy «schreibt» gerade oder dass aktuell eine «Tonaufnahme läuft». Push-NachrichtenMedium/Medien1 in WhatsApp ermöglichen es, Beiträge unmittelbar nach dem Absenden zu rezipieren und darauf zu antworten. Dies ist auch dann der Fall, wenn die oder der Rezipient*in die App nicht geöffnet hat. Charakteristisch ist weiter, dass für die Gesprächspartner*innen nicht nur ersichtlich ist, ob eine Nachricht rezipiert wurde,2 sondern auch deutlich wird, ob die angeschriebene Person die App geöffnet hat («online» ist). Dieser Faktor erhöht die soziale KontrolleKontrolle: Man könnte unter Rechtfertigungsdruck geraten, weil man Nachrichten zur Kenntnis genommen hat, jedoch nicht darauf reagiert. Daraus lässt sich die Vermutung ableiten, dass über WhatsApp ‹synchronerKommunikationsynchrone› kommuniziert wird als über andere Instant-MessagingInstant-Messanging-Dienste.
Allerdings zeichnet sich WhatsAppWhatsApp auch durch Merkmale der asynchronen KommunikationKommunikationasynchrone aus. Denn wendet man die drei oben genannten Faktoren ‹Überarbeitbarkeit›, ‹Parallelität› und ‹Wiederverwertbarkeit› auf WhatsApp an, wird deutlich, dass technischTechnik gesehen all dies umstandslos möglich ist: Beiträge können redigiert werden, ehe sie versendet werden.3 Es ist auch möglich, «gleichzeitig» mehrere Konversationen zu bedienen, d.h. schnell zwischen den «Chats» hin- und herzuwechseln. Auf Nachrichten kann später einfach zurückgegriffen werden, indem nach oben gescrollt oder im Suchfeld ein Suchbegriff eingegeben wird. Alle Konversationen werden protokolliert.
2.1.2 iMessageiMessage
Ähnlich wie WhatsAppWhatsApp informiert iMessageiMessage darüber, ob der oder die Konversationspartner*in gerade einen schriftlichen Beitrag produziert. Wird ein mündlicher Beitrag (eine Audiodatei) produziert, wird dies allerdings nicht angezeigt. Im Unterschied zu WhatsApp zeigt iMessage zudem weder an, ob die andere Person «online» ist oder wann sie die AppApp zuletzt geöffnet hat, noch ob sie die Nachricht gelesen hat. Zwar lässt sich einstellen, dass eine Lesebestätigung angezeigt wird, dies gehört aber nicht zur Default-Einstellung. Angezeigt wird jedoch, ob eine Nachricht dem oder der Empfänger*in zugestellt worden ist.
In Bezug auf die drei von Dennis/Valacich genannten Faktoren zur Ermittlung des Grades an SynchronizitätKommunikationsynchrone lassen sich dieselben Aussagen wie bei WhatsAppWhatsApp treffen: Die Beiträge sind – vor dem Absenden, aber nach der ersten Produktion – überarbeitbar. Mehrere Konversationen können gleichzeitig geführt werden, und schriftliche Beiträge sind im Nachhinein über die Suchfunktion oder durch Scrollen abrufbar. TechnischTechnik gesehen lässt iMessageiMessage demzufolge denselben Grad an SynchronizitätKommunikationsynchrone zu, wie dies bei WhatsApp der Fall ist. Weil jedoch nicht angezeigt wird, wann der oder die Gesprächspartner*in zuletzt online war, besteht ein wesentlicher Unterschied hinsichtlich der sozialen KontrolleKontrolle.
2.1.3 E-MailE-Mail
Obwohl es unterschiedliche E-MailE-Mail-Messaging-Dienste gibt, unterscheiden sie sich technischTechnik nicht wesentlich voneinander. E-Mails werden klassischerweise zur asynchronen KommunikationsformKommunikationasynchrone gezählt. Im Jahr 2007 verweist Thaler auf E-Mails als Extrembeispiel asynchronerKommunikationasynchrone, computervermittelter Kommunikation. Sie spricht von einer «fehlenden Geschwindigkeit des Feedbacks, welche durch die technische Infrastruktur der Kommunikationsform E-Mail bedingt ist» (Thaler 2007: 171), denn es sei keine spontane Übernahme der Produzent*innenrolle möglich (vgl. ebd.). Im Jahr 2020 müssen diese Begründungen kritisch betrachtet und die Rahmenbedingungen der E-Mail-Kommunikation neu beurteilt werden. Die Geschwindigkeit des Feedbacks wird durch die Möglichkeit, E-Mails auch mobil – d.h. unterwegs – zu lesen und zu beantworten, stark erhöht. Hinzu kommt: Wer Push-Nachrichten für E-Mails aktiviert hat, kann diese genauso schnell rezipieren, wie dies bei WhatsAppWhatsApp- und iMessageiMessage-Nachrichten der Fall ist. Es ist, wiederum wie bei den beiden anderen Diensten, zudem auch nicht mehr notwendig, den Kommunikationskanal für Produktion oder Rezeption der Nachrichten jedes Mal aufs Neue zu öffnen (sofern eine funktionierende Internetverbindung vorhanden ist). Im Unterschied zu WhatsApp und iMessage weiss der oder die Verfasser*in eines Beitrages in der Regel aber nicht, ob die angeschriebene Person die Mail gelesen hat, wann sie zuletzt online war und ob die Nachricht überhaupt zugestellt worden ist.1 Vielleicht sind gerade deswegen bei längeren Abwesenheiten automatisch generierte Nachrichten üblich geworden, in denen darüber informiert wird, wann man wieder erreichbar ist.
Eine interessante, E-MailE-Mail-spezifische Möglichkeit ist die Planung des Sendezeitpunktes, die es erlaubt, individuell eine Zeitspanne zwischen Produktion und Versenden einer Mail zu definieren. Diese Möglichkeit kann zur AsynchronieKommunikationasynchrone beitragen. Allerdings ist es keine Default-Einstellung, dass nach dem Zeitpunkt gefragt wird, wann eine Mail versendet werden soll. Es ist eher üblich, zwischen dem Abschluss der Produktion und dem Versenden keine Zeitspanne einzuplanen.
Die technischenTechnik Voraussetzungen für die Geschwindigkeit des Feedbacks (und damit den Grad an SynchronizitätKommunikationsynchrone) sind bei E-MailE-Mails demzufolge zwar nicht identisch mit iMessageiMessage und WhatsAppWhatsApp, aber dennoch vergleichbar. Es ist rein technischTechnik gesehen genauso möglich, in Sekundenschnelle Nachrichten hin- und herzuschicken. Dazu muss der Kanal nicht jedes Mal neu geöffnet, sich nicht jedes Mal neu eingeloggt werden. Und ähnlich wie bei den anderen beiden Messaging-Diensten gilt: Bevor eine Nachricht verschickt wird, kann sie problemlos überarbeitet werden; auch eine ‹Parallelität› mehrerer Konversationen ist möglich. Der Faktor der ‹Wiederverwertbarkeit› ist besonders stark ausgeprägt. Weil E-Mails meistens mit einer Betreff-Zeile ausgestattet sind, sind Beiträge im Nachhinein noch leichter abrufbar als bei den anderen beiden Diensten. Dazu kommt, dass Mails als Favoriten markiert werden können, wodurch wichtigere Inhalte noch schneller wiedergefunden werden können. Im Sinne von Dennis/Valacich (1999) tragen diese Faktoren zur Asynchronie der KommunikationKommunikationasynchrone bei.