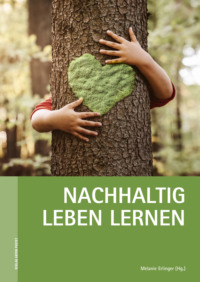Kitabı oku: «Nachhaltig leben lernen», sayfa 2
6.Bis jetzt gut gegangen
Aber ist nicht bis jetzt alles gut gegangen mit dem Klimawandel? Warmzeiten waren in der Vergangenheit doch immer gute Zeiten und Kaltzeiten dagegen immer unangenehm. Schlechtes Wetter hat sogar das Römische Imperium zu Fall gebracht, als nach dem berühmten „Römischen Klimaoptimum“ ein verändertes Klima und darauffolgende schlechte Ernten Völker zum Wandern brachten. Und interessanterweise sind wir ja bis jetzt auch mit den unleugbaren Veränderungen der Klimaerwärmung gut zurechtgekommen. Nach einer Studie der Universität für Bodenkultur und der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Grafik 3) hat zwar die Bautätigkeit genauso zugenommen wie die Starkniederschläge und die Murenabgänge, aber mit dem massiven Ausbau der Schutzbauten haben wir bis jetzt alles gut kompensiert.

Grafik 3: Die Zahl der schadbringenden Muren (erstes Bild von oben) nahm in den letzten Jahrzehnten in Österreich nicht zu. Der Grund ist, dass der massive Ausbau von Schutzanlagen (zweites Bild von oben) die Auswirkungen von mehr Bebauung in exponierten Lagen (drittes Bild von oben) und mehr Starkregen (unterstes Bild) kompensiert hat. Dargestellt sind die Daten von rund 12 000 Muren, die im Zeitraum 1961 bis 2017 Schäden verursachten. Muren ohne Schäden sind nicht berücksichtigt. Quelle: ZAMG/BOKU.
Das hört sich gut an. Das Problem ist nur, dass wir erst am Anfang des Klimawandels stehen. Ob wir zukünftige Naturkatastrophen dann so leicht verkraften, wenn wir nichts gegen die Klimaerwärmung unternehmen, ist die große Frage und zu bezweifeln – sehr teuer wird es auf jeden Fall.
7.Die Zukunft liegt in unseren Händen
Wird es in Zukunft öfter zu solch extremen Sommern kommen? Egal, ob zu nass oder zu trocken? Das ist zu befürchten. Was bis Ende des 20. Jahrhunderts normal war – Sommer mit einer raschen Abfolge von Sonne und Regen – sollte seltener werden. Wieso wir das so genau zu wissen glauben? Der Klimawandel hat ein Gefälle. Die Erwärmung ist an den Polen stärker als am Äquator. Dadurch schwächt sich auch der Temperaturunterschied zwischen der polaren Kaltluft und der äquatorialen Warmluft ab. Als Folge haben Tiefdruckgebiete weniger zu tun. Ihre Aufgabe ist es ja, den Temperaturunterschied zwischen Äquator und Polen in einer Art nie endenden Sisyphusarbeit abzubauen. Das macht die Tiefdruckgebiete, wie schon beschrieben, zunehmend träger und ortsfester. Das Grundübel des vergangenen Sommers.
Damit ist der aktuelle Klimastatus wie folgt zu sehen: Die Verkettung weltweiter Naturkatastrophen im Sommer 2021 – von Tornados, verheerenden Waldbränden bis zu schwersten Überschwemmungen – ist ein Weckruf des laufenden Klimawandels. Verheerende Dürren mit Ernteausfällen und Waldbränden oder sintflutartige Regenfälle mit noch mehr Überschwemmungen und Murenabgängen sind auch in den Alpen wahrscheinlicher als früher und können uns schon nächsten Sommer treffen. Damit werden wir aber zu leben lernen müssen. Trotzdem müssen wir jetzt handeln: Der Klimawandel hat wie ein schwerer Ozeanriese Fahrt aufgenommen und in den Alpen ist er weitergefahren als im globalen Mittel (Grafik 4). Weltweit ist es am Ende des 19. Jahrhunderts um ca. 1 Grad Celsius wärmer geworden, in Österreich dagegen schon um knapp 2 Grad Celsius. Wenn wir von unserem fossilen Weg nicht abkommen, sind es bis zum Ende des Jahrhunderts 5 Grad Celsius. Eine Welt, wie wir sie in der gesamten Geschichte der menschlichen Besiedlung der Alpen nicht erleben mussten.

Grafik 4: Klimaprojektionen für Österreich. Wenn die Welt von Kohlendioxid und Methan loskommt, bremsen wir in Österreich die Erwärmung bei guten 2 Grad Celsius ein (hellgrauer Bereich). Gelingt uns das nicht, werden es bis zum Ende des Jahrhunderts 5 Grad Celsius (dunkelgrauer Bereich). Quelle: ZAMG.
Für unsere Zivilisation – auch in den Alpen! – wird es zur Überlebensfrage, wie weit die Klimaerwärmung über 2050 voranschreitet und wie heftig die Auswirkungen werden. Alles entscheidet sich in den kommenden 20 bis 30 Jahren. Wir müssen raus aus der fossilen Öl- und Kohlewirtschaft, um den Klimawandel bis 2050 zu bremsen. Die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder hängt davon ab. Nur Mut, es ist noch zu schaffen!
Literatur
Pfister, Christian (1999): Wetternachhersage. 500 Jahre Klimavariationen und Naturkatastrophen (1496–1995). Bern/Stuttgart/Wien: Verlag Paul Haupt.
ZAMG (Stand 01.08.2018): Österreichs Seen werden immer wärmer. Online: https://www.zamg.ac.at/cms/de/klima/news/oesterreichs-seen-werden-immer-waermer [06.09.2021]
Die verwendeten Grafiken stammen von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG)/www.zamg.ac.at sowie vom Deutschen Wetterdienst (DWD)/www.dwd.de.
Barbara Benoist-Kosler
Gemeinsam Zukunft gestalten – Bildung für nachhaltige Entwicklung im Kindergarten ermöglichen
Zusammenfassung
In der Gegenwart nachhaltig leben lernen und sich an der Gestaltung einer naturverträglichen, wirtschaftlich ausgewogenen, sozial gerechten und kulturell vielfältigen Weltgesellschaft zu beteiligen, kann im Kindergarten beginnen. Kinder haben ein Anrecht darauf. Elementare Bildungseinrichtungen wie der Kindergarten bieten viele Anschlussmöglichkeiten: Sei es in der Art des Umgangs miteinander, den Beteiligungsformen, denen bestimmte Werthaltungen zugrunde liegen, den Alltagspraktiken und der Betriebsführung, die Vorbild und informelle Lerngelegenheiten sein können, oder bei der Auswahl und Bearbeitung der Themen und angebotenen Bildungsgelegenheiten. Bildung für nachhaltige Entwicklung als motivierendes Konzept kann die Arbeit rahmen, kann dabei Orientierung bieten und zur Qualität der Bildungsarbeit beitragen.
1.Einleitung
Die Gestaltung unserer Zukunft beginnt jetzt, in der Gegenwart: In der Art, wie wir mit unseren natürlichen Lebensgrundlagen umgehen und wie wir die Zeichen der Natur – etwa die jüngsten Naturkatastrophen beispielsweise – deuten und welche Konsequenzen wir daraus ziehen. Wir entscheiden darüber in der Art unserer Lebensführung und Wirtschaftsweise, unserer Konsum- und Mobilitätsgewohnheiten, aber auch in der Art unseres Zusammenlebens miteinander, unserer Umgangsweisen, unserer Werthaltungen und politischen Orientierung. Das gilt sowohl für unser persönliches Tun im Alltag, als auch in größeren Zusammenhängen wie Zivilgesellschaft, Politik, Wirtschaft, Kulturbetrieb oder Bildungswesen. Ingrid Pramling Samuelson, die den UNESCO-Lehrstuhl für frühkindliche Bildung und nachhaltige Entwicklung an der Gothenburg University in Schweden inne hat, antwortet im Blog „Childhood, public space and communitiy“ auf die Frage, warum Bildung für nachhaltige Entwicklung in der Frühpädagogik bedeutsam wäre: „Wir können uns zwar im Elementarbereich nicht mit allem befassen, aber wir können die Anwälte der Kinder in Kinder betreffenden Fragen auf allen Ebenen von der Politik bis zur Praxis sein“ (OMEP 2020, übersetzt durch die Autorin). Dem liegt das Bewusstsein zugrunde, dass alles, was in der Gesellschaft geschieht, Auswirkungen auf Kinder hat. Deshalb beziehen sich alle Bemühungen nachhaltiger Entwicklung auf das Wohlergehen, das Lernen und Überleben von Kindern – jetzt und für ihr zukünftiges Leben. Gleichzeitig sind Kinder ein Teil unserer Gesellschaft, mit eigenen Sichtweisen und Kompetenzen, mit eigenen Rechten und eigener Agency, die Gegenwart und Zukunft aktiv mitgestalten.
1.1.Nachhaltige Entwicklung: eine Aufgabe für die ganze Welt
Bereits 1992 haben sich die Vereinten Nationen auf der 2. Weltkonferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro auf eine Orientierung am Leitbild nachhaltiger Entwicklung geeinigt und damit den politischen Willen zur Transformation bekundet. Nachhaltige Entwicklung ist im Bericht „Our common future“ der UN-Kommission für Umwelt und Entwicklung (Brundtland-Kommission), der die Arbeitsgrundlage für den Erdgipfel gebildet hat, definiert (WCED 1987, S. 43):
„Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. It contains within it two key concepts:
—the concept of ‚need‘ in particular the essential needs of the world’s poor, to which overriding priority should be given; and
—the idea of limitations imposed by the state of technology and social organization on the environment’s ability to meet present and future needs.“
Im Mittelpunkt steht also die Zukunftsverantwortung gegenüber den jetzt lebenden und künftigen Generationen sowie Verteilungsgerechtigkeit – und damit bessere Lebensbedingungen aller heute lebenden Menschen, aber auch Ressourcenschutz und der Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen für unsere Nachkommen. Die Definition ist Bezugspunkt für die Nachhaltigkeitswissenschaften (Grunwald/Kopfmüller 2012, S. 23f.; Michelsen/Adomßent 2014, S. 12f) und Referenz für Bildung für nachhaltige Entwicklung (Kosler 2016, S. 36).
Als globaler Handlungsplan für die Beschlüsse des Erdgipfels 1992 von Rio de Janeiro wurde die Agenda 21 von den Vereinten Nationen verabschiedet. Kapitel 36 betont die Bedeutung von Bildung und die Neuausrichtung des gesamten Bildungssystems an nachhaltiger Entwicklung (Hopkins 2012). Die Agenda 21 ist an dieser Stelle heute noch erwähnenswert, da explizit auch auf die Rolle von Kindern im Partizipationsprozess einer nachhaltigen Entwicklung eingegangen wird.
Für die Entwicklung von frühkindlicher Bildung für nachhaltige Entwicklung war ein glücklicher Umstand, dass die schwedische Wissenschafterin Ingrid Pramling Samuelson 2008 sowohl den UNESCO Lehrstuhl für frühkindliche Bildung und nachhaltige Entwicklung übertragen bekommen hat, als auch von 2008–2015 Präsidentin der Weltorganisation für frühkindliche Bildung (OMEP)1 wurde. So findet seit der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung 2005–2014“ in allen Gremien und Dokumenten der elementare Bildungsbereich Erwähnung und es engagieren sich weltweit sowohl Wissenschafterinnen und Wissenschafter als auch Elementarpädagoginnen und Elementarpädagogen in der Praxis für frühkindliche Bildung für nachhaltige Entwicklung. Zusammenfassendes Ergebnis des Monitorings für den frühkindlichen Bildungsbereich der UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung 2005–2014“ in Deutschland ist, dass Bildung für nachhaltige Entwicklung „als ein für bedeutsam erachtetes Lern- und Handlungsfeld aufgegriffen wurde“ (Singer-Brodowski 2017, S. 65), aber auch noch ein „beachtliches Entwicklungspotential“ (Singer-Brodowski 2017, S. 65) bestünde. Hingewiesen wird vor allem auf die Schwierigkeit der Implementierung von Bildung für nachhaltige Entwicklung in die Bildungspläne, Curricula und Studienordnungen (vgl. Singer-Brodowski 2017, S. 65). In der „Österreichischen Strategie zur Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 2008 ist neben dem Schulsystem die „Vorschulische Bildung“ (Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft et al. 2008, S. 16) explizit als ein Handlungsfeld genannt. Es wird als Aufgabe der Bundesministerien gesehen, im Bereich der formalen Bildung geeignete Maßnahmen zur Verankerung der Prinzipien von Bildung für nachhaltige Entwicklung zu fördern. Realisiert wurden in Deutschland wie in Österreich vor allem Praxisprojekte. Das Engagement ging dabei vor allem von Vereinen und Verbänden aus, die sich für Umwelt, Natur und globales Lernen engagieren. Im internationalen Kontext ist frühkindliche Bildung für nachhaltige Entwicklung stärker im wissenschaftlichen Diskurs verortet und hier – auch durch das Engagement der OMEP – näher an der Kindheitspädagogik und -forschung als an den Umwelt- und Nachhaltigkeitswissenschaften. Die Forschungsarbeiten richten sich auf das „Was“ und das „Wie“: also was unter Bildung für nachhaltige Entwicklung in der elementaren Bildung verstanden werden kann (z.B. Ärlemaalm-Hagsèr/Sandberg 2011; Dyment et al. 2014; Grindheim et al. 2019; Kennelly et al. 2008; McNaughton 2012; Stoltenberg et al. 2013; Stoltenberg/Thielebein 2011) und wie Bildung für nachhaltige Entwicklung in elementaren Bildungseinrichtungen weltweit ermöglicht wird (einen Überblick auf alle Kontinente bieten: Siraj-Blacheford/Mogharreban/Park 2016, UNESCO 2012).
1.2.Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung
Aktuell bedeutsam ist das Grundlagendokument zur Transformation hin zu einer nachhaltigen Entwicklung, das die Vereinten Nationen im September 2015 verabschiedet haben. Alle 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen verpflichteten sich darin, die in der Agenda 2030 enthaltenen 17 nachhaltigen Entwicklungsziele („Sustainable Development Goals“, kurz: SDGs) sowie 169 Unterziele auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene umzusetzen. Die Agenda 2030 widmet sich insbesondere fünf Kernanliegen: Dem Menschen, unserem Planeten Erde, dem Wohlstand, dem Frieden und der Partnerschaft (United Nations 2015, S. 5f.). Der Aktionsplan zielt darauf ab, Armut und Hunger überall auf der Welt zu beenden, Ungleichheit in und zwischen Ländern zu minimieren, Menschenrechte für alle zu verwirklichen und Geschlechtergleichstellung und Selbstbestimmung aller Frauen und Mädchen zu erreichen. Einer der Schlüsselsätze der Agenda 2030 lautet „No one will be left behind“ (United Nations 2015, S. 6).
In der Agenda 2030 widmet sich das SDG 4 der Bildung. Das Ziel ist es, „inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung [zu] gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle [zu] fördern“ (Vereinte Nationen 2015, S. 15). Dieses Ziel konkretisiert in sieben Unterpunkten Handlungsebenen, um durch Bildung gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Gleichzeitig trägt Bildung wesentlich zur Verwirklichung der anderen sechzehn SDGs bei. Im Unterpunkt 4.2 wird ausdrücklich die Zielsetzung einer qualitativ hochwertigen frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung aller Kinder weltweit gefordert, auch um einen erfolgreichen Übergang in die Schule zu ermöglichen (Vereinte Nationen 2015, S. 18). Im SDG 4.7 kommt zum Ausdruck, dass zugleich allen Lernenden ermöglicht werden soll, durch Bildung für nachhaltige Entwicklung Kenntnisse und Fähigkeiten zu erwerben, um eine nachhaltige Entwicklung mitgestalten zu können und einen ebensolchen Lebensstil zu praktizieren. Die Mitglieder der Gesellschaft sollen außerdem befähigt sein, für Menschenrechte, Geschlechtergleichstellung, Frieden und Gewaltfreiheit, Weltbürgerschaft und kulturelle Diversität einzutreten (Vereinte Nationen 2015, S. 18).
Bildung für nachhaltige Entwicklung wird also als eine weltweite Aufgabe kommuniziert, um eine nachhaltige Entwicklung zu realisieren. Dem liegt das Verständnis zugrunde, dass nur über breite gesellschaftliche Akzeptanz und Engagement die Ziele nachhaltiger Entwicklung zu erreichen sind. Dafür braucht es Wissen und Kompetenzen sowie Werthaltung und Bewusstsein für inter- wie intragenerationale Gerechtigkeit und den Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. Bildung ist sowohl Teil des Gestaltungsprozesses einer nachhaltigen Entwicklung als auch dessen Voraussetzung.
2.Bildung für nachhaltige Entwicklung im Kindergarten ermöglichen
Zugleich kann Bildung für nachhaltige Entwicklung aber auch als ein motivierendes Konzept verstanden werden, das Bildungsprozessen zugrunde liegt (vgl. Stoltenberg 2014, S. 48). Im Folgenden soll das für die Institution Kindergarten skizziert werden.
Bildungskonzepte zeichnet aus, dass ein bestimmtes Bild vom Kind und eine bestimmte Werteorientierung Ausgangspunkte sind, damit pädagogische Prinzipien wirksam werden. Darüber hinaus zeichnet sie aus, dass Ziele der Arbeit und Bildungsbereiche definiert sind und Aussagen über die Zusammenarbeit im Team, bis hin zur Betriebsführung gemacht werden. Die Orientierung an einem ethischen Leitbild, das Gerechtigkeit und den Erhalt natürlicher Lebensgrundlagen in den Mittelpunkt stellt und sich daraus ableitende Prinzipien wie Partizipation oder Gemeinwesenorientierung können helfen, das Profil einer Einrichtung zu schärfen. Die erhöhte Reflexionsfähigkeit des pädagogischen Teams, die Ausrichtung an zukunftsrelevanten Themenstellungen, die Auswahl entsprechender Arbeitsweisen und Methoden können zur Qualitätsentwicklung und Professionalisierung beitragen.
Tassilo Knauf zeichnet nach, dass pädagogische Ansätze sich oft aus einer Kritik an „hergebrachten pädagogischen Alltagspraktiken mit der Neuentwicklung pädagogischer Ideen“ (Knauf 2009, S. 118) entwickeln. Am Beispiel des „Reggio Emilia Approach“ lässt sich sehr gut veranschaulichen, dass eine sinkende Akzeptanz tradierten pädagogischen Handelns nicht selten mit einer Zeit- und Gesellschaftskritik einhergeht:
Es war im April 1945, als in Villa Cella, dem damaligen Vorort der italienischen Stadt Reggio Emilia, Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner bei den Aufräumarbeiten nach dem Zweiten Weltkrieg in den Trümmern einen Panzer fanden. Sie schlossen sich zusammen, um zu überlegen, was sie mit dem Erlös des Materialverkaufs für das Dorf anfangen sollten. Es waren die oft durch den Krieg alleinerziehenden Frauen, die eine schon länger gehegte Idee in die Tat umsetzen wollten: „Wir wollen eine Stätte für Kinder bauen. Die beste Antwort auf den Krieg ist ein Kindergarten, in dem wir eine neue Generation und uns selbst erziehen“ (Dreier 1993, S. 17, übersetzt/zitiert nach Barazzoni 1985). So entsteht der erste Volkskindergarten als partizipatives Gemeinschaftsprojekt, aus dem heraus mit anderen Einrichtungen der „Reggio Emilia Approach“ erwächst. Loris Malaguzzi, zu der Zeit noch Lehrer, begleitet und dokumentiert den Prozess, leitet dann später die kommunalen Kindergärten von Reggio Emilia und gilt heute meist als Begründer des pädagogischen Ansatzes. Nach den schrecklichen Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges und der nationalsozialistischen Diktatur waren es Werte wie Freiheit, Toleranz und Partizipation, die in den Mittelpunkt rückten. Es wurde ein neues Menschenbild hervorgebracht und damit verbunden das Bewusstsein für ein neues Bildungsverständnis und eine neue Lernkultur, die einen anderen pädagogischen Ansatz bedingt. Wohl in dem Wissen darüber, dass alles, was in unserer Gesellschaft passiert, Auswirkungen auf die Kinder hat – und zwar in der Gegenwart wie in der Zukunft.
Auf Bildungskonzepte bezogen, kann man Bildung für nachhaltige Entwicklung nun als Antwort auf die sozialen, kulturellen, ökologischen und ökonomischen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts verstehen.
2.1.Ziel einer Bildung für nachhaltige Entwicklung
Als Ziel einer Bildung für nachhaltige Entwicklung formuliert Ute Stoltenberg: „Ziel ist nicht ein Wissenskanon, sondern eine Persönlichkeit, die sich ermutigt und fähig fühlt, das eigene Leben mitzugestalten, und die über Wissen und Kompetenzen verfügt, dies im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung zu tun“ (Stoltenberg 2009, S. 4). Dem liegt ein Bildungsverständnis zugrunde, das Hans-Christoph Koller mit Rainer Kokemohr (2007) und Winfried Marotzki (1990) als Veränderung des Welt- und Selbstverhältnisses und damit als „transformatorische Bildung“ (Koller 2012, S. 9) beschreibt. Niemand weiß, welches Wissen die heutigen Kindergartenkinder in 20 oder 30 Jahren brauchen werden, um die sich ihnen dann stellenden Aufgaben und Herausforderungen bewältigen zu können. Aber was wir erahnen können ist, dass Vertrauen in die eigene Person und die Gemeinschaft hilfreich sein werden sowie Mut, Bereitschaft und Motivation sich zu beteiligen und andere teilhaben zu lassen. Das Anerkennen von Vielfalt und der Respekt vor unseren „Mitwesen“ und kulturellen Errungenschaften sowie Interesse an bzw. Neugierde auf andere Sichtweisen, Praktiken oder Ideen werden in einer wachsenden Weltgesellschaft als Grundpfeiler für Frieden und Verständigung hilfreich sein.
Orientiert sich ein Kindergarten im Sinne des „Whole Institution Approach“ (DUK o.J.) ganzheitlich – wie ein roter Faden, der sich durch die Institution zieht – an Bildung für nachhaltige Entwicklung, ermöglicht das im oben beschriebenen Sinn die reflexive Auseinandersetzung mit Gegenwartsund Zukunftsfragen.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.