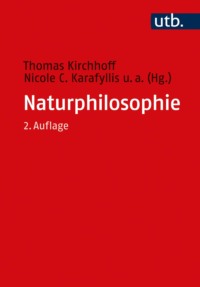Kitabı oku: «Naturphilosophie», sayfa 6
5.2 Natur als Norm?
Im Mittelalter hatte die Natur auch den Charakter einer durch den Schöpfungsratschluss begründeten Norm. Mit dem Aufkommen von Humanismus und Renaissance beginnt der Mensch an sich selbst Maß zu nehmen und die Natur zunehmend als seinen Gestaltungsraum zu entdecken. Der Mensch selbst wird zum Maß der Dinge, und im Zusammenspiel mit dem Entstehen der neuzeitlichen Wissenschaft wird Natur zunehmend als Raum und Material verstanden, dem der Gestaltungswille des Menschen gegenüber steht. Im Lichte einer mathematischen Beschreibung der Natur (→ I.3), wie sie sich zunächst an den Himmelserscheinungen erprobt und dann auf die Fallgesetze und anderes ausgeweitet wird, erscheint der Schöpfer weniger als inneres Wirk- und Erhaltungsprinzip der Schöpfung denn als ihr Konstrukteur. Entsprechend sollen die Menschen durch Einsicht in die Gesetze der Schöpfung befähigt werden, sich die Natur durch Technik verfügbar zu machen und zu „Meistern und Besitzern der Natur“ (Descartes [1637] 1997: 101) aufzuschwingen.
5.3 Wandlungen im Naturbegriff
War die von Augustinus inspirierte Wendung ‚Buch der Natur‘ (liber naturae) mit einer Betonung des Abbild- und Gleichnischarakters der Welt im Mittelalter durchgängig vertreten worden, so lassen die Durchbrüche in der Kosmologie der frühen Neuzeit die Unabhängigkeit des Buches der Natur und des Zugangs zu seinem Verständnis in neuem Licht erscheinen (→ I.1). Johannes Kepler (1571–1630) versteht die Astronomen als „Priester des Schöpfergottes am Buch der Natur“ (Kepler [1598] 1991: 9), und Galileo Galilei (1564–1642) macht die Unabhängigkeit beider Bücher und ihre unterschiedlichen Aussageabsichten zum hermeneutischen Programm: Während das Buch der Schrift uns zum Heil führen soll, ist das Buch der Natur dem forschenden Verstehen des Menschen mittels mathematischer Rekonstruktion zugänglich geworden (Galilei [1623] 1968: 232; → I.3).
Charakteristisch für die Neuzeit ist der grundlegende Wandel im Naturbegriff, der immer mehr theologische Qualitäten übernimmt. Die Dynamisierung der Natur als eines unendlichen und produktiven Seins führt dazu, dass Schöpfer und Natur, dass die schaffende Natur (natura naturans) und die geschaffene Natur (natura naturata; → II.1/Abschn. 2.2), immer enger zusammenrücken. Das Übernatürliche erscheint nicht mehr als das die Natur Begründende, sie Erhaltende, Bewegende und Vollendende, sondern als das Un-Natürliche. Jeder transzendente Eingriff muss als intellektuelle |29|Zumutung sowohl an den Natur- als auch an den Gottesbegriff erscheinen, dessen Bedeutung im Deismus konsequenterweise auf die Schöpfung am Anfang reduziert wird, während die Erhaltung durch die Naturgesetze und durch die Übereinstimmung der Natur mit sich selbst garantiert wird. Wird die Natur im 18. Jh. noch wesentlich mechanistisch als planvoll konstruierte Maschine verstanden (so auch in der sog. Physikotheologie; → III.8/Abschn. 2.), so treten im 19. Jh. vermehrt die biologischen Züge in den Vordergrund. In der Evolutionstheorie Charles Darwins (1809–1882) wird die Kette der Lebewesen bis hin zum Menschen als das Resultat eines produktiven Zusammenwirkens von Naturkräften durch Variation und Selektion verstanden, so dass die in den biblischen Schöpfungserzählungen dargestellten Vorgänge als naturwissenschaftlich unhaltbar gelten müssen.
5.4 Schleiermacher und das 19. Jahrhundert
Auf die Destruktion der Kategorie des Supranaturalen durch die Aufklärung und auf den Einspruch der Naturwissenschaften gegen die biblischen Schöpfungsvorstellungen reagiert der evangelische Theologe Friedrich Schleiermacher (1768–1834), indem er in seiner Glaubenslehre eine konsequente Umwandlung der traditionellen Schöpfungslehre in eine Reflexion auf das menschliche Selbstverständnis vornimmt. Insofern Theologie nichts anderes sein könne als eine Auslegung des christlich-frommen Selbstbewusstseins, könne sie im Grunde nur immanente Prinzipien eines immer schon existierenden Etwas entfalten, aber keine Lehre über einen absoluten Anfang aufstellen. Gott und Natur stehen sich nicht gegenüber, sondern die Natur ist im frommen Gottesbewusstsein zu verstehen als mit der tätigen Wirksamkeit Gottes identisch, so dass die „göttliche Ursächlichkeit als der Gesammtheit der natürlichen dem Umfange nach gleich […] dargestellt“ (Schleiermacher [1830/31] 2008: 309) wird. Insofern sind ‚Gott‘ und ‚Welt‘ ähnlich wie ‚Natur‘ und ‚Geist‘ sich wechselseitig bedingende Kategorien: „Kein Gott ohne Welt, so wie keine Welt ohne Gott“ (Schleiermacher [1839] 2002: 269). Schleiermacher entfaltet deshalb die Natur nicht als das Produkt eines herstellenden göttlichen Handelns, sondern als unmittelbaren Ausdruck Gottes, der nicht planmäßig die beste aller möglichen Welten konstruiert, sondern in freier Kreativität beständig schaffend tätig ist. So teilt sich die göttliche Weisheit in Natur und Geist gleichermaßen mit und stellt sich in ihnen dar, so dass die Natur und also „das gesammte endliche Sein […] als das schlechthin zusammenstimmende göttliche Kunstwerk“ (Schleiermacher [1830/31] 2008: 507) aufzufassen ist.
6. Herausforderungen eines christlichen Schöpfungsverständnisses heute
Nach einer Phase der Konzentration auf anthropologische Fragestellungen sucht die christliche Schöpfungstheologie seit einiger Zeit die Kategorie der Natur in ihre Perspektive wieder einzuholen. Das geschieht zum einen im Gespräch mit den Naturwissenschaften, das nun nicht mehr das biblische Weltbild zu verteidigen sucht, sondern |30|als Debatte um ein angemessenes religiöses Wirklichkeitsverständnis geführt wird. Dazu haben auch Entwicklungen der Naturwissenschaften im 20. Jh. beigetragen, die eine Überwindung der Diastase von Natur – Geist bzw. Natur – Mensch möglich erscheinen ließen. Nachdem sich zunächst eher Einzelne dem Thema der Natur zuwandten (z.B. Karl Heim, 1874–1958, im evangelischen und Pierre Teilhard de Chardin, 1881–1955, im katholischen Raum), wird der vornehmlich in der angelsächsisch geprägten Welt geführte Diskurs zwischen science and religion in der deutschsprachigen Theologie etwa von Wolfhart Pannenberg (1928–2014), Jürgen Moltmann (geb. 1926) und Michael Welker (geb. 1947) aufgegriffen. Als anregend haben sich dabei prozessphilosophische und -theologische Entwürfe erwiesen (Charles S. Peirce, 1839–1914; Alfred N. Whitehead, 1861–1947) (vgl. z.B. Deuser 1993).
Darüber hinaus haben ökologische Fragestellungen die Debatte angeregt (vgl. Rau et al. 1987), die die Natur nicht als bloße Ressource, sondern in religiöser Perspektive in ihrem Eigenwert wahrnehmen und den menschlichen Umgang mit der Natur entsprechend ausrichten wollen. Damit werden auch kritische Anfragen an das Christentum aufgenommen, denen zufolge eine religiös unterfütterte anthropozentrische Naturvergessenheit der christlichen Tradition für die ökologische Krise jedenfalls mitverantwortlich ist (Amery 1972). Seit den 1980er Jahren hat sich das Schlagwort der „Bewahrung der Schöpfung“ etabliert, das im Zusammenhang des sog. Konziliaren Prozesses geprägt wurde, auf den sich 1983 die Mitglieder der VI. Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Vancouver verpflichteten. Mit dieser nicht unproblematischen Formel (vgl. Graf 1990) sucht christliche Schöpfungstheologie auch den Anschluss an andere Formen wertschätzender Wahrnehmung der ethischen (→ III.5), leiblichen (→ III.1) und ästhetischen (→ III.2) Aspekte der Natur und des Natürlichen.
Literatur
Ahn, Gregor 1999: Schöpfer/Schöpfung I. Religionsgeschichtlich. In: Müller, G. et al. (Hg.): Theologische Realenzyklopädie, Bd. 30. Tübingen: 250–258.
Amery, Carl 1972: Das Ende der Vorsehung. Die gnadenlosen Folgen des Christentums. Reinbek.
Augustinus: Genesis = Augustinus, Aurelius [401–414] 1961: Über den Wortlaut der Genesis. De Genesis ad litteram libri duodecim. Der große Genesiskommentar in 12 Büchern, I. Bd.: Buch I bis IV. Hg.: C.J. Perl. Paderborn. [https://digi20.digitale-sammlungen.de/de/fs1/object/display/bsb00046071_00001.html].
Descartes, René [1637] 21997: Von der Methode des richtigen Vernunftgebrauchs und der wissenschaftlichen Forschung. Frz.-Dt. Hg.: L. Gäbe. Hamburg.
Deuser, Hermann 1993: Gott: Geist und Natur. Theologische Konsequenzen aus Charles S. Peirce’ Religionsphilosophie. Berlin.
Galilei, Galileo [1623] 1968: Il saggiatore. In: Le opere di Galileo Galilei, Bd. VI. Hg.: A. Favaro. Firenze: 197–372.
Gerhard, Johann [1657] 1864: Loci theologici, Bd. II. Hg.: E. Preuss. Berlin.
Graf, Friedrich W. 1990: Von der creatio ex nihilo zur ‚Bewahrung der Schöpfung‘. Dogmatische Erwägungen zur Frage nach einer möglichen ethischen Relevanz der Schöpfungslehre. In: Zeitschrift für Theologie und Kirche 87 (2): 206–223.
|31|Keel, Othmar/Schroer, Silvia [2002] 22008: Schöpfung. Biblische Theologien im Kontext altorientalischer Religionen. Göttingen.
Kepler, Johannes [1598] 1991: Johannes Kepler. Gesammelte Werke, Bd. 7: Epitomes Astronomiae Copernicanae. Hg.: M. Caspar. München.
Luther, Martin [1530] 91982: Enchiridion. Der kleine Katechismus. In: Deutscher Evangelischer Kirchenausschuß (Hg.): Die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche. Göttingen: 501–541.
Platon, Timaios = Platon 2016: Timaios. Griech.-Dt. Hg.: M. Kuhn: Hamburg.
Rau, Gerhard/Ritter, Adolf M./Timm, Hermann (Hg.) 1987: Frieden in der Schöpfung. Das Naturverständnis protestantischer Theologie. Gütersloh.
Schleiermacher, Friedrich [21830/31] 2008: Der christliche Glaube. Nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche im Zusammenhange dargestellt. Hg.: R. Schäfer. Berlin.
– [1839] 2002: Vorlesungen über die Dialektik, Teilbd. 1. Hg.: A. Arndt. Berlin
Schmid, Konrad (Hg.) 2012: Schöpfung. Tübingen.
Thomas von Aquin, Summa theologiae = Thomas v.Aquin 1982: Die deutsche Thomas-Ausgabe, Bd. 1: Gottes Dasein und Wesen (I, 1–13). Lat.-Dt. Hg.: M.-D. Chenu. Graz.
Zimmermann, Rainer E. (Hg.) 1998: Naturphilosophie im Mittelalter. Cuxhaven.
[Zum Inhalt]
|32|I.3 Mathematisierung der Natur und ihre Grenzen
Brigitte Falkenburg
Die Mathematisierung der Natur ist zentral für die neuzeitliche Naturphilosophie. Dabei reflektieren die Philosophen der Neuzeit die Bedingungen, unter denen der Mensch als erkennendes Subjekt zu Objektivität und Gewissheit in der Naturerkenntnis gelangen kann; und sie sehen den Garant für Gewissheit in der Mathematik. Die Ansätze von Descartes bis Kant sind typisch für die Aufklärung: Sie betonen den Imperativ, dass der Mensch sich des eigenen Verstandes bedienen soll, anstatt blindlings den Autoritäten zu folgen. Entsprechend werden diese Konzeptionen hier unter erkenntnistheoretischen Gesichtspunkten skizziert.
(1.) Das Programm einer Mathematisierung der Natur geht einher mit der Physik von Galileo Galilei (1564–1642) und Isaac Newton (1643–1727), die ein mechanistisches und deterministisches Weltbild begründet. Dabei sind Physik und Naturphilosophie zunächst nicht strikt gegeneinander abgegrenzt. (2.) Die naturphilosophischen Konzeptionen im 17. und 18. Jh. sind (2.1) eng verbunden mit der Philosophie des Rationalismus, nach dem alle Erkenntnis auf der Vernunft beruht und der Weltlauf rational und berechenbar ist (René Descartes, 1596–1650; Baruch de Spinoza, 1632–1677; Gottfried W. Leibniz, 1646–1716). (2.2) Die Gegenposition ist der britische Empirismus, nach dem die Erkenntnis ausschließlich auf Erfahrung beruht (John Locke, 1632–1704; George Berkeley, 1685–1753; David Hume, 1711–1776). (3.) Um zwischen den widerstreitenden Strömungen zu versöhnen, konzipiert Immanuel Kant (1724–1804) die Naturphilosophie als ‚metaphysische‘ Disziplin, die auf der Struktur der menschlichen Erkenntnis beruht, deren Maßstäbe für objektive Erkenntnis aber an der mathematischen Physik orientiert bleiben (4.). Kant sieht die Biologie nicht als ‚eigentliche‘, d.h. mathematische Naturwissenschaft an; für ihn ist die Natur in physikalische Mechanismen und teleologische Strukturen unterteilt.
1. Mathematisierung der Natur: Galilei, Descartes, Newton
Die neuzeitliche Mathematisierung der Natur steht in der antiken Tradition von Pythagoras (um 570–um 495 v. Chr.). Aus pythagoreischer Sicht machen Zahlen und mathematische Proportionen das Wesen der Dinge aus, was Platon (428/427–348/347 v. Chr.) im Timaios aufgreift und bei Johannes Kepler (1571–1630) in der pythagoreischen Sicht der Weltharmonie wiederkehrt. Galilei, Descartes und Newton machen vor diesem Hintergrund die Physik zu einer mathematischen |33|Disziplin, die auf die Erkenntnis universeller Naturgesetze zielt. Sie begründen damit ein mechanistisches Weltbild, das bis heute folgenreich ist, auch wenn die Naturwissenschaft seine Grenzen im 20. Jh. gesprengt hat.
1.1 Das Buch der Natur
Galileis Leistung besteht darin, die Anwendung der Mathematik von der Himmelssphäre auf irdische mechanische Vorgänge zu übertragen. Die Astronomie hatte die Mathematik seit der Antike zur ‚Rettung der Phänomene‘ benutzt, um die scheinbaren Planetenbewegungen im Rahmen des ptolemäischen Weltbilds zu beschreiben. Galilei überträgt dieses mathematische Vorgehen von den Bewegungen der Himmelskörper auf die Mechanik, auf den freien Fall von irdischen Körpern unter Absehung vom Luftwiderstand, auf Wurfprozesse und auf die Bahn von Kanonenkugeln. Nach einem berühmten Diktum Galileis ist das Buch der Natur in mathematischen Lettern geschrieben (Galilei [1623] 1987: 275 / 1992: 38):
„Die Philosophie ist in dem größten Buch geschrieben, das unseren Blicken vor allem offensteht – ich meine das Weltall […] Es ist in mathematischer Sprache geschrieben, und seine Buchstaben sind Dreiecke, Kreise und andere Figuren, ohne diese Mittel ist es dem Menschen unmöglich, ein Wort zu verstehen, irrt man in einem dunklen Labyrinth herum.“
Galilei strebt die Entzifferung dieses mathematisch verfassten Buchs der Natur mit den mathematischen und experimentellen Methoden der Physik an. Ihm ist bewusst, dass dies in Konkurrenz zur biblischen Offenbarung steht; wobei dieses „Konkurrenzunternehmen“ aus seiner Sicht sogar größere Gewissheit verspricht als die Bibel, denn das Buch der Natur sei direkt von Gottes Hand und nicht von Menschenhand geschrieben (Galilei 1615).
Die Metapher vom Buch der Natur hat einen theologischen Hintergrund (→ I.2; II.1). Sie stammt von Aurelius Augustinus (354–430), danach gilt Gott als Urheber der Naturgesetze. Die mathematische Deutung dieser Metapher bleibt – bei zunehmender Säkularisierung – in der Physik und Naturphilosophie von der frühen Neuzeit bis zum 20. Jh. wirksam, wie sich von Galilei über Descartes, Newton, Leibniz und Kant bis hin zu Planck und Einstein verfolgen lässt (vgl. etwa Planck 1908). Galilei verwendet die Metapher als Kritik an der biblischen Offenbarung, um für das kopernikanische Weltbild zu argumentieren. Bei Descartes (1644) führt die Metapher zum Programm der mathesis universalis – einer mathematischen Einheitswissenschaft, die alle Wissenschaften von der Mechanik bis zur Medizin und Ethik begründen kann. Newton (1687) formuliert das Gesetz der universellen Gravitation, das den Weltlauf berechenbar macht. Das Gravitationsgesetz vereinheitlicht die Bewegungen der Himmelskörper mit mechanischen Vorgängen auf der Erde, indem es beiden Phänomenen die Schwerkraft als einheitliche Ursache zugrunde legt; Keplers Gesetze der Planetenbewegungen und Galileis Fallgesetz lassen sich als Näherungen aus dem Gravitationsgesetz ableiten.
|34|1.2 Experimentelle Methode, Atomismus und mechanistisches Weltbild
Galilei strebt die Entzifferung des mathematisch verfassten Buchs der Natur mittels systematischer Messungen an, wobei er Beobachtungsinstrumente wie das Fernrohr sowie auch physikalische Experimente benutzt, um die Phänomene zu analysieren und hinter den unmittelbaren Augenschein vorzudringen. Er perfektioniert die experimentelle Methode als ein Verfahren, mittels dessen man die Naturphänomene in getrennte Komponenten zerlegen kann, um ihre Eigenschaften unter idealen Bedingungen zu untersuchen. Ziel ist dabei, die Zusammensetzung der Phänomene mit mathematischer Präzision zu beherrschen. Hier verbindet sich das mathematische Denken mit einer „atomistischen“ Vorgehensweise, d.h. mit der Zerlegung der Phänomene in Komponenten (wie z.B. freien Fall und Luftreibung), die sich im Experimentierlabor isolieren und unter möglichst genau definierten technischen Bedingungen erforschen lassen. Bei Galilei und seinen Nachfolgern geht dieser Ansatz mit der Erklärung der Körper aus Korpuskeln oder Atomen als kleinsten Bestandteilen einher.
Das mathematische Bild der Natur ist entsprechend seit dem 17. Jh. mechanistisch und atomistisch geprägt. So gegensätzliche Denker wie Descartes und Thomas Hobbes (1588–1679) vertreten eine mechanistische Korpuskularphilosophie, nach der alle Vorgänge in der physischen Welt auf Druck und Stoß mechanischer Korpuskeln zurückgehen (Descartes 1644; Hobbes 1655). Newton wiederum nimmt an, dass das Gravitationsgesetz im Großen wie im Kleinen gilt und dass auch das Licht aus Atomen mit den Eigenschaften mechanischer Körper besteht (Newton 1704). Das mechanistische Denken kulminiert in der deterministischen Vorstellung, es gäbe einen allwissenden Dämon, der die Anfangsbedingungen aller Atome in der Welt kennt und daraus nach den Gesetzen der Mechanik den Weltlauf für alle Zeiten vollständig berechnen kann (Laplace [1814] 1996: 2) (→ II.7):
„Eine Intelligenz, welche für einen gegebenen Augenblick alle in der Natur wirkenden Kräfte sowie die gegenseitige Lage der sie zusammensetzenden Elemente kennte, und überdies umfassend genug wäre […], würde in derselben Formel die Bewegungen der größten Weltkörper wie des leichtesten Atoms umschließen; nichts würde ihr ungewiß sein und Zukunft wie Vergangenheit würden ihr offen vor Augen liegen.“
2. Rationalismus versus Empirismus
Die mathematische Physik entspricht dem Rationalismus, den Descartes als philosophische Strömung begründet. Die Mathematisierung der Natur zielt auf die Vereinheitlichung der Phänomene und auf verlässliche Naturerkenntnis; das erkennende Subjekt versichert sich durch Einsicht in das „Buch der Natur“ bzw. in die Naturgesetze der Rationalität des Weltlaufs. Als Gegenströmung entwickelt sich der britische Empirismus, aus dessen Sicht das „Buch der Natur“ nicht mathematisch verfasst, sondern erfahrungsbasiert ist. Die empiristische Skepsis gegen Naturgesetze hält aber den Siegeszug des Rationalismus nicht auf, sondern trägt eher zu seiner Säkularisierung |35|bei und führt zu dem naturwissenschaftlich begründeten, materialistischen Weltbild, das heute stärker verbreitet ist denn je.
2.1 Rationalismus
Die Denker des Rationalismus haben von Descartes bis Kant gemeinsam, dass sie sich an mathematischen Methodenidealen orientieren, dass sie den Ursprung der Erkenntnis primär in der Vernunft sehen und der Natur eine dem Menschen einsichtige, rationale Struktur zusprechen, die sich an ihren jeweiligen theologischen Hintergrundideen orientiert. Sie gehen davon aus, dass der Weltlauf durch Gottes Willen und die Naturgesetze strikt determiniert ist, auch wenn der Mensch dies nicht vollständig erkennen kann und im Hinblick auf Fragen von Gut und Böse Wahlfreiheit hat. Sie betrachten Gott als Daseinsgrund der Welt und führen verschiedene Gottesbeweise. Für die Naturphilosophie relevant ist der physiko-theologische Beweis, nach dem der Mensch aus der Ordnung und Schönheit der Natur auf Gott als Urheber der Weltordnung schließen kann (→ IV.7); man findet ihn etwa beim jungen Kant (1755).
Auch wenn sie die rationalistischen Grundüberzeugungen teilen, vertreten die Rationalisten sehr unterschiedliche metaphysische Systeme. Descartes (1641) begründet seinen bis heute wirkungsmächtigen Dualismus der res extensa (Materie) und der res cogitans (Geist) (→ II.1). Danach sind die Körper von Tieren und Menschen materielle Maschinen; als einziges materielles Wesen verfügt der Mensch auch über Geist. Nach Spinozas Lehre der All-Einen Substanz (Spinoza 1677) ist das Universum Gott und Welt zugleich, und die Natur ist durchgängig beseelt. Nach Leibniz (1714) wiederum liegen der materiellen Welt unendlich viele beseelte Monaden zugrunde. Leibniz ist für die mathematische Physik nicht weniger wichtig als Newton. Auf Newton geht der Kraftbegriff zurück, auf Leibniz die Symmetrieannahmen der Physik; beide entwickeln die Differenzial- und Integralrechnung unabhängig voneinander, was zu ihrem berühmten Prioritätsstreit um ihre Erfindung führt. Leibniz vertritt aber völlig andere metaphysische und physikalische Auffassungen als Newton, wie die Debatte um absoluten Raum, absolute Zeit und Atomismus zwischen Leibniz und Newtons Anhänger Samuel Clarke (1675–1729) zeigt (Leibniz/Clarke 1715/16) (→ II.4).