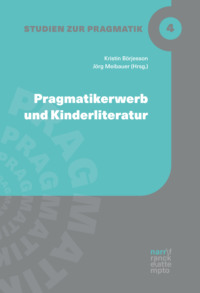Kitabı oku: «Pragmatikerwerb und Kinderliteratur», sayfa 5
Implikaturenerwerb und die Interpretation herausfordernder Bilderbücher
Bettina Kümmerling-Meibauer & Jörg Meibauer
Abstract: In the course of language acquisition, the acquisition of conversational implicature is a major challenge for the child. This contribution argues that so-called challenging picturebooks may constitute an important input in this regard, since they show marked patterns on the level of texts, pictures, and text-picture-combinations. Thus, the maxim of manner or a principle of markedness may be acquired with the help of this input and/or is functional in the interpretation of the respective aesthetic phenomena.
Keywords: challenging picturebooks, conversational implicatures, markedness, maxim of manner, pragmatic acquisition
1 Einleitung
Die Theorie der konversationellen Implikaturen gehört zu den Grundpfeilern der linguistischen Pragmatik (Grice 1989). Die moderne Abgrenzung zwischen Semantik und Pragmatik stützt sich wesentlich auf die Grice’sche Unterscheidung zwischen dem Gesagten (‚what is said‘) und dem Implikatierten (‚what is implicated‘); beides zusammen macht die Sprecherbedeutung (‚speaker meaning‘) aus. Im Spracherwerb lernen Kinder nicht nur, das Gesagte zu interpretieren und zu produzieren, sondern auch das Implikatierte. Viele empirische Untersuchungen haben gezeigt, dass pragmatische Prozesse des Spracherwerbs früh beginnen, aber lang andauern. Dies gilt auch für den Bereich der konversationellen Implikaturen, zum Beispiel Metapher, Ironie und skalare Implikaturen (Zufferey 2015: 97–156).
Das gemeinsame Betrachten von Bilderbüchern etwa ab dem Alter von 12 Monaten kann als ein spezifischer pragmatischer Input im Spracherwerb aufgefasst werden. Dies betrifft nicht nur die externe Pragmatik, also pragmatische Prozesse zwischen dem Kind und einer älteren Vermittlungsperson (z. B. Geschwister, Freunde, Eltern, Großeltern, Erzieher), sondern auch die interne Pragmatik, also solche pragmatischen Prozesse, die im Bilderbuch dargestellt werden. Praktisch alle narratologischen Dimensionen (z. B. Dialog, Redewiedergabe, Perspektive, Emotion und Empathie) haben auch eine pragmatische Seite, so dass die Annahme, dass gemeinsames Lesen von Bilderbüchern schon früh eine Quelle des pragmatischen Lernens, aber auch des Literaturerwerbs ist, nicht unplausibel ist.
Die literarische Pragmatik untersucht unter anderem, wie ästhetische Effekte mit Grice’schen Maximen oder Prinzipien zusammenhängen (Warner 2013). Geht man davon aus, dass literarische Kommunikation zwischen einem Autor/Erzähler und einem Leser grundsätzlich den allgemeinen Kommunikationsprinzipien unterworfen ist, ist die Anwendung der Grice’schen Theorie auf die Produktion und Interpretation von Literatur nur konsequent. Angesichts des Umstands, dass einerseits Fiktionalität auch eine Eigenschaft von gesprochener Alltagssprache sein kann, anderseits literarische Texte auch faktional sein können, sollte der spezielle kognitive Status der Literatur kein Hindernis für die Anwendbarkeit der Grice’schen Theorie auf literarische Kommunikation sein (Weidacher 2017). Im Gegenteil kann man hoffen, dass auf diese Weise eine präzisere Rekonstruktion einiger ästhetischer Phänomene möglich ist (Chapman 2014, Dynel 2018).
Grice (1989) nimmt vier Maximen an, nämlich die Maximen der Quantität, Qualität, Relation und der Art und Weise, die dem Kooperationsprinzip zugeordnet sind. Diese Maximen spielen eine zentrale Rolle in der rationalen Rekonstruktion des mit einer Äußerung in einer bestimmten Sprechsituation Gemeinten (Meibauer 2018). In diesem Beitrag konzentrieren wir uns auf die Maxime der Art und Weise (‚maxim of Manner‘) bzw. das M-Prinzip (Grice 1989, Levinson 2000). Man kann diese Maxime als stilistische Maxime begreifen, weil sie sich nicht wie die anderen Maximen auf den Inhalt des Gesagten, sondern die Art und Weise, wie etwas gesagt wird, bezieht. Der Begriff der Markiertheit ist hier einschlägig: Wenn ein Ausdruck markiert ist im Vergleich mit alternativen Ausdrücken, muss eine spezielle Bedeutung vom Leser abgeleitet werden.
Solche markierten Bedeutungen tauchen schon früh in Bilderbüchern für Kinder auf. Das ist erstaunlich, denn die Ableitung anderer implikaturbasierter Bedeutungen, zum Beispiel bei skalaren Implikaturen (Maxime der Quantität/Q-Prinzip), ist nicht einfach zu erwerben und bedarf langjähriger sprachlicher Erfahrung. Bei den folgenden Überlegungen konzentrieren wir uns auf eine Gruppe von Bilderbüchern, die man in den letzten Jahren als herausfordernde Bilderbücher (‚challenging picturebooks‘) bezeichnet hat (Evans 2015a). Mit „Herausforderung“ ist zunächst einmal gemeint, dass diese Bücher – anders als man es von gewöhnlichen Bilderbüchern erwarten würde – Themen wie Tod, Sexualität oder psychische Krankheiten wie Depression aufgreifen und dazu auch ästhetisch herausfordernde künstlerische Strategien verwenden. Nach Evans (2015b: 5–6) sind dies Bilderbücher, die man als seltsam, ungewöhnlich, kontrovers, beunruhigend, schockierend, störend, merkwürdig, anspruchsvoll oder philosophisch charakterisieren kann. Man kann auch sagen, dass es sich um Bilderbücher handelt, die ‚normale‘ Erwartungen (von erwachsenen Gatekeepern) verletzen und deshalb markiert sind.
Wir möchten aber vor allem fragen, in welchen kognitiven Hinsichten ein herausforderndes Bilderbuch eine Herausforderung für ein Kind in einem bestimmten Entwicklungsstadium ist und welche besonderen Lernmöglichkeiten sich aus einem entsprechenden Bilderbuch ergeben mögen (Kümmerling-Meibauer/Meibauer 2013, Kümmerling-Meibauer et al. 2015).
Wir werden im Folgenden Markiertheit auf den Ebenen des Texts, des Bildes und der markierten Kombination beider Ebenen analysieren. Unsere wesentliche These ist, dass die künstlerische Konstruktion der „Herausforderung“ einerseits Fähigkeiten der Interpretation von Markiertheit voraussetzt, andererseits aber diese auch unterstützt und begünstigt, so dass sich Effekte des literarischen Lernens ergeben können. Damit ist auch ein Anschluss an eine kognitive begründete Theorie des Literaturerwerbs gegeben.
Im nächsten Abschnitt gehen wir genauer auf die Maxime der Art und Weise und das M-Prinzip ein. In Abschnitt 3 stellen wir exemplarisch einige Fälle vor, in denen (a) Markiertheit auf der Textebene, (b) Markiertheit auf der Bildebene und (c) Markiertheit bei Text-Bild-Kombinationen vorliegen. In Abschnitt 4 kommen wir auf den Maximenerwerb zurück und überlegen, inwiefern Kinderliteratur dafür ein literarischer Input sein kann. Überlegungen zu einer möglichen experimentellen Überprüfung runden den Beitrag ab.
2 Die Grice’sche Maxime der Art und Weise
Grice (1989: 27) schlägt die folgende Formulierung der Maxime der Art und Weise vor und illustriert Ausbeutungen dieser Maximen mithilfe einer Reihe von Beispielen (Grice 1989: 35–37). Zum Beispiel ist die Äußerung „Miss X produced a series of sounds that corresponds closely with the score of ‚Home sweet home‘“ obskur im Vergleich zu „Miss X sang ‚Home Sweet Home‘“, scheint also gegen die erste Submaxime zu verstoßen. Als Leserin einer Konzertkritik wird man annehmen, dass mit der gewählten Formulierung eine harsche Kritik intendiert ist. „The most obvious supposition is that Miss X’s performance suffered from some hideous defect“, wie Grice (1989: 37) erläutert.
| (1) | The maxim of Manner | |
| Supermaxim: | Be perspicuous. | |
| Submaxims: | Avoid obscurity of expression. | |
| Avoid ambiguity. | ||
| Be brief (avoid unnecessary prolixity). | ||
| Be orderly. | ||
Innerhalb seines Systems der Konversationsmaximen genießt diese Maxime einen besonderen Status. Während die Maximen der Quantität, Qualität und Relation sich auf den Inhalt des Gesagten beziehen, bezieht sich die Maxime der Art und Weise auf „how what is said is to be said“, wie es bei Grice (1989: 27) heißt. In anderen Worten, die Maxime bezieht sich auf die spezifische Verpackung eines Inhalts oder auf den Stil.
Aus einer Reihe von Gründen, vor allem aber wegen ihrer Beziehung zum restlichen Maximenapparat, ist die Maxime der Art und Weise ein guter Kandidat für die Reduktion von Maximen (Meibauer 1997). So subsumiert Horn (1984) die erste und zweite Submaxime der Maxime der Art und Weise unter sein Q-Prinzip („Make your contribution sufficient: Say as much as you can (given R)“) und die dritte und vierte Submaxime unter sein R-Prinzip („Make your contribution necessary: Say no more than you must (given Q).“) In Carstons (2002) relevanztheoretischem Ansatz spielt die Maxime der Art und Weise keine Rolle. Levinson (2000) jedoch postuliert eine spezielle Fassung, die er das M-Prinzip nennt. Im Gegensatz zu Grice finden sich hier aber nicht einzelne Submaximen vom Typ „Avoid ambiguity!“ oder „Be orderly!“, sondern das M-Prinzip führt den Begriff der Markiertheit ein und enthält eine Unterscheidung zwischen normalen, stereotypischen Situationen und abnormalen, nicht-stereotypischen Situationen, die sich auf den Gebrauch bestimmter sprachlicher Mittel beziehen.
| (2) | M-Principle |
| Speaker’s maxim: Indicate an abnormal, nonstereotypical situation by using marked expressions that contrast with those you would use to describe the corresponding normal, stereotypical situation. | |
| Recipient’s corollary: What is said in an abnormal way indicates an abnormal situation, or marked messages indicate marked situations (…).1 |
Dieses Prinzip ist auf eine Reihe von sprachlichen Phänomenen gemünzt, zum Beispiel lexikalische Dubletten, konkurrierende Wortbildungen, Nominalkomposita, Litotes, bestimmte Genitiv- und Nullmorphem-Konstruktionen, Periphrasen und Wiederholungen (Levinson 2000: 138–153).
Betrachtet man die Grice’sche Maxime der Art und Weise und wendet sie auf Literatur an, bekommt man den Eindruck, dass sie systematisch ausgenutzt wird. Wir finden Literatur, die nicht „klar“ (‚perspicuous‘) ist, die voll von Ambiguität und Weitschweifigkeit ist, und die die richtige Reihenfolge des Erzählten (ordo naturalis) verletzt. Darüber hinaus können auch die Maximen der Quantität, Qualität und Relation ausgebeutet werden, um bestimmte ästhetische Effekte zu erzielen (Chapman 2014, Warner 2014). So bezieht sich die Maxime der Quantität auf die Menge der gegebenen Information; wenn ein literarischer Charakter oder eine Situation viel zu ausführlich oder genau beschrieben wird, kann dies zu bestimmten pragmatischen Schlüssen Anlass geben. Genauso bei der erzählerischen Ausbeutung der Maxime der Qualität, die sich auf die Wahrheit des Gesagten bezieht. Hier ist das unzuverlässige oder sogar täuschende Erzählen einschlägig. In Bezug auf die Maxime der Relation, die thematische Passung einer Äußerung verlangt, könnte man auf erzählerische Sprünge verweisen, die die Leserin vor Rätsel der Integration von Textteilen stellen.
Betrachten wir ein konkretes Beispiel, welches Volker Brauns Roman Unvollendete Geschichte (1977) entnommen wurde:
| (3) | Sie hörte noch und hörte nur halb: daß sie, im anderen Fall, nicht in der Redaktion, also verlassen müsse, nach H., sie könnten, und als Bezirksorgan, das müßte sie sich selber, solche Leute nicht leisten können! (38) |
Der jungen Volontärin Karin, die bei einer Zeitungsredaktion arbeitet, werden vom Parteisekretär Vorhaltungen wegen ihrer Beziehung zu Frank, der ein Jahr im Gefängnis gesessen hat und dem man Kontakte zum Westen nachsagt, gemacht. Es wird von ihr verlangt, dass sie sich von Frank trennt. Falls sie dem nicht zustimme, müsse sie die Redaktion verlassen. Der Text ist offensichtlich ungrammatisch, er erzeugt mangelnde Kohäsion und ist gegenüber einem kohärenten Text, der keine Lücken und grammatischen Fehler aufweist, deutlich markiert. Dennoch kann die Leserin rekonstruieren, worum es geht, sie versucht in der Interpretation, den Text kohärent zu machen, so dass eine kohärente Version so lauten könnte:
| (4) | Wenn Karin sich von Frank nicht trenne, könne sie nicht in der Redaktion bleiben. Sie müsse sie verlassen und nach H. zurückkehren. Als Bezirksorgan, das müsste sie sich selber denken können, könne man sich solche Leute wie sie nicht leisten. |
Der intendierte narrative Effekt ist, dass die Leserin die Perspektive von Karin übernimmt, die aufgrund ihrer besonderen emotionalen Situation, in der sie sich vor dem Parteisekretär und einem weiteren anwesenden „jungen Mann“ (38) rechtfertigen muss, von ihren Gefühlen übermannt ist, nicht richtig zuhört und deshalb nur einige Wortfetzen aufschnappt. Hier sind besonders die Maxime der Quantität (es wird Information ausgelassen) und die Maxime der Art und Weise (insbesondere die Submaxime „Avoid obscurity of expression!“) betroffen.
Um Markiertheit in literarischen Texten erkennen zu können, müssen Leser und Leserinnen bereits über solide Grundkenntnisse im Hinblick auf literarische Konventionen verfügen.2 Zu diesen Konventionen gehören etwa die Erwartungen, dass ein Text kohärent ist und dass er die wesentlichen Informationen, die zum Textverständnis notwendig sind, enthält. Eng damit verbunden ist der Erwerb von Schemata und Skripts, d.h. Vorstellungen darüber, wie bestimmte Situationen ablaufen, wie ein Gespräch funktioniert, welche Rollen Personen einnehmen, usw. Nur derjenige, der entsprechende Schemata und Skripts gelernt hat, die quasi „normalen, stereotypischen“ Situationen oder Narrationen entsprechen, ist in der Lage, Abweichungen davon zu erfassen, sie zu kontextualisieren und in einem weiteren Schritt zu interpretieren.
Um folglich literarische Texte in Kinderbüchern als markiert begreifen zu können, müssen Kinder eine Auffassung darüber entwickelt haben, wie eine „normale, stereotypische“ Beschreibung oder Narration aussieht und wie sie sich von einer „abnormalen, nichtstereotypischen“ unterscheidet. Über den Erwerb solcher Normalitätsannahmen in Bezug auf Kinderliteratur weiß man wenig. In Bezug auf die Erwachsenenliteratur sieht es anscheinend ganz ähnlich aus. Zwar wird hier das Phänomen des „Abweichens als Prinzip“ prinzipiell erfasst und auch in Bezug auf ausgewählte sinnfällige Texte beschrieben (Schuster 2017), aber weder wird expliziert, inwiefern eine Norm angenommen werden kann, von der dann in bestimmter Weise „abgewichen“ wird, noch, mithilfe welcher Schlussverfahren eine Leserin einen intendierten Sinn erschließen kann.3 Diese Situation ist äußerst unbefriedigend. Einen ersten Schritt in diese Richtung sehen wir darin, das Prinzip der Markiertheit (oder Abweichung) deutlicher herauszustellen und es auf literarische Texte zu applizieren.
In dieser Hinsicht ist zu beachten, dass sich Levinsons M-Prinzip, wie in (2) deutlich wird, auf Satzrahmen bezieht. Wollen wir über literarische Texte reden, benötigen wir daher den Begriff des markierten Texts. Ein Text ist in dem Maße markiert, so können wir vermuten, in dem er von Normalitätsannahmen abweicht. In diesem Sinne ist das vom Dadaismus inspirierte Gedicht An Anna Blume (1919) von Kurt Schwitters mit seinen Wortwiederholungen, bewusst eingefügten grammatischen Fehlern, Metaphern, ungewöhnlichen Reimen und logischen Widersprüchen in hohem Maße markiert (Schuster 2017: 311f.). Markiertheit, so unsere These, tritt jedoch nicht nur in der Erwachsenenliteratur auf, sondern kann bereits in der Kinderliteratur nachgewiesen werden. Um dies zu illustrieren, konzentrieren wir uns auf einige ausgewählte Bilderbücher. Wir versuchen hierbei, den Begriff der Markiertheit über den Text hinaus auf Bilder und Bild-Text-Relationen auszuweiten.
3 Fallstudien
Im Folgenden betrachten wir einige Fälle von herausfordernden Bilderbüchern (engl. challenging picturebooks). Wie schon gesagt, versteht Evans (2015b: 5–6) unter ‚challenging picturebooks‘ solche Bilderbücher, die als „strange, unusual, controversial, disturbing, challenging, shocking, troubling, curious, demanding or philosophical“ beschrieben oder klassifiziert werden können. Diese Aufzählung von Adjektiven bezieht sich sowohl auf den Inhalt als auch die ästhetische Gestaltung der Bilderbücher. Allerdings gehen sie stark mit Wertungen einher, die mit Vorstellungen darüber, was unter einem ‚normalen‘ Bilderbuch zu verstehen ist, verbunden sind. Diese Bewertungsprozesse werden jedoch nicht reflektiert. Auch eine exakte Definition des Begriffs ‚challenging picturebook‘ wird nicht gegeben, so dass es unklar ist, wie man erkennen kann, ob ein bestimmtes Bilderbuch unter diese Kategorie fällt. Dies ist natürlich ein unbefriedigender Zustand.
Wir möchten hier vorschlagen, dass herausfordernde Bilderbücher solche Bilderbücher sind, die Normalvorstellungen verletzen und daher markiert sind. Emotionale Reaktionen der Leserin oder des Lesers wie Verstörung, Schock, Verwirrung usw. können ein Effekt ihrer Markiertheit sein, müssen es aber nicht, da sie von dem jeweiligen kognitiven Zustand des Betrachters abhängen. Es ist sicherlich sinnvoll, die Kategorie Bilderbuch als eine prototypische Kategorie zu betrachten, die eine „logic of graded centrality“ (Herman 2008: 438) aufweist. Herausfordernde Bilderbücher weichen in einigen Hinsichten vom Prototyp ab. So sind klassische Bilderbücher wie Der Struwwelpeter (1845) von Heinrich Hoffmann in diesem Sinne sicherlich herausfordernde Bilderbücher,1 aber es ist auch möglich, wie Perry Nodelman (2015) treffsicher bemerkt, viele marktgängige Bilderbuch-Bestseller als herausfordernd zu betrachten, wenn man ihre zum Teil überraschenden Abweichungen von einem Prototypen in den Blick nimmt. Daraus folgt, dass das Phänomen der Markiertheit oder der Abweichung nicht notwendig an die Kategorie des herausfordernden Bilderbuches gebunden ist. Wie das Beispiel von Hoffmanns Struwwelpeter darüber hinaus zeigt, ist die Wahrnehmung von Markiertheit durchaus kontext- und zeitgebunden: Was zu einer bestimmten Zeit als markiert oder abweichend empfunden wurde, kann zu einer späteren Zeit als ‚normal‘ bzw. nicht-markiert eingestuft werden. Auch wenn es interessant wäre, die historische Dimension zu untersuchen, geht es uns primär um den Nachweis, dass es Phänomene der Markiertheit im Bilderbuch tatsächlich gibt. Da wir Bilderbücher als eine Folge von Text-Bild-Kombinationen2 verstehen, gehen wir im Folgenden auf Bilderbücher ein, die Markiertheit auf der Ebene des Texts, des Bilds, und der Text-Bild-Kombination aufweisen. Aus Platzgründen können wir nur eine exemplarische Darstellung leisten, auch wenn eine systematische Untersuchung durchaus wünschenswert wäre.
3.1 Markiertheit auf der Textebene
Texte können an verschiedenen Stellen und auf unterschiedliche Art und Weise markiert sein. Wir konzentrieren uns auf einige Beobachtungen zu Textanfängen, die einen wichtigen Teil des Gesamttexts darstellen. Textanfänge dienen in der Regel dazu, das Setting einer Erzählung einzuführen. Welche Figuren treten auf? An welchem Ort treten sie auf? Zu welcher Zeit geschieht das? Es handelt sich hierbei um grundlegende Informationen, um sich in einer Erzählung orientieren zu können. Folgender Satzanfang stammt aus dem Bilderbuch Die Insel (2002) von Armin Greder:
| (5) | Am Morgen fanden die Inselbewohner einen Mann am Strand, da wo Meeresströmung und Schicksal sein Floß hingeführt hatten. Er stand auf, als er sie kommen sah. |
| Er war nicht wie sie. (Armin Greder, Die Insel, 2002) |
Aus diesem Text erfahren die Leserinnen, dass der Text von den Inselbewohnern und einem Mann handelt; dass sie ihn am Morgen fanden und dass sie ihn am Strand fanden. Schon der erste Satz liefert diese relevanten Informationen.1
Die folgenden Textanfänge sind im Vergleich markierter:
| (6) | Als mich ein Trödler in seinem Schaufenster ausstellte, wusste ich: „Otto, jetzt bist du alt.“ (Tomi Ungerer, Otto. Autobiographie eines Bären, 1999) |
| (7) | Wenn Florentine vor dem Schlafengehen ihre Zähne putzen möchte, dann knurre ich: „Ich will nicht! Ich will nicht! Ich will nicht!“ Grrrrr, ich hasse Waschen und Zähneputzen. „Lass uns lieber noch im Bett einen Schokokeks essen“, flüstere ich ihr ins Ohr. Und weil Florentine nicht gern mit mir streitet, so legen wir uns ins Bett und essen einen Schokokeks. (Karoline Kehr, Schwi-Schwa-Schweinehund, 2001) |
In (6) gibt es durch den als-Satz und das Temporaladverb jetzt sowie die Präpositionalphrase in seinem Schaufenster eine zeitliche und räumliche Einordnung des Geschehens, ähnlich wie in (7), wo die Zeitangabe durch die Präpositionalphrase vor dem Schlafengehen erfolgt, und der Ort des Geschehens durch die Aktivitäten des Zähneputzens und Waschens als Badezimmer rekonstruiert werden kann.
Die Ermittlung der Figuren, die eine Perspektive der 1. Person einnehmen, ist dagegen aufwändiger: In (6) gibt es eine koreferenzielle Beziehung zwischen mich, ich, Otto und du.2 Dem Teddybären Otto werden, wie aus der selbstadressierten direkten Rede hervorgeht, Fähigkeiten der Selbstreflexion zugeschrieben, die sich auf die Vergangenheit bzw. den Verlauf eines längeren Lebens beziehen. Diesem Satz kann der Leser also entnehmen, dass der Teddybär Otto auf sein Leben zurückblickt, so wie es altgewordene Menschen oft machen. In (7) spricht die Figur des Schweinehunds, der das Mädchen Florentine in ihrem Verhalten (Zähne putzen, sich waschen, einen Schokokeks essen) negativ beeinflusst. Allerdings wird diese Figur in der Anfangspassage nicht namentlich eingeführt, so dass unklar ist, wer sich hinter dem Ich-Erzähler verbirgt. Wörter wie knurren und Grrrr legen nahe, dass es sich um einen Hund handeln könnte, allerdings scheint die Fähigkeit zur menschlichen Sprache dieser Vermutung zu widersprechen.
Als ein weiteres Beispiel betrachten wir (8):
| (8) | Kajak schreibt sich vorwärts und rückwärts gleich, sagt Anna. Rentner auch. |
| Genau wie Anna, fügt Papa hinzu. Aber jetzt musst du dich beeilen, sonst kommen wir zu spät. | |
| Anna merkt, dass Papa unruhig ist, obwohl sie ihn nicht anschaut. Sie spürt es in der Luft, im Gras, in der Narbe am Knie, im Muttermal am Hals und in jedem einzelnen Haar auf ihrem Kopf. Anna weiß, dass Papa unruhig wird, wenn ihm vor etwas graut. | |
| (Stian Hole, Annas Himmel, 2014 (norweg. EA 2013)) |
Eine kindliche Leserin wird diesem Text entnehmen, dass es sich um eine Erzählung handelt, in denen die Figuren Anna und Papa eine Rolle spielen. Aber der Einstieg mit Annas Bemerkung zu den Palindromen ist markiert. Wenn der Papa repliziert, dass Anna ebenfalls ein Palindrom ist, ergibt sich nach Lektüre des ganzen Texts die interpretatorische, metaphernbasierte Hypothese, dass Anna zurückblicken, aber auch nach vorne schauen kann (während der Vater in Gefahr ist, nur zurückzublicken). Dass beide um die Frau und Mutter trauern, und der Gang zum Begräbnis vor ihnen liegt (“… sonst kommen wir zu spät [zu X]“), kann erst langsam im Textverlauf erschlossen werden.
Markiert ist auch die Behauptung, dass Anna „in der Luft, im Gras, in der Narbe am Knie, im Muttermal am Hals und in jedem einzelnen Haar auf ihrem Kopf“ spüren kann, dass ihr Papa unruhig ist. Durch diese Formulierung werden Anna besondere Fähigkeiten der Wahrnehmung zugeschrieben.
Die betrachteten Beispiele zeigen, dass die textuellen Prinzipien der Kohäsion und Kohärenz (vgl. Averintseva-Klisch 2013) durchaus beachtet werden. Grobe Verstöße würden die Texte unverständlich machen. Dennoch wird deutlich, dass es in (6), (7) und (8) Herausforderungen beim Textverstehen gibt, die bei einem gewöhnlichen Textanfang wie in (5) nicht bestehen. Die entsprechende Bildinformation unterstützt sicherlich die Gewinnung einer Interpretation, die für den weiteren Lesevorgang nützlich ist: Bei (5) das Bild eines Floßes und eines nackten Mannes, bei (6) das Bild des Teddybären Ottos, bei (7) das Bild des Schweinehunds, der auf Florentines Schulter hockt, und in (8) das Bild von Anna, die schaukelt, während ihr Papa auf sie wartet. Dennoch sind die Texte auch ohne diese Bildinformationen verständlich, wenn ihre Markiertheit im Vergleich zu einem „normalen“ Textanfang erkannt wird. Zusätzlich spielt die Gliederung der Sehfläche, d.h. die Anordnung des Texts auf einer Seite oder Doppelseite, die Kombination verschiedener Schriften sowie die Gliederung eines Textes durch Abschnitte eine Rolle und kann bei der Gesamtinterpretation herangezogen werden.
Ein letztes Beispiel zeigt, dass es Textanfänge gibt, bei denen die Information über Figuren, Raum und Zeit unklar oder vage ist (Fettdruck im Original):
| (9) | There are woolvs in the sitee. Oh, yes! In the streets, in the parks, in the allees. In shops, in rustee playgrownds. In howses rite next dor. |
| And soon they will kum. They will kum for me and for yoo And for yor bruthers and sisters, Yor muthers and fathers, yor arnts and unkils, Yor grandfathers and grandmuthers. | |
| No won is spared. | |
| (Margaret Wild und Anne Spudvilas, Woolvs in the Sitee, 2006) |
In diesem Text wird behauptet, dass es Wölfe in der Stadt gibt und dass sie bald den Sprecher (me), den oder die Angesprochenen (yoo) und deren ganze Familie (bruthers, sisters, muthers, fathers, arnts, unkils, grandfathers, grandmuthers) angreifen werden. Wer genau spricht, ist nicht klar. Doch die auffällige falsche Schreibweise, die klar markiert ist relativ zur orthografischen Norm, mag einen ersten interpretatorischen Hinweis geben und zu mehreren Mutmaßungen Anlass geben: Der Sprecher oder die Sprecherin (tatsächlich ist es ein Junge) könnte schlecht in der Schule sein, oder die falsche Schreibweise ist ein Hinweis auf einen ängstlichen Geisteszustand, oder es handelt sich um einen bestimmten Slang, usw. Die begleitende Illustration gibt keine expliziten Informationen zu der sprechenden Figur preis. Das Bild zeigt den Ausblick (vermutlich aus einem Fenster) auf eine düstere Stadtszenerie mit Dächern, einem Strommast, von dem Kabel herunterhängen, und einer Straßenlaterne. Das dämmrige Licht und die dominierenden Grau- und Schwarztöne bestärken den Eindruck einer bedrohlichen Atmosphäre.
Wir haben am Beispiel von Textanfängen von Bilderbüchern gezeigt, dass die Annahme von markierten vs. unmarkierten Texten sinnvoll ist. Unsere Hypothese ist, dass zur Erschließung der Bedeutung markierter Texte unter anderem die Maxime der Art und Weise oder das M-Prinzip herangezogen werden muss. Markierte Texte fordern die Aufmerksamkeit der Leserin heraus, weil diese besondere Stilmerkmale aufweisen. Wenn also ein Text gegen die Maxime der Art und Weise verstößt, etwa indem er ambig ist, die erwartbare Reihenfolge von Informationen nicht beachtet oder zur Weitschweifigkeit oder Aufzählung neigt, dann stellt sich alsbald die Frage, warum diese stilistischen Mittel gewählt worden sind und welche Bedeutung sie für die nachfolgende Narration haben.