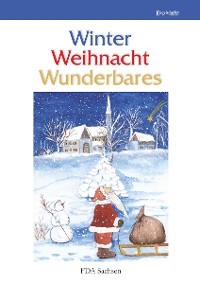Kitabı oku: «Winter – Weihnacht – Wunderbares», sayfa 2
Hannelore Crostewitz
So sei es
Horch in die Nacht
In die stille, die hohe
Derentwegen halt ein
Und – werd bedacht
Horch in den Tag
In den geschäftigen, lauten
Um den scheinbar alles sich dreht
Horch tief in ihn hinein
Und – horch ihn aus
Horch in dich selbst
In dein inneres Gespür
Sinnier und erkenn
Den Tag, die Nacht, die Freuden hier
Die reich leise weiter
Von Tür zu Tür
An der Ecke
Abseits vom lauten Getümmel
Weihnachtstrubel Hinterherhetzender
Gehüllt in Glühweinduft und Mandelaroma
Steht er –
Der Mann
An der Ecke
Verliert sich, nahe am Bauzaun
Die Grube an den gläsernen Neubau
Gleich dem Leben, das außer Sicht geraten
Abgespannt –
Der Mann
An der Ecke
Geht doch seinen Geschäften nach
Schwarz auf weiß wechseln
Zeitung und Besitzer ab und an den Platz
Falls jemand innehält –
Beim Mann
An der Ecke
Eines Tages ist er nicht mehr da.
So steht und rückt ins Licht die Frage:
Wer sucht? Weiß? Wohin
Und warum sich verlor
Das Bild vom Mann
An der Ecke?
Almut Fehrmann
Gewissensbisse
„Am liebsten würde ich nach Chemnitz fahren, heute ist doch Bergparade“, drängelte Anita und warf ihm einen ihrer unwiderstehlichen Blicke zu. Sie wusste genau, dass sie nicht lange bitten musste, aber sie kokettierte gern.
„Naja“, murmelte Robert, „letztes Jahr hat es mir Spaß gemacht, die Musikanten und Bergmänner in ihren Trachten zu beobachten.“
„Das war so schön, wie sie voller Stolz und Würde an uns vorbeigezogen waren. Und erst die Kinder. So richtig feierlich. Los, komm, ziehen wir uns an!“
„Hast ja Recht, hoffentlich hört der Regen rechtzeitig auf, sonst weichen die alle ein, 900 Teilnehmer sollen es werden.“
„Ich freue mich schon, wenn sie wieder zum Schluss alle gemeinsam aufspielen.“
„Ich erinnere mich, dass ich Gänsehaut hatte. Im Herbst ’89 standen wir an der gleichen Straße, auch mit Gänsehaut. Weißt du noch?“
„Gab es da eigentlich die Bergparade auch schon?“
Robert wurde lebhaft. Er erhob sich vom Sessel, zog Jacke und Schuhe an und öffnete die Garage.
Seine Frau war nicht ganz so schnell gestiefelt und gespornt. Mit so einer schnellen Reaktion hatte sie nicht gerechnet.
Als die beiden in Chemnitz ankamen, lugte kurz die Sonne durch die Wolken. Mit den Vorbeiziehenden und den Beobachtern feiernd am Straßenrand, genossen sie die besondere Atmosphäre, die eine Bergparade erzeugt. Festlichkeit ohne Pomp.
Der Vorbeimarsch der Musiker war beendet, Schalmeien und Posaunen verklungen, die Menschenansammlung löste sich allmählich auf. Die meisten Leute bewegten sich in Richtung Weihnachtsmarkt.
„Wenn wir schon einmal hier sind, können wir einen Glühwein trinken“, schlug Robert vor.
„Dann müssen wir so lange bleiben, bis ich wieder fahrtüchtig bin und können noch einen Roster essen.“
„Daher weht der Wind“, sagte Anita, „ich rieche gebrannte Mandeln und höre schon die Musik. Mir wird ganz weihnachtlich.“
Freue dich, ‘s Christkind kommt bald.
Die beiden Rentner schlenderten eingehenkelt zwischen den hölzernen Buden entlang, genossen die Düfte und den festlichen Glanz. Vom Rathausturm ertönten Glocken, unten erklangen die alten und wohlbekannten Texte und Weisen. Glühwein unter dem Wärmestrahler, Riesenroster im warmen Brötchen, behagliche Sorglosigkeit. Jedoch nicht lange.
Rechts unten, auf dem Fußboden sitzend und mit dem Rücken an eine Säule gelehnt, hielt ein Mann im abgeschabten Mantel eine Bettelmütze vor. Ein Junge warf ihm einige Münzen aufs Pflaster und einen freundlichen Blick dazu.
„Musst du uns vor die Füße laufen? Pass doch auf!“, empörte sich Robert.
Anita zog ihn beschwichtigend zur Seite. „Schau, da drüben sind Schneiders, die haben wir lange nicht gesehen. Lass uns hingehen!“
Im Umsehen nahm sie wahr, dass der Mann den Jungen dankbar anlächelte und verlegen nickte. Robert hatte nur noch Interesse für die Bekannten. Sofort waren alle in Gespräche vertieft. Sie hatten sich lange nicht gesehen und außerdem lockte die Bratwurst vom Holzkohlegrill.
Als sie später zu Hause angekommen waren, bekamen sie Lust auf ein gemütliches Abendessen, von der Wurst vom Weihnachtsmarkt waren sie nicht satt geworden. Der Bettler war schon vergessen. Doch jetzt erinnerte sich Anita wieder daran und sprach ihre Gedanken aus. Die waren auch bei dem Schüler, der ihnen in die Quere gekommen war. „Der sah aus wie ein Gammler mit seiner komischen Frisur und den ausgefransten Klamotten“, nörgelte Robert.
„Er hat dem alten Mann Geld gegeben.“ Anita plagten Gewissensbisse.
„Das hat er doch von seinen Eltern, der verdient doch noch nichts.“
„Dann hat er vom Taschengeld abgegeben. Wir haben unsere Rente und haben nichts gespendet.“
„Das Portemonnaie kann ich nicht so schnell bereit haben. Nicht umsonst wird vor Taschendieben gewarnt.“
„Hast ja Recht, wer weiß, ob der Bettler überhaupt einer war.“
Der Abend ging zu Ende.
Bei der täglichen Zeitungsschau am nächsten Morgen entdeckte Robert einen Artikel über den Bundespresseball.
„Hör dir das an: ‚Glanz in düsteren Zeiten‘ heißt die Überschrift.“ Er las laut vor: „‚150 internationale Spitzenköche, kanadischer Hummer, Ananas-Kokos-Törtchen, 1700 Flaschen Champagner‘ – so eine Prasserei, was sagst du dazu?“
„Was soll ich dazu sagen? Ich denke an den alten Mann vom Weihnachtsmarkt. Der hat vielleicht nicht einmal Brot.“
„Fang nicht wieder damit an. Wir können die Armut nicht abschaffen, so schlimm es auch ist.“
„Wie du meinst, ich stecke mir aber ab heute ein paar Euro-Stücke in die Manteltasche. Für alle Fälle.“
Hermann Friedrich
Weihnachtsspende
Der Heilsarmist leiert am Leierkasten und hält den Hut auf.
Spenden für Arme und Bedürftige! So spricht er die Vorbeikommenden in der spendenfreudigen Weihnachtszeit an. Sie sollen doch etwas Geld in den Hut werfen.
Ich frage ihn, warum ausgerechnet die Armen und Bedürftigen davon leben sollen.
Na, um zu überleben, sagt er.
Die meisten würden doch auch gern arbeiten gehen, meine ich. Und warum er den Armen keine Jobs vermittle.
Dafür sei doch die Arbeitsagentur zuständig, so seine Antwort. Außerdem müssen sich die Arbeitslosen doch selbst kümmern, in Lohn und Brot zu kommen.
Und wenn es keine Arbeit gibt?
Irgendwo gäbe es immer welche.
Doch bei Millionen Arbeitslosen sei diese Gesellschaft nicht mehr tragbar. Die Armen werden immer mehr. Und Spenden sind so ähnlich wie Kurzarbeitsgeld. Es wäre gerade so, als würde man ein Loch in einem Sieb stopfen, meine ich. Wir machen uns was vor. Ich bin gegen das Spenden. Das verkleistert die wahren Zustände.
Nikolaus
Vor Weihnachten der Nikolaus,
kommt jedes Jahr in jedes Haus.
Bringt allen viele schöne Gaben,
die Mädchen, Knaben wollen haben.
Er kommt mit einem Pferdeschlitten
und manchmal kommt er auch geritten
vom Himmel dort vom Himmelszelt
gibt’s Gaben gratis, ohne Geld.
Doch hat dies Jahr nur Schwierigkeiten,
die Flugzeuglotsen, sie war’n streiken.
Die Himmelsschneise über Bozen,
bestreikten die gestressten Lotsen.
Der Nikolaus kam drum recht spät,
wie das im Leben manchmal geht.
Er saß im Schlitten wie auf Kohlen
und um die Zeit noch aufzuholen,
schlittert er, ist viel zu schnell.
Es blitzt das Radar, das ein Quell
für kranke und für andre Kassen.
Muss Niklaus Geld nun springen lassen?
Die Polizei, die hält ihn auf,
da gibt’s ein Knöllechen noch drauf.
Und dann ein langes Fahrverbot.
Der Nikolaus, der kommt in Not.
Aus der Erfahrung, aus den Jahren,
sagt er: ich bin doch nicht gefahren!
Ich habe das Problem gewittert
und bin in das Radar geschlittert!
Ganz ungestraft rutscht er nun weiter,
doch was noch kommt, ist wenig heiter.
In seiner großen Zeites-Not,
hält er in einem Haltverbot!
Bekommt hier eine Laufradkralle,
das ist für ihn doch keine Falle …
An seinem Schlitten sind die Kufen,
die schnellen Pferde haben Hufen.
Und er beschenkt die vielen Kinder,
in diesem strengen, kalten Winter.
Die Kinder von den Politessen,
hätt er aus Ärger fast vergessen.
Auch sie bekommen ihre Gaben,
damit sie Freud am Fest noch haben.
Und die Moral von der Geschicht?
verderbt es mit dem Niklaus nicht …
Steht eine Ampel mal auf Rot,
begleitet ihn in dieser Not,
mit Hupen und mit blauem Licht!
Stopp und Ende vom Gedicht.
Matthias Albrecht
Eine Kinderweihnachtsfeier im Gefängnis
Unsere Gewerkschaft hatte Mitte der neunziger Jahre die Tradition ins Leben gerufen, alljährlich eine Weihnachtsfeier für die Kinder der Bediensteten unserer Justizvollzugsanstalt auszurichten. Die dafür benötigten finanziellen Mittel wurden aus den sogenannten „Rücklaufgeldern“ der monatlichen Beiträge sowie aus einem geringen, vor der Feier zu zahlenden Obolus der Eltern beglichen. Als Ausrichtungsort diente stets der große Speisesaal unserer Anstalt.
Die Veranstalter sahen der ersten Feier mit gemischten Gefühlen entgegen, fehlte es doch noch an Erfahrungen auf diesem Gebiet. Man hatte einen künstlichen Tannenbaum besorgt und festlich geschmückt, für jedes Kind einen buntbedruckten Weihnachtspappteller mit den üblichen Backwaren, Nüssen, Schokoladenfiguren und Früchten bereitgestellt, einen Zauberer für das Rahmenprogramm engagiert und mit den Eltern vereinbart, dass diese vor dem Festakt ein verpacktes, beschriftetes Geschenk für ihre Sprösslinge abzugeben hatten. Soweit, so gut. An alles war gedacht worden – nur die Hauptsache fehlte noch: der Weihnachtsmann! Einen solchen über die „Weihnachtsmannagentur“ zu ordern, kam aus Kostengründen nicht infrage. Was lag da näher, als ihn aus den Reihen unserer Bediensteten zu rekrutieren? Doch seltsam, niemand wollte diese Rolle übernehmen, nicht einmal diejenigen, welche sonst die große Klappe hatten oder sich gern reden hörten. Typisch Männer! Unsere Frauen hatten da weniger Berührungsängste. Drei meldeten sich noch während der Versammlung freiwillig, gaben allerdings selbst zu bedenken, dass eine weibliche Rollenbesetzung einen gewissen Gesichtsverlust für unsere Anstalt bedeuten könnte, waren doch hier weit mehr Männer als Frauen beschäftigt. Naturgemäß stand auch zu befürchten, dass von den Kindern eine „Weihnachtsfrau“ auf weitaus geringere Akzeptanz stoßen würde, als ein männlicher Vertreter dieser Zunft.
Nach erfolgreicher Überzeugungsarbeit unseres Vorsitzenden erklärte schließlich ich mich bereit, den Part des allseits beliebten Weihnachtsmanns zu übernehmen. Schien ich doch infolge meiner tiefen Stimmlage und wohlgenährten Erscheinung dafür geradezu prädestiniert zu sein und besorgte mir im Weiteren das entsprechende Outfit: Bart, Mantel mit Kapuze, Stiefel, Rute, weiße Zwirnshandschuhe und eine Gesichtsmaske. Auf letztere hätte ich unter anderen Umständen verzichten können, doch meine sechsjährige Tochter, welche mit von der Partie war, durfte mich nicht erkennen, um nicht den Glauben an die Wahrhaftigkeit des Weihnachtsmanns zu verlieren oder meine Tarnung auffliegen zu lassen.
Endlich war es soweit. Drei Dutzend aufgeregt schnatternde Kinder waren mitsamt ihrer nicht weniger mitteilsamen Geschwister, Eltern und Großeltern im aus den Nähten platzenden Speiseraum versammelt und harrten der Dinge, die da kommen sollten, während ich (noch in Zivil) im Nachbarraum zum hundertsten Mal meine Begrüßungsverse vor mich hin brabbelte und nervös eine Zigarette nach der anderen rauchte. Das Lampenfieber hatte sich meiner bemächtigt. Die Minuten dehnten sich zu Stunden.
Ich schlich über den Flur zur nur angelehnten Speisesaaltür und beobachtete durch den Spalt das Vorprogramm: Die Aufführung des Zauberers. In der Verkleidung des Gestiefelten Katers schlich er katzengleich durch den Raum und kommentierte mit durchdringender Stimme seine Kunststücke. „Ich liebe dicke, weiße Mäuse!“, rief er und ließ eine Handvoll Papierstreifen sehen. „Doch noch lieber sind mir die blauen!“ Flutsch – schon hatten sich die wertlosen Schnipsel in Hundertmarkscheine verwandelt. „Gib her!“, rief ein altkluger Knirps aus der ersten Reihe, der seine Chance witterte, sein mageres Taschengeld aufzubessern, doch der Zauberer hütete sich, der unverschämten Forderung nachzukommen; wahrscheinlich waren die Scheine echt.
Echt war auch der Schreck, den ich bekam, als eine meiner Kolleginnen zu mir nach draußen huschte und mir beinahe die Tür an den Kopf schlug. „Was machst du denn noch hier ohne Verkleidung?“, raunte sie. „Jetzt aber los und schnell umgezogen. Du hast nur noch zehn Minuten!“ Sie schob mich vor sich her und half mir im Gewerkschaftszimmer beim Ankleiden, während der Zauberer im Saal ein Meerschwein in einen Stubentiger und ein leeres in ein volles Glas Milch verwandelte.
Er hätte lieber mich verwandeln sollen, in einen Weihnachtsmann nämlich, denn das Ankleiden gestaltete sich zeitaufwändiger als gedacht. Ohne fremde Hilfe wäre es mir nicht gelungen, mich in das Kostüm zu zwängen, hatte ich doch darauf bestanden, meine dick gefütterte Winterjacke unter dem roten Rock zu tragen, um der immensen Körperfülle des Alten so nahe wie möglich zu kommen. Nachdem ich nebst Plastikmaske und Rauschebart alles angelegt und wir das breite Lederkoppel mit Ach und Krach geschlossen hatten, fühlte ich mich wie ein Astronaut im Raumanzug unter den Bedingungen der Schwerkraft: Meine Bewegungsfreiheit war extrem eingeschränkt.
Ich hatte indes keine Zeit mehr, Betrachtungen über meine hilflose Lage anzustellen, denn in diesem Augenblick verkündete der Zauberer, dass er den Weihnachtsmann vor seinem geistigen Auge erblickt habe. Die Kinder sollten nur nach ihm rufen, dann werde er sich schon zeigen. Meine Kollegin wuchtete mir einen von zwei riesigen, schweren Jutesäcken aufs Kreuz. Ich brach fast zusammen unter dieser Last. Obendrein war mein Blickfeld infolge der verrutschten Maske stark eingeschränkt und so ergriff sie meine Hand und führte mich schnellen Schrittes zur Tür des Speiseraums. Den anderen Sack schleifte sie hinter sich her.
„Geh schon!“, zischte sie und stieß die Tür zur Hälfte auf.
„Wohin denn? Ich kann nichts sehen!“ Ich versuchte, mir mit der Linken, mit der ich zudem die Rute umklammerte, die Maske zurechtzurücken, während die Kinder bereits zum fünften Mal nach dem Weihnachtsmann riefen. Schließlich erbarmte sich meine Kollegin, riss mich resolut an sich, rückte die Maske gerade, drehte mich herum und schubste mich in den Saal.
Das Hurra-Gebrüll der Kinder brach abrupt ab. Wahrscheinlich hatten sie noch nie solch einen merkwürdigen Weihnachtsmann erblickt, der statt ihrer die Fensterfront fixierte, mit der Rute durch die Luft fuchtelte und seine Verse aufzusagen begann:
„Hoch vom Norden komme ich her,
Und ich muss sagen, mein Sack ist recht schwer.
Doch jetzt kann ich nicht mehr
Und stell ihn hierher.
Denn ich hab da viele Geschenke drin.
Sie zu verteil’n, das ist der Sinn … “
Ich wuchtete den Sack zu Boden und versuchte krampfhaft, mich der letzten beiden Verse zu erinnern. Doch sie wollten mir partout nicht einfallen. Meine Kollegin, die sich dem Publikum als helfender Weihnachtsengel vorstellte, drehte mich zu den Kindern herum und rückte mir die Maske abermals zurecht. Der kleine Ausschnitt der Umgebung, den ich durch die Augenlöcher wahrnehmen konnte, ließ mich in erstaunte, ängstliche Kinderaugen blicken. Die Erwachsenen in den hinteren Reihen schauten gleichermaßen amüsiert wie mitleidig lächelnd auf das rot gekleidete Häufchen Elend, das sich abmühte, das Ende des Fadens zu finden, mit dem der Sack zugebunden war. Wieder kam mir mein Weihnachtsengel zu Hilfe. Mit dem Resultat, dass wir mit den Köpfen zusammenstießen, ich vor Schreck das Gleichgewicht verlor und der Länge nach hintenüber fiel.
Der Bann war gebrochen. Die Kinder kreischten vor Vergnügen, während ich mir vom Engel aufhelfen ließ und das erste Geschenk in die Hände gedrückt bekam. Ich drehte den Kopf hin und her, um die Aufschrift entziffern zu können und rief schließlich den Namen des Kindes in den Saal. Ein Steppke von höchstens dreieinhalb Jahren kam auf mich zu gerannt, riss mir das Paket (das größte von allen) aus den Händen und eilte von dannen. Die belustigten Erwachsenen honorierten es mit Applaus, während mir mein Engel schnell ein weiteres Päckchen zuschob und selbst den nächsten Namen aufrief. Der zu Beschenkende war zwar mindestens doppelt so alt wie der Knirps, schien jedoch ebenfalls kurz angebunden zu sein – immerhin murmelte er ein „Danke“, bevor er es seinem Vorgänger gleich tat und mit seiner Beute flüchtete.
Gut, dachte ich belustigt, je eher du fertig bist, desto besser. Ich schwitzte bereits aus allen Poren – und das nicht nur vor Aufregung. Der gute Vorsatz, jedem Kind ein Gedicht, Lied oder Versprechen abzuverlangen, war nun dahin. Mein Weihnachtsengel und ich fertigten unsere Kunden im Rekordtempo ab – mit einer Ausnahme:
Die Oma eines Geschwisterpaares hatte mir im Vorfeld einen Notizzettel zugesteckt, dessen Inhalt ich auf jeden Fall den beiden unter die Nase reiben sollte; das wäre wohl auch im Sinne der Eltern, die an diesem Tag leider verhindert waren. Ich versprach, es zu tun, merkte mir die Namen und holte nun besagte Zwillinge gleichzeitig nach vorn. Die Geschenke zu meinen Füßen, zog ich den Zettel hervor und begann, den Knirpsen die Leviten zu lesen. Sie wussten wohl, dass die Päckchen auf dem Boden früher oder später für sie bestimmt waren. Aber sie hörten sich meine Predigt an, wenngleich die Geschichte für beide ziemlich peinlich sein musste und ihnen am Ende das Versprechen abgenötigt wurde, das Meerschwein nicht mehr im Aquarium schwimmen zu lassen und auch besser darauf zu verzichten, ein zweites Mal ein Indianer-Lagerfeuer auf dem Wohnzimmerteppich zu entfachen.
Als ich den beiden die Geschenke übergeben wollte und mich dazu bücken musste, lief mir der Schweiß, der sich zuvor im Maskenkinn angesammelt hatte, in dünnen Strahlen aus den Plastik-Nasenlöchern. Sicherlich kein schöner Anblick. Die Zwillinge hatten sich – ihre Geschenke geistesgegenwärtig an sich reißend – schnell in die Obhut der Oma begeben, bevor es dem Alten einfallen konnte, auch noch Dampfschwaden auszustoßen oder gar Feuer zu speien.
Nach und nach wurde es im Saal immer unruhiger. Der Großteil der bereits beschenkten Kinder ignorierte den sich nach allen Regeln der Kunst abmühenden Alten und widmete seine Aufmerksamkeit ausschließlich den ausgepackten Gaben. Ich beschleunigte die Fließbandabfertigung angesichts solcher Respektlosigkeit, bis das letzte Geschenk verteilt war und raunte, völlig entkräftet, den Kindern ein „Frohes Fest und guten Rutsch ins neue Jahr“ zu. Doch hätte ich mich jetzt ebenso gut nackt ausziehen und mit den Ohren oder sonst etwas wackeln können; längst nahm mich niemand mehr wahr und so schlich ich, von meinem Engel gefolgt, sowohl desillusioniert als auch erleichtert, aus dem Saal in der Hoffnung, dass mich ein eventueller Herzinfarkt erst draußen ereilen möge …
Später berichteten mir viele Eltern, die Weihnachtsfeier sei ein großer Erfolg gewesen und hätte den Kindern gefallen. Insbesondere der Auftritt des „komischen“ Weihnachtsmanns!
Ich nahm es als Kompliment und Motivation, hatte mir doch der Vorsitzende unserer Gewerkschaft ein Weihnachtsmannmandat für die nächsten Jahre in Aussicht gestellt. Es wurden insgesamt noch etwa sechzehn derartige Events, bevor aus Gründen der Nachwuchsproblematik – unser Bediensteten-Bestand alterte unaufhaltsam vor sich hin – die wenigen Voranmeldungen keine weiteren Kinderweihnachtsfeiern mehr zustande kommen ließen.
Schade eigentlich …
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.