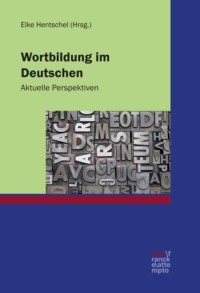Kitabı oku: «Wortbildung im Deutschen», sayfa 6
Literatur
Balnat, Vincent (2011): Kurzwortbildung im Gegenwartsdeutschen. Hildesheim/Zürich/New York: Olms.
Bär, Jochen/Roelke, Thorsten/Steinhauer, Anja (eds.) (2007): Sprachliche Kürze. Konzeptuelle, strukturelle und pragmatische Aspekte. Berlin/New York: De Gruyter.
Bellmann, Günther (1980): „Zur Variation im Lexikon“. Wirkendes Wort 30: 369–383.
Busse, Ulrich/Schneider, Dietmar (2007): „Kürze im englischen Wortschatz“. In: Bär, Jochen/Roelke, Thorsten/Steinhauer, Anja (eds.) (2007): Sprachliche Kürze. Konzeptuelle, strukturelle und pragmatische Aspekte. Berlin/New York, De Gruyter: 159–180.
Bußmann, Hadumod (2008): Lexikon der Sprachwissenschaft. 4. Ergänzte Auflage. Stuttgart: Kröner.
Dudenredaktion (ed.) (2005): Duden. Die Grammatik. 7., völlig neu erarbeitete und erwei- terte Auflage. Mannheim etc.: Dudenverlag. (= Duden 4).
Eichinger, Ludwig (2000): Deutsche Wortbildung. Eine Einführung. Tübingen: Narr.
Fleischer, Wolfgang/Barz, Irmhild (2012): Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache. 4. Auflage; völlig neu bearbeitet von Irmhild Barz unter Mitarbeit von Marianne Schröder. Berlin/Boston: De Gruyter.
Grebovic, Selma (2007): Kurzwörter in Pressetexten. Würzburg: Würzburger elektronische sprachwissenschaftliche Arbeiten.
Kobler-Trill, Dorothea (1994): Das Kurzwort im Deutschen. Eine Untersuchung zu Definition, Typologie und Entwicklung. Tübingen: Niemeyer.
Kromminga, Jan-Henning (2007): Kurzwörter im Text. Varianz und Kohärenz. Universität Leipzig, Magisterarbeit.
Kromminga, Jan-Henning/Becker, Matthias Jakob (2015): „Unternehmen und Ungeheuer. Über Konzeptbereiche dominanter Terror-Metaphern“. In: Humer, Stephan (ed.): Terrorismus A/D. Winnenden, CSW-Verlag: 63–82.
Michel, Sascha (2006): „Kurzwortgebrauch. Plädoyer für eine pragmatische Definition und Prototypologie von Kurzwörtern“. Germanistische Mitteilungen 64: 69–83.
Michel, Sascha (2011): „Das Kurzwort zwischen ‚Langue‘ und ‚Parole‘. Analysen zum Postulat der Synonymie zwischen Kurzwort und Vollform“. In: Elsen, Hilke/Michel, Sascha (eds.): Wortbildung im Deutschen zwischen Sprachsystem und Sprachgebrauch. Stuttgart, Ibidem: 135–164.
Naumann, Bernd (2000): Einführung in die Wortbildungslehre des Deutschen. 3., neu bearbeitete Auflage. Tübingen: Niemeyer.
Poethe, Hannelore (1997): „Kurzwörter. Gebrauch und Bestand vor und nach 1989“. In: Barz, Irmhild/Fix, Ulla/Schröder, Marianne (eds.): Deutsch-deutsche Kommunikationserfahrungen im arbeitsweltlichen Alltag. Heidelberg: Winter.
Ronneberger-Sibold, Elke (1997): „Sprachökonomie und Wortschöpfung“. In: Birkmann, Thomas et al. (eds.): Vergleichende germanische Philologie und Skandinavistik. Festschrift für Otmar Werner. Tübingen, Niemeyer: 249–261.
Schröder, Marianne (1985): „Zur Verwendung von Kurzformen“. Beiträge zur Erforschung der deutschen Sprache 5: 199–209.
Schwarz-Friesel, Monika (2014): „‚Hydra, Krake, Krebsgeschwür, Sumpf, Killer-GmbH, Franchise-Unternehmen und Nebelwolke‘. Perspektivierung und Evaluierung von islamistischem Terrorismus durch Metaphern im deutschen Pressediskurs nach 9/11“. In: Schwarz-Friesel, Monika/Kromminga, Jan-Henning (eds.): Metaphern der Gewalt. Konzeptualisierungen von Terrorismus in den Medien vor und nach 9/11. Tübingen, Francke-Verlag: 51–74.
Schwarz-Friesel, Monika/Kromminga, Jan-Henning (2013): „9/11 als globale Katastrophe. Die sprachlich-kognitive Verarbeitung des 11. September 2001 in der Berichterstattung deutscher Medien. Eine Analyse im Rahmen der kritischen Kognitionslinguistik“. Sprachtheorie und germanistische Linguistik 23/1: 1–22.
Schwarz-Friesel, Monika/Kromminga, Jan-Henning (eds.) (2014): Metaphern der Gewalt. Konzeptualisierungen von Terrorismus in den Medien vor und nach 9/11. Tübingen: Francke.
Skirl, Helge/Schwarz-Friesel, Monika (2007): Metapher. Heidelberg: Universitätsverlag Winter. (= Kurze Einführungen in die germanistische Linguistik 4).
Starke, Günter (1997): „Kurzwörter: Tendenz steigend“. Der Deutschunterricht 50/2: 88–94.
Steinhauer, Anja (2000): Sprachökonomie durch Kurzwörter. Bildung und Verwendung in der Fachkommunikation. Tübingen: Narr.
Steinhauer, Anja (2007): „Kürze im deutschen Wortschatz“. In: Bär, Jochen/Roelke, Thorsten/Steinhauer, Anja (eds.) (2007): Sprachliche Kürze. Konzeptuelle, strukturelle und pragmatische Aspekte. Berlin/New York, De Gruyter: 131–158.
Weber, Heinrich (2002): „Die Inhaltsseite von Kurzwörtern und Abkürzungen“. In: Cruse, Allen (ed.): Lexikologie. Ein internationales Handbuch zur Natur und Struktur von Wörtern und Wortschätzen. Berlin/New York, de Gruyter: 457–460.
Wichmann, Peter (2014): Al-Qaida und der globale Djihad. Eine vergleichende Betrachtung des transnationalen Terrorismus. Wiesbaden: Springer VS.
Ist die NominalisierungNominalisierung von PartikelverbenPartikelverb im DeutschenDeutsch Argument für deren lexikalische Bildung?
Eine Diskussion unter besonderer Berücksichtigung von +KOMM- und +KUNFT
Peter Öhl
Abstract
Due to their transparency to syntactic operations, particle verbs should be analysed as constituted by syntactic objects. On the other hand, since their meaning is often non-transparent to logical decomposition, they are often regarded as products of lexical word formation. This assumption seems to be supported by their lexical properties, among them the existence of nouns apparently resulting from their nominalisation according to lexical rules. This paper discusses these arguments and argues that the nouns in question can be formed independently by lexical composition. Thus, it does not seem necessary to assume the lixical formation of particle verbs.
1 Einführung
Dieser Aufsatz soll im Hinblick auf die Grammatik des DeutschenDeutsch zur Erklärung des vieldiskutierten und offenbar universellen Phänomens1 der Bildung komplexer Prädikate vom Typ Verb+Partikel beitragen. Hierzu verwende ich zum einen grammatiktheoretische, zum anderen etymologischeetymologisch Methoden.
Es ist zu beobachten, dass PartikelverbenPartikelverb (fortan Ptk-Vn) in mehrfacher Hinsicht an der Schnittstelle zwischen Morphologie und SyntaxSyntax zu stehen scheinen. Obgleich syntaktisch trennbartrennbar, haben sie eine mit lexikalisch-semantischen Mitteln beschreibbare komplexe Bedeutung, die in vielen Fällen nicht logisch dekomponierbar ist. Dies lässt sich anhand deutscher Beispiele leicht demonstrieren:
| (1) | a. | Der Zug kam pünktlich in Bern an. |
| b. | Sie kamen in dieser Sache überein. | |
| (2) | a. | an.kommen: [+Bewegung, +telisch, …]; ≠ [[ an’]] + [[ komm’]] |
| b. | überein.kommen: [–Bewegung, +telisch …]2; ≠ [[ über’]] + [[ ein’]] + [[ komm’]] |
Somit werden sie oft als lexikalische Einheiten analysiert, was sich durch ihre Transparenz für Wortbildungsprozesse zu bestätigen scheint. Die NominalisierungNominalisierung ist augenscheinlich sogar bei syntaktisch transparenten Ptk-Vn möglich, deren Verbpartikel (fortan V-Ptk) für syntaktische Prozesse wie Vorfeldbesetzung, W-Skopus oder separate Modifizierung zugänglich ist.
| (3) | a. | ?Her wollten sie dann doch nicht kommen.3 |
| b. | Woher/ Von dort her seid Ihr alle gekommen? | |
| c. | Herkunft |
Gegen dieses Beispiel ist freilich sogleich einzuwenden, dass die Bedeutungsinterpretation des entsprechenden Substantivs durch Idiomatisierung stark eingeschränkt ist.
| (4) | Woher kommst Du gerade? – #Meine Herkunft ist Wuppertal. |
Viele als Partikelverbnominalisierung zu erkennende Bildungen sind demotiviert:
| (5) | a. | Auskunft, Zukunft, %Hinkunft (% = auf Varietäten beschränkt; hier: ein Austriazismus, der Ähnliches wie ‚Zukunft‘ denotiert), |
| b. | nicht parallel zu auskommen, (hin)zukommen, hinkommen |
Zudem werden Ptk-Vn mit komm(en) eher als Infinitivbildungen nominalisiert, wenn sie dekomponierbar sind:
| (6) | a. | Viel weiter sind wir leider nicht gekommen. |
| b. | Ein Weiterkommen/*eine Weiterkunft war schwer. |
Um in Fällen wie diesem eine Regelmäßigkeit zu erkennen, ist nicht nur der zunächst hypothetische (aber durch die Lemmata in etymologischenetymologisch Lexika wie Kluge 2011 völlig bestätigte) Schluss naheliegend, dass die nicht mehr produktive Nominalbildung %+kunft nur bei älteren und wohl daher oft nicht mehr logisch transparenten Ptk-Vn konserviert ist, sondern auch, dass die NominalisierungNominalisierung mit syntaktisch eigenständigen „V-Ptkn“ vorzugsweise in Form von Zusammenrückung mit dem InfinitivInfinitiv vor sich geht.
Die typische Ptk-V-Konstruktion schlage ich als syntaktisch komplexes Prädikatsyntaktisch komplexes Prädikat zu beschreiben vor. Ihre Bedeutung ist nur aufgrund von Idiomatisierung intransparent. Ich werde zunächst einen kurzen Überblick über die Diskussion der Kategorie von V-Ptkn in der Forschung geben und für deren Status als selbständigen Kopf im Verbalkomplex argumentieren. Diese Annahme soll erklären, warum Ptk-Vn für manche syntaktische Operationen, jedoch nicht für alle zugänglich sind. Danach werde ich, ausgehend von Beobachtungen, die Stiebels/Wunderlich (1994) bei ihrer Argumentation für den Wortgliedstatus der V-Ptkn anstellen, augenscheinliche NominalisierungenNominalisierung von Ptk-Vn mit dem Basisverb komm- diskutieren und schließlich dafür argumentieren, dass komplexe Nomen mit EntsprechungenEntsprechung in Ptk-Vn keinen Nachweis für die lexikalische Partikelverbbildung darstellen, da sie generell unabhängig von einer verbalen Basis gebildet werden können.
2 VerbpartikelnVerbpartikel im DeutschenDeutsch
2.1 Das Problem der Kategorisierung
Wer mit der einschlägigen Forschung vertraut ist, kennt natürlich die Besonderheit der Grammatik von Ptk-Vn, die zu Uneinigkeit darüber geführt hat, ob diese syntaktisch oder lexikalisch gebildet würden. Sind V-Ptkn Wortglieder, selbständige Köpfe im Verbalkomplex oder gar syntaktische Konstituenten/Phrasen?
Während ein verbales PRÄFIXPräfix (fortan Pfx) stets unbetont und niemals abtrennbar ist, tragen V-PTKN einen WortakzentWortakzent und sind abtrennbar, was sich z.B. in Verbzweitsätzen zeigt, wo sie nicht beim Finitum nach der ersten Konstituente stehen, also der linken Klammer im Topologischen Feldermodell, oder auch C° im generativen Phrasenstrukturmodell.
| (7) | a. | er’reichen (Der Apostroph markiert die darauf folgende betonte Silbe.) |
| b. | Der FC Bayern er’reichte am Ende fast alle seine Ziele. | |
| (8) | a. | ’durch.reichen1 |
| b. | Den HSV reichte man in fast bis ans Tabellenende durch. |
Bei der Partizip-Perfekt-Bildung gehen V-Ptkn dem Pfx ge- voran, mit dem andere Präverben in der Regel sogar inkompatibel sind (cf. 9c).
| (9) | a. | Sie haben das Parkett blank.gebohnert. | (PartikelverbPartikelverb) |
| b. | Sie hat ihn dadurch bloß.gestellt. | (PartikelverbPartikelverb) | |
| c. | Sie haben das Parkett zerbohnert/ *gezerbohnert/ *zergebohnert. | (Präfixverb) |
Auch der Infinitivpartikel zu gehen V-Ptkn im Gegensatz zu sonstigen Präverben voran.
| (10) | a. | Sie wurden gebeten, das Parkett blank.zu.bohnern/ *zu blankbohnern. | (PartikelverbPartikelverb) |
| b. | Sie wurde davor gewarnt, ihn bloß.zu.stellen/ *zu bloßstellen. | (PartikelverbPartikelverb) | |
| c. | Sie wurden gebeten, das Parkett zu zerbohnern/ *zerzubohnern. | (Präfixverb) |
Weitere Argumente für die Selbständigkeit von V-Ptkn sind, dass man sie oft separat modifizieren kann – in Bsp. (11) ist es eindeutig kennen, auf das sich das Adverbial bezieht – und die Vorfeldbesetzung, die zumindest unter geeigneten Bedingungen augenscheinlich möglich ist.
| (11) | weil sie ihn dadurch etwas besser kennen.lernen konnten | ||
| (12) | a. | Auf geht die Sonne im Osten, aber unter geht sie im Westen. | (Lüdeling 2001: 53) |
| b. | Sehr nahe ging dem Prinzen der Verlust seines Kanarienvogels. | (ibd. 54) |
Folgende Kriterien werden in der Forschung gewöhnlich für die Vorfeldfähigkeit angeführt:
| (13) | Kriterien für die Vorfeldbesetzung durch Prädikatelemente | |
| a. | diskurssemantische Markiertheit | |
| b. | semantische Transparenz/ Dekomponierbarkeit des Prädikats | |
| c. | Phrasenstatus | |
Als diskurssemantische Faktoren werden in der Literatur vor allem Kontrast und Fokussierung genannt (cf. Müller 2002: 276f.; Zeller 2003: 4f.; Heine et al. 2010: 46–49).
| (14) | a. | Die Tür ist erst auf- und dann wieder zu.gegangen. |
| b. | Auf ging die Tür, zu aber das Fenster. |
Dass diese allein jedoch für die Vorfeldbesetzung alleine nicht ausreichen, zeigt sich an folgenden Beispielen:
| (15) | a. | Sie haben ihm das Diplom erst an- und dann wieder ab.erkannt. |
| b. | *Ab- haben sie ihm zwar das Diplom erkannt, an- aber seine Mühen. | |
| (16) | a. | Sie haben alle Eier aus- und alle Luftballons auf.geblasen. |
| b. | *Aus- haben sie alle Eier und auf- alle Luftballons geblasen. |
Soll der Satz nicht zumindest markiert sein, müssen nach der Separierung beide Teile der Verbindung interpretierbar sein, weshalb bei Beispielen wie den folgenden keine Vorfeldbesetzung durch die Partikel möglich scheint.
| (17) | a. | *An ist der Zug erst spät gekommen, obwohl er rechtzeitig weg.kam | (an ist desemantisiert) |
| b. | *Ganz zusammen hat sich die Menge im Hof gerottet. | (rott- ist synchron kein VERBUM SIMPLEX) |
Was den Phrasenstatus betrifft, so wurde auf der Basis der Beobachtung, dass manche V-Ptkn zwar ins Vorfeld, aber nicht im Mittelfeld zu verschieben seien, oft dagegen argumentiert, dass diese Eigenschaft kriterial sei.
| (18) | a. | weil in dieses Land dieses Jahr noch niemand gereist ist | (Zeller 2002: 243) |
| b. | *weil ein dieses Jahr noch niemand gereist ist | ||
| (19) | a. | weil auf diesen Wagen nichts geladen wurde | (ibd.) |
| b. | *weil auf noch nichts geladen wurde |
Dieses heterogene Verhalten führt z.B. Zeller (2002) dazu, V-Ptkn als hybride Kategorie zu identifizieren, die sich einmal wie Köpfe, ein anderes Mal wie Phrasen verhielten. Heine et al. (2010: 57–59) tendieren dazu, einen Status zwischen Wort und Phrase anzusetzen, ähnlich auch Ackermann/Webelhuth (1998). Stiebels/Wunderlich (1994:929) schlagen dagegen in einem lexikalistischen Ansatz vor, dass Pfx-Vn und Ptk-Vn beide auf die gleiche Weise lexikalisch gebildet würden, doch hätten Pfxe und Ptkn unterschiedliche inhärente Merkmale, die V-Ptkn syntaktisch transparent machen könnten:
| (20) | a. | prefix verb: [ Y+min V ] | (⇒ Y cannot constitute a possible word) |
| b. | particle verb: [ Y+max V ] | (⇒ Y enters the syntax as Y°) |
Das Merkmal [+max] werde nicht lexikalisch zugewiesen, sondern dann, wenn die Struktur [Y+max V] syntaktisch gebildet würde. Eines der Hauptargumente für die lexikalische Bildung stellt die Annahme dar, dass von Ptk-Vn Substantive abgeleitet werden könnten.
Mit Ansätzen dieser Art mag die Separierbarkeit wie in (8), (9) und (10) erklärt werden können, selbst wenn man Ptk-Vn als lexikalische Bildungen ansehen möchte; das unterschiedliche Verhalten hinsichtlich der Verschiebung in Mittel- und Vorfeld sowie der Phrasenbildung bleibt jedoch ungeklärt. In verschiedenen Aufsätzen (z.B. Öhl 2013; Öhl/Falk 2011) argumentierte ich deshalb dafür, dass echte V-Ptkn stets als Köpfe im V-Komplex generiert werden; augenscheinliche Bewegungsoperationen sind m.E. entweder dadurch zu erklären, dass mit V-Ptkn homophone Phrasenköpfe vorliegen, oder dass Sprecher zu Konstituentenbewegungsstrukturen analoge, jedoch nicht regelbasierte Abfolgen bilden, die bei der Beurteilung stets Markiertheitswerte aufweisen.
Im Folgenden werde ich zunächst dieses Modell skizzieren und dafür plädieren. Des Weiteren werde ich dafür argumentieren, dass die Annahme der lexikalischen Bildung von Ptk-V aufgrund der existierenden nominalen Wortbildungsprodukte nicht zwingend und somit eine syntaktische Rekategorisierung mithilfe eines Merkmals [+max] nicht notwendig ist.
2.2 Kopfpositionen im Verbalkomplex
Das hier verwendete Modell des V-Komplexes ist eng an solche wie z.B. von Haider (2010: 272f.) vorgeschlagen angelehnt:1Verbpartikel Sämtliche Verbformen (einschließlich des Finitums, wenn dieses sich in Basisposition befindet) bilden einen komplexen Kopf V°. Ein solches komplexes Prädikat kann sowohl die Inifinitivpartikel als auch die hier zur Diskussion stehenden V-Ptkn enthalten. Hierdurch ergibt sich eine bekannte Asymmetrie zwischen der DeutschenDeutsch und Englischen Partikelverbsyntax: Im Deutschen können nur ganze Verbalkomplexe inklusive Infinitivpartikel koordiniert werden, nicht, wie im Englischen, 2 Simplexverben, die durch eine adjungierte V-Ptk modifiziert werden, wo zudem die gesamte VP Komplement der Inifinitivpartikel in I° ist.
| (21) | a. | Sie begannen [VP [ schön [V° vor.zu.tanzen ] und [V° *(vor.zu).singen] ] ]. |
| b. | They started [IP [I’ toI° [VP [V’ [V’ dance and sing ] up ] in a beautiful way ] ] ]. |
Aus diesem Grund ist KOPFADJUNKTION der Partikel in einer höheren Position des komplexen Kopfes V° (bezeugt zumindest in manchen Mundarten) möglich, nicht jedoch in einer höheren Position der VP: Die Partikel ist eben keine Phrase und kann sich nicht in einer Phrasenposition im Mittelfeld befinden.
| (22) | a. | %dass er das Licht schnell [V° an hat schalten sollen] |
| b. | *dass er das Licht [V’ an [V’ schnell [V° hat schalten sollen] ] ] |
Es ist also ein zumindest nicht abwegiger Schluss, dass V-Ptkn Einträge als lexikalische Köpfe haben, die jedoch keine eigene Phrase projizieren, sondern, spezifiziert für bestimmte VerbenVerb, mit diesen syntaktisch ein komplexes Prädikat formen können.
Was ist aber mit jenen Ptkn, die augenscheinlich doch in Form von Phrasen vorkommen und an anderen Stellen im Satz auftreten? Aus meiner Sicht ist anzunehmen, dass es sich hier um lexikalische Prädikate handelt, die zwar parallel zu homophonen Ptkn existieren, jedoch Phrasen projizieren, die dann resultative Interpretation haben. Sie sind separat modifizierbar, vorfeldfähig und, mit gewissen informationsstrukturellen Restriktionen, auch im Mittelfeld verschiebbar – wie andere Adverbiale gleicher Funktion.
| (23) | a. | Ganz zu ist diese Tür noch nie gegangen. |
| b. | Die Tür ist schon immer ganz zu nur mit Gewalt gegangen. | |
| (24) | a. | weil in meinen Froschteich noch kein Stein gefallen ist |
| b. | dass nämlich heraus noch nie ein Stein gefallen ist, hinein aber schon |
Auf diese Weise lassen sich auch Korpusbelege wie die von Müller (2002: 294) zitierten erklären, wo V-Ptkn augenscheinlich eine Phrase im Mittelfeld bilden.
| (25) | Andrew Halsey ist auf dem Weg von Kalifornien nach Australien [AdvP weit ab vom Kurs] gekommen. |
Dass die Wortstellung in dem Zeitungsbeleg (taz, 10.04.1999, S. 20) wohl nicht allen Lesern völlig unmarkiert vorkommt, liegt sicherlich daran, dass ab als Adverb in diesem Kontext etwas ungewöhnlich erscheint. Doch scheinen Sprecher eine mehr oder weniger stark ausgeprägte Bereitschaft zu zeigen, auch nicht regulär generierbare Konstruktionen zu tolerieren, wenn sie sie zu dekodieren in der Lage sind. Auch in den folgenden Satzpaaren scheint die Akzeptanz der Sätze in (a) mit V-Ptkn im Vorfeld dadurch begründbar, dass diesen eine zumindest intuitiv plausible Interpretation gegeben werden kann, was in (b) nicht gut möglich ist.
| (26) | a. | ?Vor haben sie es nicht gehabt. (vs. Vorgehabt haben sie es nicht. ≈ etwas vor sich haben)2 |
| b. | *Auf ist ihm gar nichts gefallen. (vs. Aufgefallen ist ihm gar nichts. ≈ ?) | |
| (27) | a. | ?Ein haben sie das Heu geladen, aus das Stroh. (≈ das Heu ist darin) |
| b. | *Ein haben sie die Banker geladen, aus die Linguisten. (≈ #die Banker sind darin) |
Zum Vergleich ein nicht grammatisch markierter Satz:
| (28) | Auf ging die Tür (, worauf sie (ganz) auf war). |
Besonders naheliegend scheint mir diese Art der Erklärung in Fällen, für die Heine et al. (2010: 41–46) eingeschränkte Vorfeldfähigkeit diagnostiziert haben. Folgende Korpusbelege zeigen V-Ptkn im Vorfeld von Sätzen mit dem Vollverb in der linken Klammer, die schlicht als ungrammatisch zu identifizieren sind, wenn sich dort stattdessen ein Auxiliar befindet.
| (29) | a. | An fing alles am 2. Januar 1889, als … | (Heine et al. 2010: 41f.) |
| b. | Kennen lernten sich die beiden Mitte der 80er Jahre (…) | ||
| c. | Richtig auf regt mich im Moment, wie der arme Gomez von den Medien fertig gemacht wird. | ||
| (30) | a. | *An hatte alles am 2. Januar 1889 gefangen, als … | |
| b. | *Kennen haben sich die beiden Mitte der 80er Jahre (…) gelernt. | ||
| c. | *Richtig auf hat mich geregt, wie der arme Gomez von den Medien fertig gemacht wird. |
Ich habe deshalb vorgeschlagen (z.B. in Öhl 2013; Öhl/Falk 2011), dass Sprecher analog zu regelbasierten Strukturen lineare Abfolgen konstruieren können, die, obgleich sie markiert sind, doch akzeptiert werden, wenn Dekodierungskonflikte lokal, also dort, wo ein Regelverstoß vorliegt, ausgeglichen werden können. In den Beispielen in (29) ist dies die Abfolge Partikel>Vollverb, wo ja nur lineare Adjazenz vorliegt.
| (31) | Lizenzierung sprachlicher Strukturen | (vgl. Öhl 2013: 349) | |
| a. | kompetenzbasiert, durch reguläre strukturbildende Operationen ODER | ||
| b. | performanzbasiert, durch analogischen Abgleich mit regulär gebildeten Mustern, wenn Dekodierungskonflikte lokal ausgeglichen werden können. | ||
Was im Satz verschoben werden kann, ist eine Phrase. Echte V-Ptkn sind jedoch Köpfe in einem komplexen Prädikat, adjungiert an V°. Da nur das minimale finite VerbVerb in die linke Satzklammer bewegt wird (C° im generativen Phrasenstrukturmodell), nicht aber die Partikel, bleibt diese in Sprachen wie DeutschDeutsch stets IN SITU.3Verbpartikel Aus diesem Grund sind Satzpaare wie die folgenden auch nicht derivationell auf einander zu beziehen. In (32a) ist die RICHTUNG des Laufens erfragt, in (32b) das ZIEL des Hinlaufens. Nur auf die Frage in (32a) ist also ein Richtungsadverbial wie westwärts eine mögliche Antwort. Ähnliches ergibt sich aus dem Datum in (32c): Hinlaufen erlaubt keine direktionale Interpretation.
| (32) | a. | [CPWohini [C’ laufenv [sie denn ei [V° ev] ] ] ] ? – Westwärts. | (direktional) |
| b. | [CPWoi [C’ laufenv [sie denn ei [V° hin ev] ] ] ] ? – *Westwärts/ ✔nach Westen. | (resultativ) | |
| Sie sind *nach Westen/ ✔zum Berg hingelaufen. |
Nachdem nun dafür plädiert wurde, dass V-Ptkn keiner Hybridkategorie zwischen syntaktischen Phrasen und Köpfen zugeordnet werden müssen, wende ich mich der Frage der scheinbaren Unterspezifiziertheit hinsichtlich des Status als Kopf im V-Komplex oder als Wortglied einer lexikalischen Bildung zu. Zunächst wiederhole ich einige Argumente von Stiebels/Wunderlich (1994). Im Anschluss daran diskutiere ich die Nominalisierung von Ptk-V mit komm- und gelange schließlich zu einer Erklärung, die ohne die lexikalische Bildung von Ptk-V auskommt.