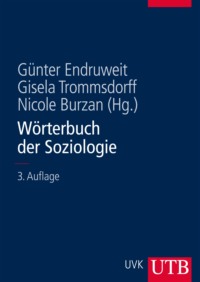Kitabı oku: «Wörterbuch der Soziologie», sayfa 18
Zur Zukunft der Familie
Gerade in der allgemeinen Soziologie wird die Organisation privater Lebensformen häufig als Beispiel für die Folgen unterschiedlichster allgemeiner Entwicklungen wie der Urbanisierung, Modernisierung oder Differenzierung herangezogen. Je nach theoretischer und teilweise auch ideologischer Ausrichtung wird dann über die Krise oder teilweise sogar das Ende der Familie spekuliert. Wenn man seinen Blick von der kurzfristigen Veränderung einzelner demographischer Kennziffern abwendet und sowohl kulturell wie historisch seinen Blickwinkel erweitert, so kann bei aller Veränderung der konkreten Organisation familialen und privaten Lebens festgehalten werden, dass sowohl normativ wie auch konkret derartige partnerschaftliche und familiale Lebensformen ihre Bedeutung nicht verloren haben.
Literatur
Becker, Gary S., 1981: A Treatise on the Family, Cambridge/ London. – Bengtson, Vern L., 2001: Beyond the Nuclear Family: The Increasing Importance of Multigenerational Bonds; in: Journal of Marriage and the Family 63, 1–16. – Berger, Peter L., Kellner, Hansfried, 1965: Die Ehe und die Konstruktion der Wirklichkeit; in: Soziale Welt 16, 220–235. – Gestrich, Andreas et al., 2003: Geschichte der Familie, Stuttgart. – Hill, Paul B.; Kopp, Johannes, 2006: Familiensoziologie, 4. Aufl., Wiesbaden. – Kertzer, David I.; Barbagli, Marzio (Hg.), 2001: Family Life in Early Modern Times, 1500–1789. New Haven/London. – Kopp, Johannes et al., 2010: Verliebt, verlobt, verheiratet. Institutionalisierungsprozesse in Partnerschaften, Wiesbaden. – Straus, Murray A.; Gelles, Richard J. (eds.), 1990: Physical Violence in American Families. Risk Factors and Adaptations to Violence [124]in 8145 Families, New Brunswick, NJ. – Treas, Judith; Drobnic, Sonja, 2010: Dividing the Domestic. Palo Alto. – White, James M., 2005: Advancing family theories, Thousand Oaks.
Johannes Kopp
Feldforschung
Feldforschung (engl. field research) ist ein Datenerhebungsansatz, der in der Ethnologie und Anthropologie entwickelt wurde und dort immer noch vorwiegend benutzt wird. Seit einigen Jahrzehnten ist er auch in der Soziologie und der Psychologie übernommen worden.
Methodischer Ansatz
Feldforschung muss im Gegensatz zur Laborforschung gesehen werden, die als Begriff aber kaum benutzt wird. Feldforschung bedeutet dann, dass die Daten in der natürlichen Umgebung der Untersuchungspersonen erhoben werden und nicht in einer Umgebung, in die die Untersuchungspersonen nur zum Zweck der Untersuchung kommen. Ein Extrem an Laborforschung sind etwa Untersuchungen mancher empirischer Ökonomen zum lnvestitionsverhalten, bei denen man Versuchspersonen in einen Universitätsraum oder in einen gemieteten Wirtshaussaal einlädt, damit sie dort, durch Sichtblenden getrennt, mit Spielgeld Investitionsentscheidungen in verschiedenen angenommenen Konjunktursituationen fällen.
Demgegenüber sollen in der Feldforschung die Daten in der alltäglichen Umgebung der Versuchspersonen erhoben werden, weil dort alle die Faktoren auf die Versuchsperson einwirken, die auch außerhalb der Forschungssituation auf sie wirken. Am deutlichsten wird der Gegensatz beim Experiment, wo die Unterscheidung von Feld- und Laborexperiment auch gängiger Sprachgebrauch ist. lm Gegensatz zum eben skizzierten Laborexperiment zum lnvestitionsverhalten würde man in einem Feldexperiment beispielsweise Handwerkern aus verschiedenen Branchen echtes Geld geben, um zu sehen, wie sich die unterschiedliche Konjunktur der Branchen auf die Risikobereitschaft beim Investieren auswirkt.
Entsprechend dem Beginn der Feldforschung in der Ethnologie ist einer ihrer Hauptzwecke ein Vorteil für den Forscher: Er erhält Kenntnis vom sozialen (und natürlichen) Umfeld seines Forschungsgegenstandes und vermag ihn erst dadurch zutreffend zu deuten. Ethnologie ist ein interkulturelles Vorhaben. Forscher aus einer Kultur forschen über eine andere, für sie fremde Kultur. Selbst wenn sie die Sprache der beforschten Kultur fließend beherrschen sollten, kennen sie noch nicht die Bedeutung von Gesten, Traditionen, die Wirkung von Ängsten, religiösen Normen, die Rücksicht auf Bräuche, Loyalitäten usw. und geraten so in die Gefahr von Ethnozentrismus bei der Deutung ihrer Ergebnisse. Wer etwa als mitteleuropäischer Forscher nicht weiß, dass in manchen Kulturen ein deutliches Nein auf eine Frage eine ungezogene Unhöflichkeit ist und deshalb durch zurückhaltende Zustimmung ersetzt wird, der würde sich wundern, dass er auf die Frage, ob jemand bereit wäre, ehrenamtlich in einer Hilfsorganisation mitzuarbeiten, sehr oft scheinbare Bereitwilligkeit findet in Antworten wie »Wenn mich jemand fragte und ich hätte gerade Zeit übrig, wäre ich grundsätzlich sicherlich interessiert daran«, die in Wirklichkeit aber eine Verneinung bedeutet. In solchen Situationen ist die langfristige teilnehmende Beobachtung ein methodisch angezeigter Ausweg. Dabei ist aber eine große methodische Schwierigkeit, dass der Beobachter allein durch seine Teilnahme schon das Feld verändert. Das kann sich allerdings im Laufe der Zeit durch Gewöhnung des personalen Umfeldes ändern; so wurde ein Forscher, der in der Rolle des Protokollanten an den Sitzungen eines Betriebsrates teilnahm, nach Wochen stillen Mitschreibens gefragt, warum er sich aus allem heraushalte und nie seine Meinung sage, wie es sich für ein Mitglied des Betriebsrates gehöre. Eine methodisch ziemlich unproblematische, aber in ihrer Validität sehr begrenzte Datensammlungstechnik für Feldforschung ist das Informantengespräch oder-interview. Elemente von Feldforschung werden auch bei der mündlichen Befragung benutzt, wenn diese in einer Umgebung durchgeführt wird, die dem Befragungsthema entspricht, also eine Befragung zur Arbeit am Arbeitsplatz, zu Erziehungszielen am Wohnzimmer- oder ggf. am Küchentisch usw. Das soll die Forderung nach »Einheitlichkeit der (Daten-)Erhebungssituation« verwirklichen, die man bei der schriftlichen Befragung gar nicht erst erheben kann. Die Begriffe Feldphase und Feldarbeit haben nichts mit der Feldforschung zu tun. Sie bezeichnen die Datenerhebung außerhalb des Arbeitszimmers auch bei jeder Laborforschung.
[125]Vor- und Nachteile
Am geschilderten Experimentbeispiel wird deutlich: lm Laborexperiment können wir die uns hier interessierende unabhängige Untersuchungsvariable, das lnvestitionsverhalten unter verschiedenen Konjunktursituationen, schön eindeutig messen, weil alle »Störvariablen« ausgeschaltet werden können. Wir können aber die Ergebnisse nicht als Entwicklungsprognose für die Wirklichkeit verwenden, weil dort die Störvariablen nicht ausgeschaltet werden können. lm Feldexperiment haben wir diese Störvariablen (z. B. Familiensituation, Gesundheitszustand) enthalten, können aber ihren jeweiligen Anteil an der lnvestitionsentscheidung nicht bestimmen. Ein Nachteil der Feldforschung ist – neben den viel höheren Kosten und der längeren Dauer – gegenüber der Laborforschung die Gefahr, dass Forscher sich mit ihren Objekten (über-)identifizieren (»going native«, wie die Ethnologen sagen) und so das Qualitätsmerkmal der Objektivität verletzen. Repräsentativität kann in der Feldforschung nicht erreicht, nicht einmal angestrebt werden. Sie eignet sich daher – das aber hervorragend – zur Einzelfallstudie, zur Hypothesenfindung und auch überhaupt zur Darstellung des Bühnenbildes für folgende methodisch strengere Untersuchungen. Die externe Validität der Feldforschung ist sehr hoch. Feldforschung ist also weitgehend deskriptiv und qualitativ. Sie wird daher oft im Vorlauf zu quantitativen Untersuchungen durchgeführt. Verbindungen zur soziologischen Theorie bestehen u. a. darin, dass die Feldforschung manche Überlegungen Max Webers zur Verstehenden Soziologie aufgegriffen hat. Andererseits hat sich der Symbolische lnteraktionismus Gedanken der Feldforschung zur Grundlage gemacht; in dieser Beziehung war die Feldforschung wohl fruchtbarer als alle quantitativen Methoden.
Beispiele für Feldforschung
Zu den einflussreichsten Werken der Feldforschung gehören die Untersuchungen von A. R. Radcliffe-Brown (The Andaman lslanders. 1922), B. Malinowski (Argonauts of the Western Pacific, 1922) und Feldforschung Boas mit seinen Forschungen über die Eskimos (ab 1886) und die lndianer-Studien seiner Schüler. Alle drei waren Mitbegründer der Ethnologie, die beiden Ersten waren ihrerseits beeinflusst von dem Soziologen Emile Durkheim. Die Soziologie nahm ihre Anregungen für Feldforschung vor allem von diesen Arbeiten auf, nicht zuletzt wegen der methodologischen Einleitung von Malinowski. Ebenfalls ethnologisch waren die Feldforschungen, die M. Mead ab 1931 in Neuguinea durchführte und die viele methodologische Diskussionen auslösten. Vor diesen Anstößen aus dem lndischen bzw. Pazifischen Ozean gab es eigentlich schon geeignete Anregungen aus Europa, so etwa von W. H. von Riehl und C. Booth.
Aber der erste Autor war Schriftsteller, Journalist, Theater- und Museumsdirektor, und der Zweite war Geschäftsmann und Sozialpolitiker, und ihre Werke waren weniger wissenschaftlich als sozialpolitisch ausgerichtet. Bahnbrechend für die moderne soziologische Feldforschung war die »Chicagoer Schule« in den USA. Zugleich mit der Begründung der Stadtsoziologie wurden dort Subkulturen erforscht. Als Beispiele sind zu nennen: W. I. Thomas: The Polish Peasant in Europe and America (1918–1922); The Unadjusted Girl (1923); R. E. Park: The Press and lts Control (1922); L. Wirth: The Ghetto (1922); P. G. Cressey: The Taxi-Dance Hall (1932). Hier entstand auch die Verbindung zum Symbolischen lnteraktionismus. Eine ebenfalls viele Folgestudien anregende Feldforschung unternahm W. F. Whyte, der vier Jahre unter Jugendlichen in einem italienischen Stadtteil von Boston zubrachte und die Ergebnisse 1943 im Buch »Street Corner Society« veröffentlichte. Auch hier ist der methodologische Anhang noch heute interessant. lm deutschsprachigen Raum war die Marienthal-Studie von M. Jahoda, P. Lazarsfeld und H. Zeisel ein Pionier der Feldforschung. Diese psychologisch-soziologische Untersuchung aus einer Zeit, als die beiden Fächer noch nicht so säuberlich geschieden waren, beschreibt das Leben von einzelnen Menschen und Familien in einem niederösterreichischen Dorf, nachdem der beherrschende Betrieb geschlossen worden war und praktisch alle Bewohner arbeitslos waren. Um einen Eindruck von der Vielfalt der Feldforschung zu erhalten, seien hier die Datenquellen aufgezählt: Karteikarten für jeden der 1.486 Einwohner mit allen erreichbaren Daten; Lebensgeschichten von 62 Personen; Zeitverwendungsbögen; Anzeigen und Beschwerden; Schulaufsätze, u. a. über Berufswünsche; Preisausschreiben für Jugendliche über Zukunftsvorstellungen; lnventare der Mahlzeiten in 40 Familien; Protokolle über Weihnachtsgeschenke, Gesprächsthemen in Läden, Umsätze in Geschäften[126] und der Gastwirtschaft usw.; Statistiken über den Konsumverein, Bibliotheksentleihungen, Vereinsmitgliedschaften usw.; historische Angaben über Fabrik, Gewerkschaften, Parteien usw.; Bevölkerungsstatistik; Erkundungen durch teilnehmende Beobachtung in Parteien, Zuschneidekurs, Arztsprechstunden, Mädchenturnkurs und Erziehungsberatung. Aus der neueren Feldforschung sind vor allem die zahlreichen Studien von R. Girtler über die verschiedensten Subkulturen zu nennen, von Prostituierten über Polizeibeamte, Stadtstreicher, Wilderer bis zu den Nachfahren des ehemaligen österreichischen Adels. Für die französische Soziologie wurden besonders die Feldforschungen von P. Bourdieu in Algerien wichtig, sowohl methodisch wie theoretisch.
Literatur
Booth, Charles, 1891–1903: Life and Labour of the People of London, 17 Bde., London. – Girtler, Roland, 2001: Methoden der Feldforschung, Stuttgart. – Jahoda, Marie et al., 1960: Die Arbeitslosen von Marienthal, Allensbach/ Bonn. – Riehl, Wilhelm H. von, 1851–1869: Naturgeschichte des Volkes als Grundlage einer deutschen Socialpolitik, 4 Bde., Stuttgart. – Sutterlüty, Ferdinand; lmbusch, Peter (Hg.), 2008: Abenteuer Feldforschung. Soziologen erzählen, Frankfurt a. M. – Whyte, William F., 1943: The Street Corner Society, Chicago (dt. 1996).
Günter Endruweit
Feldtheorie
Die sozialwissenschaftliche Entwicklung der Feldtheorie (engl. field theory) basiert auf der Übertragung der physikalischen Entdeckungen des elektromagnetischen Feldes und des Gravitationsfeldes. Diese natürlichen Felder sind Kraftfelder, innerhalb derer Objekte ihre Positionen durch auf sie einwirkende Kräfte erhalten. Bereits seit Galilei wird die Erde nicht mehr als das Zentrum des Universums verstanden, sondern erhält nach Newton eine relative Position innerhalb eines Systems von Planeten. Die Position wird damit durch die Gravitationskräfte der Planeten bestimmt. Übertragen auf den sozialwissenschaftlichen Bereich bedeutet dies, dass die soziale Position eines Menschen nicht auf das Individuum selbst zurückgeführt werden kann, sondern durch ein soziales bzw. gesellschaftliches Kraftfeld bestimmt wird.
Der erste sozialwissenschaftliche Feldbegriff geht auf Kurt Lewin zurück, der ab den 1920er Jahren für seine Sozialpsychologie einen mikrosoziologischen Feldbegriff entwarf. Lewins Ziel bestand darin, mithilfe der Konzeption eines psychologischen Feldes das Verhalten von einzelnen Menschen zu erklären. Demzufolge sind Menschen von einem Kraftfeld umgeben, auf das ihr Verhalten zurückgeführt werden muss (Lewin 1982a: 159). Das den Menschen umgebende Feld besteht für Lewin aus zwei Teilen: der psychologischen Umwelt, also dem Lebensraum oder der sozialen Welt, und der psychologischen Innenperspektive der Person, also ihren inneren Motiven zu einem bestimmten Verhalten, das sich aus den Erfahrungen der Vergangenheit und den Erwartungen an die Zukunft ergibt (Lewin 1982d: 196 ff., 1982b: 375 ff.). Somit bilden die Person und ihre Umwelt zusammen die beiden Teile eines dynamischen psychologischen Feldes (Lewin 1982c: 294, 1982d: 207).
Die Struktur dieses Feldes betrachtet Lewin als dynamisch, weil es aus einer Reihe von gerichteten Kräften besteht, den Vektoren (Lewin 1982e: 68, Vester 2002: 62). Das Verhalten einer Person ergibt sich aus allen zu einem bestimmten Zeitpunkt wirkenden Kräften des psychologischen Feldes. Lewin spricht dabei von einer Konstellation oder Topologie (Lohr 1963: 24 f.). Mit seiner Konzeption des psychologischen Feldes intendiert Lewin zwar vorrangig die Beschreibung der psychologischen Innenperspektive, jedoch denkt er dabei explizit auch das äußere soziale Umfeld einer Person mit (Lewin 1982a: 160, 1982d: 187 ff.).
Unter anderem auf der Basis von Lewins Feldkonzeption entwickelte Pierre Bourdieu einen makrosoziologischen Feldbegriff (Bourdieu 1993, 1996). Die theoretische Grundkonzeption des Feldes entwickelte Bourdieu in Auseinandersetzung mit Max Webers Religionssoziologie (Weber 1972: 245–381, Bourdieu 1986: 156). Weber analysierte darin, dass der Prozess zur Produktion, Reproduktion und Verbreitung religiöser Güter von der sozioökonomischen Entwicklung der Gesellschaft relativ unabhängig verlief, weshalb er den Bereich der Religion als »relativ autonomes religiöses Feld« veranschaulichte (Bourdieu 2000: 53). Bourdieu analysierte im Rahmen seiner Feldtheorie eine Reihe von sozialen Bereichen als Felder. Neben dem religiösen Feld widmete [127]er dem wissenschaftlichen (Bourdieu 1988, 1998) dem künstlerischen (1999) und dem politischen Feld (2001) jeweils eigene Untersuchungen.
Zudem übernahm auch Bourdieu für seine Feldkonzeption das physikalische Paradigma, also die Vorstellung des Feldes als Kräftefeld: Entsprechend der Feststellung in der Physik, »dass die Sterne nicht auf einem Gerüst hängen, sondern miteinander ein bewegtes Energiefeld bilden«, ist ein soziales Feld bei Bourdieu nicht einfach ein feststehendes, hierarchisch geordnetes »Klettergerüst« der sozialen Positionen, sondern ein Kräftefeld, das erst durch den Kampf der sozialen Akteur/innen untereinander zustande kommt (Vester 2002: 63). Soziale Felder erhalten ihre Struktur also erst durch konkurrierende Positionen von Akteur/innen (Bourdieu 1993: 107). Eine Position auf einem Feld ergibt sich dem zufolge in Relation bzw. Abgrenzung zu anderen Positionen. Damit ist ein Feld »ein Netz oder eine Konfiguration von objektiven Relationen zwischen Positionen« (Bourdieu 1996: 127). Soziale Felder sind folglich Arenen, in denen Konkurrent/innen um die Bewahrung und Veränderung der Struktur des jeweiligen Kräftefeldes kämpfen: »Das generierende und vereinheitlichende Prinzip dieses ›Systems‹ ist der Kampf selbst.« (Bourdieu 1999: 368). Zwar nehmen die Kämpfe auf den unterschiedlichen Feldern unterschiedliche Formen an, jedoch besteht die Grundstruktur immer in der feldinternen Auseinandersetzungen zwischen den auf dem Feld Etablierten, den Herrschenden, und den Anwärter/innen auf die Herrschaft (Bourdieu 1993: 107). Die etablierten Akteur/innen mit den höchsten Positionen neigen unter den gegebenen Kräfteverhältnissen zum Konservativismus, d. h. zu Erhaltungsstrategien, während die Akteur/innen mit niedrigen Positionen zu feldinternen Revolutionen und Umsturzstrategien tendieren (Schumacher 2011: 140).
Literatur
Bourdieu, Pierre, 1986: Der Kampf um die symbolische Ordnung. Pierre Bourdieu im Gespräch mit A. Honneth, H. Kocyba und B. Schwibs; in: Ästhetik und Kommunikation 62/16. – Ders., 1988: Homo academicus. Frankfurt a. M. – Ders., 1992: Rede und Antwort. Frankfurt a. M. – Ders., 1993: Über einige Eigenschaften von Feldern; in: ders. (Hg.): Soziologische Fragen, Frankfurt a. M., 107–114. – Ders., 1996: Die Logik der Felder; in: ders; Wacquant, Loïc J. D (Hg.): Reflexive Anthropologie, Frankfurt a. M., 124–147. – Ders., 1998: Vom Gebrauch der Wissenschaft. Für eine klinische Soziologie des wissenschaftlichen Feldes, Konstanz. – Ders., 1999: Die Regeln der Kunst. Genese und Struktur des literarischen Feldes. Frankfurt a. M. – Ders., 2000: Das religiöse Feld. Texte zur Ökonomie des Heilsgeschehens, Konstanz. – Ders., 2001: Das politische Feld. Zur Kritik der politischen Vernunft, Konstanz. – Lewin, Kurt, 1982a: Feldtheorie des Lernens; in: Graumann, Carl-Friedrich (Hg.): Feldtheorie, Bern/Stuttgart, 157–185. – Lewin, Kurt, 1982b: Verhalten und Entwicklung als Funktion der Gesamtsituation; in: Weinert, Franz E.; Gundlach, Horst (Hg.): Psychologie der Entwicklung und Erziehung, Bern/ Stuttgart, 375–448. – Lewin, Kurt, 1982c: Psychologische Ökologie; in: Graumann (Hg.) [s. o.], 291–312. – Lewin, Kurt, 1982d: Feldtheorie und Experiment in der Sozialpsychologie; in: Graumann (Hg.) [s. o.], 187–213. – Lewin, Kurt (1982e): Formalisierung und Fortschritt in der Psychologie; in: Graumann (Hg.) [s. o.], 41–72. – Lohr, Winfried, 1963: Einführung zur deutschsprachigen Ausgabe; in: Cartwright, Dorwin (Hg.): Feldtheorie in den Sozialwissenschaften. Ausgewählte theoretische Schriften, Bern/Stuttgart, 15–42. – Schumacher, Florian, 2011: Bourdieus Kunstsoziologie, Konstanz. – Vester, Michael, 2002: Das relationale Paradigma und die politische Soziologie sozialer Klassen; in: Bittlingmayer, Uwe H. et al. (Hg.): Theorie als Kampf? Zur politischen Soziologie Pierre Bourdieus, Opladen, 61–121. – Weber, Max, 1972: Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen (1921).
Florian Schumacher
Forschung
Forschung (engl. research) ist in den beiden Hälften der empirischen Sozialwissenschaften, der Theorie und der Empirie, die Tätigkeit des Wissenschaftlers im Bereich der Empirie, d. h. die Tätigkeit, durch die er mit objektspezifischen Methoden in der Wirklichkeit Erkenntnisse über sein Objekt sammelt oder auch die Suche »nach Erkenntnissen durch systemische Auswertung von Erfahrungen (›empirisch‹ aus dem Griechischen: ›auf Erfahrung beruhend‹)« (Bortz/Döring, 5).
Damit sind quantitative und qualitative Methoden gleichermaßen gemeint, aber stets grundsätzlich Methoden der Feldforschung, auch in deren Modifikation als Laborforschung, weil es auch in dieser um Erforschung am Erkenntnisobjekt geht, nur eben in einer künstlichen Situation. Ausgeschlossen ist damit die »Schreibtischforschung« (desk research im Gegensatz zu field research), die nur ein Irrtum erregender Ausdruck für Theoriearbeit ist. Diese ist entweder vor der Forschung angesiedelt, wenn es um[128] erste hypothetische Erklärungen der Forschungsfragen geht, oder nach der Forschung, wenn deren Ergebnisse für eine revidierende, nun validere Fassung der Theorie ausgewertet werden; dieser zweite Bereich ist in der Soziologie allerdings bisher völlig unterentwickelt. Damit stehen Theoriekonstruktion und Forschung in den empirischen Sozialwissenschaften in einem untrennbaren Zusammenhang, auch wenn dieser im Wissenschaftsalltag längst nicht immer beachtet wird (Babbie, 35–54; Endruweit, 66–69, 78, 125–128), u. a. auch dadurch nicht, dass Theorien i. d. R. nicht »überprüfungsorientiert« formuliert werden.
Der Grundsatz von Forschung als Feldforschung wird nur vermeintlich durchbrochen von Datensammlungsverfahren, die in der Tat am Schreibtisch, jetzt eher am Computertisch angewendet werden, so etwa bei der Inhaltsanalyse. Hierbei ist beispielsweise das eigentliche Forschungsobjekt die Sozialisationspraxis der Adelsfamilien im 17. Jh., die »im Feld« nicht mehr beobachtet oder durch Befragung erforscht werden kann, sondern die z. B. nur aus autobiografischem Material als der Wirklichkeit noch nächster Quelle ermittelt werden kann, gewissermaßen als Interviewersatz, also indirekte Feldforschung.
Über die Unterschiede zwischen qualitativer und quantitativer Forschung gibt es viele idealtypische Aussagen (vgl. z. B. die Tabellen bei Lamnek, 244, und Bortz/Döring, 299–302), die alle einige sehr fragwürdige Elemente enthalten. Ob man quantitativ oder qualitativ vorgeht, hängt nicht zuletzt davon ab, was man einerseits an Daten hat oder haben kann und was man andererseits mit den Daten aussagen will. Wenn Totalerhebungen oder Stichproben unmöglich sind, ist auch quantitative Forschung unmöglich. Wenn man dagegen, wie so oft, aus keiner Theorie eine Hypothese für das ins Auge gefasste Forschungsthema finden kann, ist ein qualitatives Interview manchmal weit aufschlussreicher als jede quantitative Explorationsstudie. Allerdings darf in den Sozialwissenschaften nie vom Teil auf das Ganze geschlossen werden (ebenso nicht vom Ganzen auf ein Teil), weil sie keine den Naturgesetzen entsprechende Erkenntnisse haben. Aber nicht nur zur Hypothesenfindung ist qualitative Forschung brauchbar, sondern auch zur Hypothesenprüfung, wenn es sich um Es-gibt-Hypothesen handelt (Beispiel: Es gibt nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung durch die Vergabe von Mikrokrediten). Je-desto-Hypothesen sind dagegen immer nur mit quantitativer Forschung zu überprüfen.
Das hier beschriebene Konzept von Forschung ist am Kritischen Rationalismus orientiert. Daneben gibt es noch andere Auffassungen, etwa in der Kritischen Theorie oder in der marxistischen Soziologie (dazu u. a. Friedrichs, 18–32; Aßmann/Stolberg, 30–40), die aber in der tatsächlichen Forschung schon immer eine geringe Bedeutung hatten und jetzt eine fast nur noch Historische.
Literatur
Aßmann, Georg; Stollberg, Rudhart (Hg.), 1979: Grundlagen der marxistisch-leninistischen Soziologie, Berlin. – Babbie, Earl, 1989: The Practice of Social Research, 5. ed., Belmont. – Bortz, Jürgen; Döring, Nicola, 2006: Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozialwissenschaftler, 4. Aufl., Heidelberg. – Endruweit, Günter, 1997: Beiträge zur Soziologie, Bd. I, Kiel. – Friedrichs, Jürgen, 1990: Methoden empirischer Sozialforschung, 14. Aufl., Opladen. – Lamnek, Siegfried, 1995: Qualitative Sozialforschung, Bd. 1, 3. Aufl., Weinheim.
Günter Endruweit
Freizeit
Freizeit im sozialen Wandel
Freizeit (engl. leisure time, free time) im 21. Jh. hat eine andere Qualität als in den Nachkriegszeiten der fünfziger und sechziger Jahre oder den Wohlstandszeiten der siebziger bis neunziger Jahre: Steigende Lebenserwartung auf der einen und sinkende Realeinkommen auf der anderen Seite lassen erwerbsfreie Lebensphasen in einem ganz anderen Licht erscheinen. Lebensstandardsicherung und soziale Ungleichheiten, Gesundheitserhaltung sowie neue Sinnorientierungen des Lebens jenseits von Konto und Karriere machen den ehemaligen »Wohlstandsfaktor Freizeit« zu einer gleichermaßen ökonomischen wie sozialen Frage: Wie kann die persönliche und gesellschaftliche Lebensqualität auch in politisch und wirtschaftlich schwierigen Krisenzeiten erhalten und nachhaltig gesichert werden? Frei verfügbare Zeit- und Lebensabschnitte werden immer mehr zur Investition in lebenslanges Lernen, in Wohlfühlkonzepte, in Familien- und Nachbarschaftshilfen, aber auch in Unterhaltungs- und Entspannungsprogramme [129]genutzt. Aus dem »Frei von« bezahlter Arbeit wird zunehmend ein »Frei für« eine lebenswerte Zukunft. Das »spart« Geld, aber »kostet« Lebenszeit.
Freizeitbegriff
Das Freizeitverständnis hat sich grundlegend gewandelt. Quantitativ und qualitativ unterscheidet sich die Freizeit heute von früheren Freizeitformen. Auch gegenwärtig findet Erholung von der Arbeit in der Freizeit statt, aber die Freizeit ist nicht mehr nur – wie in den fünfziger Jahren – Erholungszeit. Für die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung hat die Freizeit einen eigenständigen Wert bekommen. So vertritt die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung die Auffassung, dass Freizeit in erster Linie eine Zeit ist, in der man tun und lassen kann, was einem Spaß und Freude macht. Aus einem arbeitsabhängigen Zeitbegriff, der Freizeit negativ als Abwesenheit von Arbeit definierte, hat sich ein positives Freizeitverständnis entwickelt: Freizeit ist eine Zeit, in der man für etwas frei ist.
Freizeitverhalten
Nur auf den ersten Blick verändert sich im Freizeitverhalten nichts. Doch im Zeitvergleich der letzten 50 Jahre hat es fast erdrutschartige Veränderungen gegeben. Die Lieblingsbeschäftigung »Aus dem Fenster sehen« wurde durch das »Fernsehen« ersetzt und »Telefonieren« macht regelmäßige »Verwandtenbesuche« weitgehend entbehrlich. Fest behauptet hat sich dagegen das »Radiohören« als wichtiges Begleitmedium des Freizeitalltags.
Die Wirklichkeit des Freizeitverhaltens der Deutschen vermittelt auf den ersten Blick ein ernüchterndes Bild: Die reale Freizeitqualität spielt sich zwischen Medien- und Erlebniskonsum ab. Und gesellschaftlich hoch bewertete Kulturaktivitäten in der Freizeit wie Opern-, Konzert- und Theaterbesuche, Rock-, Pop- und Jazzkonzertbesuche oder Museums- und Kunstausstellungsbesuche rangieren in der Beliebtheitsskala am unteren Ende. Der Medienkonsum ›frisst‹ den größten Teil der Freizeit. Im Westen wie im Osten Deutschlands widmen sich die Bundesbürger am meisten dem Medienkonsum.
Tourismus und Erlebnismobilität
»Travel« und »Travail«, Reisen und Arbeiten, haben die gleiche Wortwurzel und deuten auf das gleiche Phänomen hin: Der Mensch kann auf Dauer nicht untätig in seinen eigenen vier Wänden verweilen. Noch nie in der Geschichte des modernen Tourismus reisten so viele so viel. Reisen gilt als die populärste Form von Glück. Nach dem Bahn-, Auto- und Flugtourismus steht die vierte Welle der Demokratisierung des Reisens unmittelbar bevor: Trotz globaler Finanz- und Wirtschaftskrisen expandiert der Kreuzfahrttourismus – und die Wachstums-Ära der Billigflieger geht bald zu Ende.
Literatur
Opaschowski, Horst W., 2008: Einführung in die Freizeitwissenschaft, 5. Aufl., Wiesbaden. – Carius, Florian; Gernig, Björn, 2010: Was ist Freizeitwissenschaft?, Aachen.
Horst W. Opaschowski
Fremdenfeindlichkeit
Definition
Fremdenfeindlichkeit (griech. Xenophobie, engl. xenophobia) bezeichnet ablehnende Einstellungen und aggressive Verhaltensweisen von Personen, die zu einer Gemeinschaft (»ingroup«, »Wir-Gruppe«) gehören, gegenüber Mitgliedern anderer Gemeinschaften (»outgroup«, »Sie-Gruppe«). Dabei kann die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft real oder vorgestellt sein. Als fremdenfeindlich kann auch jede Weigerung ausgelegt werden, die Mitglieder der anderen Gemeinschaft als gleichwertig anzuerkennen und ihnen die allgemeinen Menschenrechte zu gewähren. Bei der Fremdenfeindlichkeit handelt es sich um eine komplexe Wertorientierung, die einerseits die eigenen kulturellen Praktiken, Werte und Normen als positiv und verbindlich definiert und andererseits die Fremden als bedrohlich und feindlich stigmatisiert. Voraussetzung für die Fremdenfeindlichkeit ist, dass die Zugehörigkeitsmerkmale, z. B. Religionszugehörigkeit, Nationalität, Rassenzugehörigkeit, Sprache, Kultur, regionale Zugehörigkeit etc. von einem Kollektiv negativ markiert und als fremd empfunden werden. Grundlage der Fremdenfeindlichkeit ist der sog. »Ethnozentrismus«, d. h. die[130] empfundene Überlegenheit der eigenen kulturellen Werte, Lebensweise, Weltanschauung, Religion, Rasse, Nation, Region und ethnischen Zugehörigkeit. Die Fremdenfeindlichkeit kann gesetzlich verankert und staatlich legitimiert werden, wie z. B. in der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland. In der Fachliteratur wird zwischen latenter (versteckter) und manifester (offener) Fremdenfeindlichkeit unterschieden.
Entwicklung des Begriffs
Die Fremdenfeindlichkeit ist ein altes Phänomen. Dieses beruht auf der Erfassung der Welt durch binäre Kategorien, z. B. »gut« und »böse«, »groß« und »klein«, »weiß« und »schwarz«, »unsere« und »fremde« etc. Ursprünglich bedeutete das Wort »Xenophobie« »Angst vor den Fremden«. In der Fachliteratur wird die Bedeutung auf das komplette Spektrum der negativen Einstellungen und Handlungen ausgeweitet. Die ursprüngliche Anwendung des Begriffs fokussierte auf Gruppen und Personen, die außerhalb eines Territorialstaates lebten – die »Ausländer«. Fremdenfeindlichkeit gehört, historisch gesehen, zu den wichtigsten Konflikt- und Kriegsursachen.