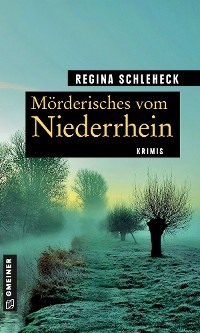Kitabı oku: «Mörderisches vom Niederrhein», sayfa 2
Unterwegs schwärmte uns Manni weiter von seinem Lieferwagen vor. Mit Pilotassistent, Einparkassistent, Spurhalteassistent und allem möglichen Assi-Schrumms mehr.
»Wenn der das meiste doch jetzt von selbst macht«, sagte ich, »dann dürfte das mit dem Alkohol am Steuer ja bald kein Problem mehr sein.«
Da widersprach er heftig. Ich glaube ja, dem hatten sie bei dieser MPU gehörig das Gehirn gewaschen.
Beim Essen wurde noch ein bisschen gefachsimpelt. Aber eigentlich waren alle gut drauf. Irgendwo denkt man ja schon manchmal selbst, dass es nicht immer so nett ist, wie man mit anderen umgeht. Also mit solchen. Also speziell mit Manni. Ja, es beschäftigt mich immer noch. Warum? Warum nerven einen Leute dermaßen, die doch einfach nur ein bisschen blöd sind. Und aufdringlich. So ein Typ Mensch, der sich an andere ranwanzt, obwohl die nur ihre Ruhe haben wollen. Der auf das Häuschen seiner Tante scharf ist … Wer hat schon eine Erbtante? Und kriegt trotzdem nichts gebacken im Leben. Versager durch und durch. Und ausgerechnet so jemandem schmeißen die alles nach. Jemand anderes mit einem Lieferjob wäre bei einem Fahrverbot sofort hochkant rausgeflogen. Und der? Kriegt die neue Modellreihe unter den Arsch. Okay, das mit dem unbezahlten Urlaub … ändert nichts am Armleuchter.
Irgendwann fiel das Stichwort »Hexerei«. Vielleicht war es das, was das Ganze wieder – auf Neudeutsch – getriggert hat. »Überhaupt keine Hexerei dabei«, sagte Manni. »Nur Technik, alles Algorithmen.« So ein selbstfahrendes Auto wäre tausendmal rationaler als ein menschlicher Fahrer. Der wäre unaufmerksam, unbeherrscht, würde sich über- und Situationen falsch einschätzen …
Ich bin mir sicher, diese Sprüche sind jedem von uns an die Nieren gegangen. Wir sind alle Eins-a-Fahrer. Beherrschen das Auto und kritische Situationen aus dem Effeff und haben, was früher mal »siebter Sinn« hieß. Man muss ein Gespür entwickeln im Verkehr. Ich wette, man könnte ein Auto von oben bis unten vollpumpen mit Chips, und das käme niemals an uns dran. Und das ist genauso wenig Hexerei. Das ist Erfahrung, Verstand, Kombinationsgabe und Instinkt. Wenn man sich besäuft, klar, dann schaltet man das aus. »Sich betrinken« heißt nicht umsonst »hexen« hierzulande.
Ja, und Käthe hat das mit ihren Fragen immer weiter angeheizt. Ob das Auto das kann und das kann. Bis der Manni irgendwann sagte, er könne mit verbundenen Augen fahren. Sich voll auf seinen Assi verlassen. Er würde es uns beweisen. Ein Stückchen raus aus Korschenbroich, da an der L 382, dem Zubringer zur A 52, Richtung Düsseldorf, eine Strecke von vier Kilometern, also die Willicher und Korschenbroicher Straße. Wir könnten gerne in zwei Wagen vorneweg und hinterherfahren. Dann würde sein Assi – also der Abstandshalteassi – sich an dem vorausfahrenden Fahrzeug orientieren und automatisch das Tempo drosseln, was normalerweise durch den Tempomat so eingestellt wäre, wie es gerade erlaubt ist zu fahren, Landstraße halt 100 Stundenkilometer. Und der Fahrspurassi, der würde sich an den Seitenstreifen orientieren. Und er, Manni, säße mit verbundenen Augen in seinem Lieferwagen so sicher wie in Abrahams Schoß.
Na ja, und das haben wir schließlich tatsächlich gemacht. Jan und Käthe in Jans Auto vorneweg. Dahinter der Manni mit seinem tollen Töfftöff. Als Schlusslicht ich mit meinem Büschen und Ricky. An dem Weinhaus hinter der Bahntrasse haben wir am Straßenrand angehalten und nach dem Manni geguckt. Der hat aus dem Verbandskasten das große Dreieckstuch geholt und sich hinterm Steuer damit die Augen verbunden. Der Jan hat geprüft, ob der Knoten sitzt, und schon ging’s los. Ganz brav im Konvoi. Bis zu der Stelle, etwa auf der Mitte der Strecke, wo die die Asphaltdecke gerade erneuert hatten. Da gab’s halt keine Fahrbahnmarkierung. Und genau dort ist der Jan einem Feldhasen ausgewichen, das war nur ein kurzer Schlenker, die Käthe kann es bezeugen. Na, und dann haben diese blöden Assis sich ihr Teil gedacht. Jedenfalls haben wir uns das später so erklärt. Also der eine, der den Abstand zu Jans Auto einhalten wollte, hat halt auch eingeschlagen. Und weil der Jan das Steuer gleich wieder rumgerissen hat, hat der Abstandsassi gedacht: Oh, cool, Strecke frei, ich brauch gar nicht mehr zu bremsen. Und hat das Tempo aufgedreht. Der Seitenstreifenassi hat sich gedacht: Wo ist denn der Seitenstreifen? Keiner da? Also fahr ich einfach mal geradeaus. Mit 100 Stundenkilometern. Der Laster ist also volle Pulle ins Feld gerast. Über die Böschung gehoppelt und dann war da der Fluitbach. Und weil das die letzten Tage so richtig fett geregnet hatte, war darin verdammt viel Wasser. Nachdem der LKW sich einmal überschlagen hat, ist der sozusagen mit der Nase im Wasser gelandet. Wir haben natürlich ein bisschen gebraucht, ehe wir aus den Autos raus und da hingerannt waren. Im Stockdunkeln. Aber die Käthe hat uns mit der Smartphone-Taschenlampe den Weg geleuchtet. Bis zu dem LKW, kopfüber im Bach. Das komplette Fahrerhaus unter Wasser. Wir haben noch versucht, da ranzukommen. Der Jan ist echt ins Wasser gestiegen, obwohl man doch rein gar nichts sehen konnte und den Wagen nur mit schwerem Gerät hätte bergen und öffnen können. Plötzlich hat die Käthe wie am Spieß geschrien, bis der Jan ihr einen tüchtigen Schwall Wasser ins Gesicht gespritzt hat. Wir anderen haben gar kein Wort rausgekriegt vor Schreck. Wir haben uns angeguckt und schließlich hat Ricky gesagt: »Scheiße. Was erzählen wir bloß der Polizei?«
Dazu wussten wir schon gar nichts zu sagen.
Bis der Jan gemeint hat: »Wieso Polizei? Von dem Unfall hat doch keiner was mitgekriegt. Und uns hat niemand gesehen. Und dem Manni ist eh nicht mehr zu helfen.«
Und das haben wir eine Weile sacken lassen, haben uns umgeguckt, sind zu den Autos und weg.
Seitdem denke ich darüber nach, dass der Manni an dem Tag die Tour über die andere Rheinseite gefahren war. Also die Günnekant runter bis Köln, danach über die A 1 und A 59 nach Grevenbroich und weiter hoch. Das heißt, er war die Strecke von Korschenbroich nach Düsseldorf an dem Tag nicht gefahren und konnte nicht wissen, dass sie die L 283 an der Stelle neu asphaltiert hatten. Wir anderen wussten es aber. Und als der Manni uns von dem Seitenspurassistenten erzählt und die Strecke vorgeschlagen hat, da hätten wir es ihm sagen können.
Hat aber keiner.
Warum wohl?
Königswette
Wir hatten gewettet. Wer von uns es weiter über den Rhein schaffte. Natürlich wusste ich, dass es saugefährlich war. Deswegen hatte ich ja gerade gewettet – und das Beiboot organisiert. Ich wollte, dass er kapiert, was er sich da vorgenommen hatte. Immerhin war Lars, der es fuhr, nicht ganz so besoffen wie Leander, aber immer noch deutlich mehr als ich. Das wurde mir spätestens in dem Moment ziemlich übel bewusst, als ich nach kaum einem Drittel der Strecke schlappmachte und Lars das verabredete Zeichen gab: Peace, Bruder. Ein V mit dem rechten Zeige- und Mittelfinger, die ich mit letzter Kraft aus dem Wasser streckte. Der Dödel winkte fahrig zurück, grinste blöd, beugte sich über die Reling, erbrach sich und fiel seinem Verdauungsgut gleich hinterher. Der Wellengang war wohl zu viel für ihn gewesen. Immerhin schaffte er es, sich an der Bordwand festzuklammern.
Diese Strömung! Man kann sich gar nicht vorstellen, was da für Kräfte an einem ziehen! Es riss mich immer weiter weg. Ich kämpfte darum, den Kopf über Wasser zu halten. »Lars, du Arsch!«, schrie ich. Aber erstens war es sowieso für den Arsch, und zweitens machte es alles nur noch schlimmer, weil das Brüllen mich viel Kraft kostete. Was für eine idiotische Idee zu glauben, es bis ans andere Ufer zu schaffen! Für mich gab es jetzt ein einziges Ziel: in der Nähe des Bootes zu bleiben, dessen Motor ausgesetzt hatte, sodass es mitsamt seinem Bootsführer flott flussabwärts trieb. Und Leander? Als wenn ich mich in dieser Lage um den hätte kümmern können!
*
Gewettet hatten wir von klein auf. Lars und ich. Eigentlich war das Erwins Schuld. Lars lernte Erwin erst nach der Grenzöffnung kennen. Bis dahin hatte es immer geheißen: »Frag nicht.« Über die Großeltern erfuhr er immerhin, dass er ein Mitbringsel von der Abschlussfahrt seiner Mutter nach Berlin war. Zehnte Klasse. Nach einer Lehre als Verkäuferin ließ sie sich vom Abteilungsleiter schwängern, heiratete und zog bei den Großeltern aus. Der Stiefvater adoptierte Lars, und als der schon fast vergessen hatte, dass er mal unter einem anderen Namen firmiert hatte, saß ein fremder Mann am Küchentisch und seine Mutter sagte: »Gib deinem Vater die Hand.«
Erwin hatte in Ost-Berlin Schlosser gelernt, war über eine Leiharbeitsfirma an eine Duisburger Werft gekommen und holte Lars am Wochenende zu Ausflügen ab. Da Lars und ich alles zusammen machten, kam ich mit. Wir saßen auf den Rheinbuhnen, ließen flache Steine titschen, wetteten, wie oft sie auf der Wasseroberfläche auftrafen, angelten, wetteten, welcher Art und wie schwer der Fisch war, der anbiss, stromerten mit Metallsonden am Ufer und auf dem Gelände hinter der Werft herum und wetteten, sobald sie anschlugen, worum es sich handelte. Abenteuer pur.
Dabei nahm uns Erwin gleich doppelt aus: Wir verloren einen Großteil unseres Taschengelds beim Wetten. Und waren billige Arbeitskräfte: Er sammelte Metallschrott, den er vertickte. Auch der Fischfang landete komplett in seiner Kühltasche, weil es ja seine Angeln und Detektoren waren. Uns war das herzlich egal.
Am Tag nach der Abifeier klingelte es bei mir Sturm. Ich öffnete die Tür meines Einliegerappartements und bat Lars in die Küche, wo ich zwei Flaschen Alt und einen Eisbeutel aus dem Kühlschrank klaubte und mich an die Frühstücksbar lehnte.
Lars ignorierte meinen verkaterten Zustand geflissentlich. Er knallte etwas auf die Theke, das sich bei näherer Betrachtung als Sparbuch entpuppte. Jemand hatte es gelocht und mit mehreren Schnitten versehen. Ich klappte es auf und registrierte regelmäßige monatliche Eingänge über die Jahre 1990 bis ’94 von um die 500 Euro – und einen Betrag von knapp 20.000 Euro, letzte Woche abgehoben, woraufhin das Sparbuch aufgelöst worden war. Ich blätterte zurück: Erwins Name.
»Und?«, fragte ich.
Lars schnaubte. »Mein Geld. Er hat es mir immer wieder gezeigt und gesagt, er zahlt meinen Unterhalt da ein. Ich dürfte es meiner Mutter nicht verraten, der gegenüber er behauptete, er könnte nichts für mich abdrücken. Er wollte nicht, dass sie es sich unter den Nagel reißt. Mir stattdessen damit das Studium finanzieren.«
»Und jetzt?«
»Ich hab ihm wie vereinbart das Zeugnis gezeigt, und er hat mir das Sparbuch ausgehändigt. Es täte ihm leid, aber er hätte das Geld selbst dringend gebraucht.«
»Wofür?«
»Meinst du, das hätte ich gefragt?«, meinte Lars. »Der hat mich jahrelang beschissen – wie er meine Mutter beschissen hat. Und ich hab ihn gedeckt und ihm sogar dabei geholfen – du genauso!«
»Hä?«
»Überleg mal, was wir für den aus dem Boden geholt haben! Der hat das samt und sonders versilbert. Und mir erzählt, dass er es für mich anlegt!«
All die Jahre haben wir uns weiterhin getroffen. Und gesoffen. Und gewettet. Soweit es ihn selbst anging, ließ Lars sich dadurch nicht herausfordern. Er hat nie studiert. Seine Ausbildung nicht beendet. Aber auch wenn unsere Welten auseinanderdrifteten – er blieb mein bester Kumpel.
*
Genau genommen hatten wir es ja Leander zu verdanken. Er war der Hero. Der König. So hatte er sich zumindest vorgestellt: Leander König. War mit Moped und Fässchen Köpi an unserem Grillplatz vorgefahren, weil er sich just da, wo wir uns nach der Bootstour ein paar Würstchen einverleibten, sinnlos besaufen wollte. Sein großzügiges Angebot, das Fässchen mit uns zu teilen, nahmen wir – nichts Böses ahnend – an, bereuten es schon nach der ersten Runde, als er anfing, uns einen vorzuheulen von seiner Schlampe drüben in Alt-Homberg auf der anderen Rheinseite und ihrer Mischpoke. Er hatte sie geschwängert. Leider stellte sich nachher raus, dass sie ihn angelogen hatte und erst 15 war. Ihre Familie fand das gar nicht witzig. Er kriegte Haus- und Kontaktverbot, und sie sollte abtreiben. Das war zumindest der Plan der Eltern. Aber im Zeitalter von Handys und Internet konnte kein Stubenarrest verhindern, dass die beiden sich kurzschlossen. Leander machte ihr einen Heiratsantrag und danach unter Berufung auf Paragraf 1303 BGB Absatz 2 eine Eingabe beim Familiengericht auf Zustimmung, die die Einwilligung der Eltern erübrigte, sobald sie 16 würde. Am nächsten Tag war wohl ihr Geburtstag. Die ganze nichtsahnende scheinheilige Familie saß drüben im Restaurant Rheingarten und futterte sich die Wänste voll, um um Mitternacht mit dem missratenen Kind anzustoßen. Klar, dass er nicht zur Feier eingeladen war. Stattdessen soff er sich gegenüber auf der Landzunge der Ruhrmündung im Schatten der Rheinorange-Skulptur die Hucke voll und erkaufte sich unser Wohlwollen mit einer Runde nach der anderen und feurigen Ansprachen. Mit steigendem König-Pilsener-Pegel wurde er immer größenwahnsinniger. Ob wir wüssten, was sein Name bedeute? »Du bist der König!«, grölten wir im Chor. Er wehrte ab. Klar war er der König. Aber der Leander König! Leander komme von »leon«, dem Löwen, und »andros«, dem Mann. »Du bist der Löwe, Mann!«, schrien wir. Na, und darum lasse er es sich jetzt auch nicht nehmen, seiner Süßen zum Geburtstag zu gratulieren.
»Wie willst du denn da rüberkommen?«, fragte ich. »Auf dein Moped solltest du dich besser nicht mehr setzen.«
»Ich schwimme«, sagte er, und wir lachten uns mindestens eine Viertelstunde lang schlapp. Mit dem Mut eines Löwen besoffen in die Fluten des Rheins! Wenn das keinen Kater gäbe!
Als klar war, dass er es tatsächlich ernst meinte, habe ich mit ihm gewettet. Dass er es nicht schaffen würde. Ich war ein erstklassiger Schwimmer und kannte den Rhein gut genug, dass ich mir diese Aktion nicht zutraute. Daher sollte uns Lars mit dem Botchen begleiten. Wir hatten das Teil ein paar Stunden vorher an der Anlegestelle an der Straße Am Bört kurz vor dem Landzipfel aufs Trockene gezogen, von wo aus wir am nächsten Morgen zurückfahren wollten. Die Wette lautete, dass Leander niemals das andere Ufer erreichen würde und auf jeden Fall weniger weit käme als ich. Ich war von uns dreien mit Sicherheit der Nüchternste und auch alkoholisiert der Vernünftigste. Schließlich war ich Notar. Und doch immerhin besoffen genug, um mich auf eine derartig bescheuerte Wette einzulassen.
»Wie heißt deine Süße eigentlich?«, fragte ich ihn, als wir, nur mit Unterhose bekleidet, ins Wasser stiegen. »Hera«, bibberte er, denn nach dem Rumhocken an der Feuerstelle war das Wasser doppelt kalt, »Hera König.«
»Wieso willsten die noch heiraten?«, bibberte ich zurück, »die trägt doch eh schon deinen Namen.«
»Es ist der falsche«, grollte er, »der ihrer Eltern. Wir sind beide zwei Königskinder, nur aus verschiedenen Familien!«
Es war eh zu spät, ihm die Heirat, den Geburtstagsbesuch und die Rheinüberquerung auszureden. Wir hatten um 1.000 Euro gewettet, schriftlich. Mir ging es dabei gar nicht ums Geld. Aber Ordnung musste sein, zumal wenn er es nachher möglicherweise nicht mehr würde bestätigen können. Er hatte nicht alle Tassen im Schrank. Das stand mal fest, und es ging um nicht mehr und nicht weniger, als dass er das zugab. – Wie konnte ein erwachsener Mann einem verlogenen minderjährigen Gör derartig verfallen? Hera König. Fast so schön wie Hera Lind. Die reinste Schmonzette. Leander auf dem Weg zu seinem Nymphchen! Und ich Idiot hatte mich darauf eingelassen. – Jetzt ging es ums nackte Überleben!
Es war nichts los auf dem Rhein. Nur der Mond war unser Zeuge. Und der guckte eher griesgrämig aus den Wolken. Okay, bei Schiffsverkehr wären wir ja gar nicht losgeschwommen. In dem Moment hätte ich mir allerdings den einen oder anderen Bootsmann gewünscht, der unseren Weg gekreuzt und uns aus dem Wasser gefischt hätte, bevor wir einer Melusine oder Undine, oder wie sie alle heißen, anheimfielen. Oder einem Fisch? Moby Dick fiel mir ein. Der weiße Wal. 1966 bei Duisburg, 300 Kilometer vom Meer entfernt, er schwamm fast bis Koblenz. Zuletzt bei Hoek van Holland gesichtet. Er musste den Weg zurück ins Meer gefunden haben. Dass wir unseren Weg ans andere Ufer fanden, schien angesichts der Strömung, die an uns riss, immer unwahrscheinlicher. Wo war Leander abgeblieben?
Ehe ich endgültig mit dem Leben abschloss, unternahm ich einen allerletzten Versuch, mich unserem Beiboot zu nähern, und der Wellengang war mir gewogen. Ich kriegte die Bordwand zu fassen und konnte mich festklammern. Lars hing an der anderen Seite, keuchte und spuckte.
»Alles klar, Kumpel?«, rief ich aufmunternd rüber.
»Nie war ich so nüchtern wie heute!«, stöhnte er. Ich habe die Gelegenheit genutzt, ihn zu fragen, wie er es mit seinem Testament halte. Sollte ich dieses Abenteuer überleben – und ich schätzte meine Chancen höher ein als seine –, würde es einiges zu regeln geben. Das ist ja nun mal mein Job. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich bei meinem Freund Kundenakquise betrieb. Ich denke, es ist psychologisch nicht verkehrt, wenn man so kurz vor dem Hopsgehen Klarschiff macht. Viel war ohnehin nicht bei ihm zu holen, dennoch fragte ich die Eckdaten ab. Außer der Mutter und dem Stiefbruder war niemand mehr da, den er bedenken konnte. Abgesehen von ein paar Haushaltsgeräten gab es nur das Botchen. Und wie es aussah, würde das früher oder später an einem der Pfeiler der Friedrich-Ebert-Brücke oder spätestens der Beeckerwerther Brücke am Emscherschnellweg geschrottet. Wir inklusive. Die Rheinüberbauung war in Sichtweite gerückt, und es handelte sich um keine freundliche Annäherung. Wir fixierten die Brücke wie Kaninchen die Schlange und wünschten, es wäre umgekehrt.
*
Gar nicht so weit von der Stelle entfernt, auf einer anderen Brücke, am Zollamt Ruhrort, hatte ich vor vier Jahren die Detonation und die Feuersäule erlebt, westlich von mir, am Becken B. Es mag Einbildung gewesen sein. Aber ich meinte, in dem sich ausbreitenden Blitz etwas durch die Luft fliegen zu sehen, eine menschliche Gestalt. Zeugen in der Nähe des Hafenbeckens wollten gleich zwei Aufschläge ins Hafenbecken gehört haben. Körper? Trümmerteile? Tatsächlich hieß es anschließend, einer der drei Werftarbeiter, die vor Ort gewesen waren, als die Explosion sich ereignete, sei verschwunden. Die Polizei suchte im weiten Umkreis das Gelände ab. Zwei der Männer wurden schließlich hunderte Meter entfernt gefunden, in einem Zustand, der eine Identifizierung schwermachte. Einer lag auf den Schienen der Güterbahn, der andere auf der Straße. Im Rumpf des Tankers, in dem die Monteure im Laderaum mit Nacharbeiten für den Schiffs-TÜV beschäftigt gewesen waren, klaffte ein riesiges Loch. Das Vorderdeck war vollkommen zerstört. Erst nach Stunden bekam die Feuerwehr den Brand in den Griff. Der Rauch war kilometerweit zu sehen. Auf der Karl-Lehr-Brücke staute sich der morgendliche Berufsverkehr. Die Menschen sprangen aus den Autos, drängelten sich in Trauben am Geländer und filmten mit Smartphones. Es gelang mir nur mit Mühe, meinen Weg durch die Menge der Gaffer fortzusetzen.
Der Auslöser der Detonation blieb unklar. Die Schiffsladung – Bitumen und Schweröle – war, bevor der Tanker in die Werft gebracht wurde, vorschriftsmäßig gelöscht worden. Die Ursache daher rätselhaft. Gas? Woher sollte es kommen?
Man suchte das Hafenbecken ab. Fischte im vier Meter tiefen Wasser im Trüben. Trotz der geringen Strömung war durchaus denkbar, dass der Körper durch Schiffsbewegungen abgetrieben war. Polizeiboote fuhren tagelang den Rhein ab.
Erwin blieb verschwunden.
*
Der Gedanke, dass unter uns eine Leiche im Strom liegen mochte, die sich vielleicht irgendwo verfangen hatte, stimmte mich nicht zuversichtlicher. Bis – ja, bis wir plötzlich ein Motorboot hinter uns hörten. Es war Leander. Und er war nicht allein. In null Komma nichts hatten sie uns aus den Fluten gefischt, das Boot vertäut, wir kriegten warme Wolldecken und das Maul nicht mehr zu, während Leander uns seine Story erzählte.
Natürlich war er heillos abgesoffen! Aber immerhin hatte er seine Süße vorher per Whatsapp informiert. Und die war Kind genug, es ihren Eltern brühwarm zu erzählen. Woraufhin Vater König samt seinem trächtigen Balg sofort die Geburtstagsparty verlassen und mit einigen zufällig anwesenden Mitgliedern des Homberger Ruderklubs Germania zu deren Bootshaus an der Schifffahrtschule geeilt war, um den Untergang seines Schwiegersohns in spe live zu erleben. Und natürlich hatte er ihn mit Heras Hilfe und der der Ruderkumpane trotzdem rausgefischt, als sie ihn fanden. Irgendwie muss es ihm imponiert haben, dass dieser Idiot das Leben für sein Töchterchen aufs Spiel gesetzt hatte.
So konnte es auch gehen.
*
Fast ein Jahr war damals verstrichen, als wir uns zum Grillen verabredet hatten. Am Fuß der Rheinorange-Skulptur, gleich hinter den Buhnen, auf denen wir als Teenager geangelt hatten. Das Angeln hatten wir nie mehr aufgenommen. Aber ein anderes Hobby gelegentlich gemeinsam gepflegt: Mit Metallsonden das Rheinufer, die Brachen rund um die großen Industrieanlagen, das Gelände um den Bahnhof und natürlich die Gegend um die Werften abzusuchen. Ich hatte mir zwei richtig gute Detektoren zugelegt. Und mir einiges angelesen, vor allem die Sicherheitsbestimmungen studiert. Und Kartenmaterial. Ich ging es systematisch an. Entsprechend wurden wir fast immer fündig. Nicht immer legten wir selbst Hand an, wenn klar war, was wir freigelegt hatten oder im Begriff waren freizulegen. Bei den richtig großen Oschis alarmierten wir die Polizei. Die immer wieder komplette Stadtteile evakuierte, im letzten Jahr Beeckerwerth und Neuenkamp. In Duisburg war 1944 tüchtig was runtergekommen, insbesondere im Oktober durch alliierte Bomber. Doch auch die Kesselschlacht hatte Spuren hinterlassen. Rund 1.500 US-Soldaten waren dem Kampf um das Ruhrgebiet noch in der letzten Kriegsphase Anfang 1945 zum Opfer gefallen – neben 10.000 Deutschen, Wehrmachtsangehörigen wie Zivilisten. Ganz zu schweigen von den Massenmorden der Gestapo, der Generalfeldmarschall Model hunderte Zuchthausinsassen, darunter politische Häftlinge, Kriminelle und Zwangsarbeiter, in den letzten Kriegstagen zwecks »Überprüfung« – sprich Liquidierung – zuführen ließ. Tausende Jugendliche waren an Panzerfäusten ausgebildet und mit Schusswaffen ausgerüstet worden, deren sie sich entledigt hatten – genau wie die desertierten Soldaten und Parteigenossen beim Einmarsch der alliierten Streitkräfte –, indem sie sie wegwarfen oder im freien Gelände verbuddelten, wo niemand sie zuordnen konnte. Der Duisburger Boden war voller Kriegshinterlassenschaften. Von Munition über Granaten, Gewehre, Patronen, Messer, Parteiabzeichen, Erkennungsmarken, Gürtelschnallen und natürlich auch Münzen fanden wir alles.
Erwin war es nicht nur um Metallschrott gegangen. Er hatte insbesondere Militaria und Drittes-Reich-Devotionalien auf einschlägigen Seiten angeboten. Und er tat das immer noch, wie ich feststellte, als ich mich über ihn schlaumachte. Nach Jurastudium und Zweitem Staatsexamen hatte ich gerade in einem Notariatsbüro angefangen, das ich später übernehmen sollte. Ich traf Erwin eines Tages zufällig vor der Zahnarztpraxis, die im selben Haus untergebracht war, wir kamen ins Gespräch und es gelang mir, ihn dazu zu bewegen, dass ich für ihn ein Testament aufsetzte. Nicht dass er der Mensch war, dem es danach dürstete. Im Gegenteil, ich musste ihn ganz schön um den Finger wickeln. Versprach, es werde ihn keinen Cent kosten, ich täte es gern, aus alter Verbundenheit, erinnerte an unsere gemeinsamen Ausflüge und fragte ihn beiläufig aus. Das Testament war mir ein Anliegen. Tatsächlich war da nicht viel zu holen. Was mir wichtig war: Es gab keine Erben außer Lars. Warum nicht ein bisschen nachbessern? Zumindest, was den Zeitpunkt anging.
Nachdem wir die Formalitäten erledigt hatten, schwärmte ich von unseren Sondengängen, ließ fallen, dass ich heute noch gelegentlich … und da auf etwas gestoßen sei, das ich ihm gerne zeigen würde. Mir selbst sei das zu brisant …
Man sah förmlich das Wasser in seinem Mund zusammenlaufen.
Wir einigten uns darauf, dass ich Besagtes jederzeit in seinem Holzschuppen deponieren könne. Der sei frei zugänglich und dennoch blickgeschützt, sodass mein Fund von Passanten nicht entdeckt werden könne. Er werde ihn begutachten, gegebenenfalls entschärfen und entsorgen.
Was Letzteres anging, machte ich mir keine Gedanken. Es war mir auch egal, ob er lediglich den Metallwert oder den Höchstpreis auf irgendwelchen sinistren Hehler- oder Waffenmärkten erzielte. Gut, im Sinne einer vertrauensbildenden Maßnahme kaufte ich als Erstes über die Seite, auf der er selbst seinen Krempel anbot, eine Granate, die ich Erwin in den Schuppen legte. Als ich ihn nach einer Woche darauf ansprach, hatte ich sie bereits in seinem Warensortiment gefunden. Er erzählte mir, er habe sie dem Kampfmittelräumdienst übergeben.
Lars sagte ich nichts von Erwin, aber ich überredete ihn, dass er das ein oder andere Mal mit mir loszog. Alles, was wir an Waffen entdeckten, barg ich, wenn die Größe und der Zustand es erlaubten, nach allen Regeln der Kunst und legte es im Holzschuppen ab – oder ich verständigte gleich die Polizei. Natürlich ging ich ein gewisses Risiko ein, doch im Gegensatz zu Erwin – da bin ich mir sicher – hatte ich mich sehr gut informiert. Gewiss war er des Lesens mächtig. Viel mehr traute ich ihm allerdings nicht zu. Er war ein Mensch, der sich vor allem durch vermeintliche Bauernschläue auszeichnete und dessen Erfahrungsschatz genau diesen Namen verdiente: die Summe seiner Erfahrungen. Nicht mehr. Ich hingegen musste nicht jede Bombe ausgebuddelt haben, um zu verstehen, wie sie funktionierte. Man kann sich anderweitig schlaumachen. Es ging mir darum, ihn zu fordern. Ihn mit unterschiedlichsten Waffen zu konfrontieren, die er nicht kannte. Man mag das einen Sport nennen. Wer mir bösere Absichten unterstellt, wird wohl nicht ganz falschliegen. Aber ich tat ja nichts, was er nicht wollte. Er sammelte diesen Mist schließlich. Ich habe ihm die Waffen lediglich überlassen. Was er damit machte, war seine Sache. Ich schwöre, es entzieht sich meiner Kenntnis komplett, was an jenem Tag am Hafenbecken B passiert ist. Ja, ich hatte bei ihm am Vortag eine deutsche Elektron-Thermit-Stabbrandbombe abgeliefert, nicht groß, keine 40 Zentimeter, allerdings mit einer zusätzlichen Sprengladung am Kopf, die mit Verzögerung von ein paar Minuten detonieren sollte. Doch was sollte damit passieren, solange das Ding nicht abgeworfen wurde? Ich habe keine Ahnung, wieso der Idiot es zur Arbeit mitgenommen hat. Das immerhin hatte ich beobachtet, dass er, als er die Bombe im Holzschuppen fand, sie vorsichtig verstaute und damit zur Werft fuhr. Vielleicht gab es dort Maschinen, die er zu Hause nicht hatte, um das Ding zu entschärfen oder irgendwelche Experimente damit zu machen? Genau genommen konnte ich ja noch nicht einmal wissen, ob Erwin das Ding nicht seinen Kollegen überlassen und sich verdünnisiert hatte. Vielleicht rein zufällig: Er musste nur ausgetreten sein, weit genug weg von dem Unglücksort, und als das Ding detonierte, war er abgehauen. Oder er dümpelte als Fischfutter irgendwo am Grund des Rheins vor sich hin. Ganz vielleicht war es überhaupt nicht die Bombe gewesen, sondern irgendein Gasaustritt, warum auch immer, wie die Reederei vermutete. Es wurde nie geklärt.
*
Lars und ich durften sechs Wochen nach unserem Rheinabenteuer die Trauzeugen für die Königskinder geben. Gefeiert wurde standesgemäß in der Villa Rheinperle, ehemalige Krupp’sche Direktorenresidenz in der Bliersheimer Villenkolonie. Der Schampus floss in Strömen. Bevor wir auf das Brautpaar anstießen, zog ich Lars beiseite und hob das Glas auf ihn. »Gestern kam die Bestätigung, dass dein Vater für tot erklärt wurde. Als sein Notar kann ich dir sagen: Er hat nicht viel hinterlassen. Aber 20.000 dürften es sein. Cheers!«
»Was?« Lars schossen Tränen in die Augen.
»Dann dürftet ihr ja jetzt gewissermaßen quitt sein, oder?«
Er prostete mir zu.
»Wo bleibt ihr?«, rief Leander. Nachdem wir die Toasts auf das Brautpaar durchgestanden hatten, bestellte ich Lars für den nächsten Tag bei mir ein. Zur offiziellen Testamentseröffnung.
Anderntags klingelte es zur vereinbarten Zeit bei mir zu Hause.
Nicht Lars.
Mehrere Polizisten mit gezückten Waffen standen vor der Tür. »Hausdurchsuchung!«, bellte der erste und hielt mir einen Wisch hin.
»Moment, was soll das?«, protestierte ich.
»Ihnen wird vorgeworfen, über das Darknet Waffenbestellungen vorgenommen zu haben. Außerdem müssen wir Sie befragen.«
»Wozu?«
»Sie standen – auch, was die Waffen angeht – nachweislich mit Herrn Erwin Vogeler in Verbindung. Herr Vogeler ist seit dem Frühjahr 2016 verschwunden, nach der vermutlich von ihm ausgelösten Explosion auf einem Tanker im Duisburger Hafen. Dazu brauchen wir von Ihnen einige Auskünfte …«