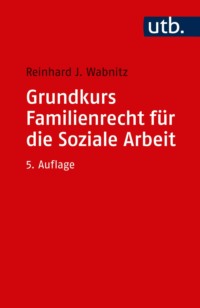Kitabı oku: «Grundkurs Familienrecht für die Soziale Arbeit», sayfa 3
2 Verlöbnis und Ehe
Der erste der drei Abschnitte des Buches 4. BGB Familienrecht mit der Überschrift „Bürgerliche Ehe“ umfasst mit ca. 300 Paragraphen fast 50% der ca. 600 Vorschriften des gesamten Buches 4., von denen wiederum weit mehr als die Hälfte dem ehelichen Güterrecht und insbesondere dem Vertragsgüterrecht gewidmet sind. Da der zuletzt genannte Themenbereich für die Soziale Arbeit nicht von sehr großer Bedeutung ist, wird darauf nur stichwortartig eingegangen.
2.1 Verlöbnis
Das Verlöbnis ist ein formfreier familienrechtlicher Vertrag mit dem Inhalt des gegenseitigen Heiratsversprechens. War das Verlöbnis früher regelmäßiges „Vorstadium der Ehe“, so hat es in den letzten Jahren an Bedeutung verloren. Es hat auch nur noch wenige rechtliche Konsequenzen (siehe Übersicht 4).
Übersicht 4
Das Verlöbnis (= familienrechtlicher Vertrag)
Rechtliche Konsequenzen:
1. (ggf.) Ersatzpflichten bei Rücktritt (§§ 1298, 1299), z. B. bei Aufwendungen für Hochzeit oder Haushalt
2. (ggf.) Herausgabe von Geschenken (§ 1301)
3. Verlobte sind „Angehörige“ i. S. v. § 11 Abs. 1 Nr. 1a StGB
4. Zeugnisverweigerungsrechte von Verlobten im Straf- und Zivilprozess (§ 52 Abs. 1 Nr. 1 StPO, § 383 Abs. 1 Nr. 1 ZPO)
2.2 Eheschließung
Wesentlich folgenreicher als das Verlöbnis ist die Ehe. Dementsprechend umfangreicher und komplizierter sind die rechtlichen Regelungen betreffend Eheschließung, Ehewirkungen und Ehescheidung. Das BGB enthält lediglich Rechtsvorschriften betreffend die „weltliche“ Ehe; es erkennt allerdings in § 1588 an, dass es daneben auch kirchenrechtliches Eherecht gibt, dessen (ggf. weitergehende) Verpflichtungen „durch die Vorschriften dieses Abschnittes nicht berührt werden.“
Auch die Eheschließung stellt einen familienrechtlichen Vertrag zwischen den Ehegatten dar. Die Ehe kann gemäß § 1353 Abs. 1 Satz 1 zwischen zwei Personen sowohl verschiedenen Geschlechts als auch (seit dem 01.10.2017) gleichen Geschlechts geschlossen werden, sofern die in Übersicht 5 aufgelisteten Voraussetzungen vorliegen – mit unterschiedlichen rechtlichen Konsequenzen bei Verstößen gegen die dort genannten Vorschriften.
Übersicht 5
Voraussetzungen für eine Eheschließung
1. Absolut unverzichtbar (sonst: „Nicht-Ehe“!)
– Erklärungen der Eheschließenden vor dem zuständigen Standesbeamten, miteinander die Ehe eingehen zu wollen (§ 1310 Abs. 1 Satz 1).
– Ehemündigkeit: gemäß § 1303 Satz 2 kann mit einer Person, die das 16. Lebensjahr nicht vollendet hat, eine Ehe nicht wirksam eingegangen werden.
2. Kein Verstoß – sonst ggf. Aufhebbarkeit der Ehe nach §§ 1313 ff. – gegen
– § 1303 Satz 1 (Mindestalter: 18 Jahre)
– § 1304 (Geschäftsunfähigkeit)
– § 1306 (keine bereits bestehende Ehe oder eingetragene Lebenspartnerschaft nach dem LPartG)
– § 1307 (enge Verwandtschaft)
– § 1308 (Adoption)
– § 1311 (persönliche Anwesenheit)
– § 1314 Abs. 2 Nr. 1 bis 5
3. Weitere Verfahrensvorschriften insb. nach dem PStG
(Bei Verstößen: rechtswirksame, unaufhebbare Ehe)
2.2.1 Unverzichtbare Voraussetzungen nach § 1310 Abs. 1 und § 1303 Satz 2
Gemäß § 1310 Abs. 1 wird die Ehe ausschließlich dadurch geschlossen, dass „die Eheschließenden vor dem Standesbeamten erklären, die Ehe miteinander eingehen zu wollen.“ Mangelt es an einer entsprechenden Willenserklärung, handelt sich um eine sog. „Nicht-Ehe“ ohne Ehewirkungen.
Vertiefung: Dasselbe gilt (seit dem 01.10.2017) gemäß § 1303 Satz 2 für den Fall einer Ehe mit einer Person, die das 16. Lebensjahr nicht vollendet hat; ob diese Regelung bei nach ausländischem Recht geschlossenen Ehen verfassungskonform ist, hat das BVerfG zu entscheiden (BGH ZKJ 2019, 107).
2.2.2 Ehefähigkeit und Eheverbote
Sodann beinhaltet das BGB in § 1303 Satz 1 sowie in den §§ 1304 ff. Rechtsvorschriften, die der Standesbeamte ebenfalls zu beachten hat. Sollte hier jedoch ein „Fehler“ unterlaufen, ist dennoch eine Ehe rechtswirksam zustande gekommen, die jedoch auf Antrag (vgl. § 1316, § 1317) gemäß § 1313 durch richterliche Entscheidung (des Familiengerichts) aufgehoben werden „kann“ (nicht: muss!).
Juristisch gesehen handelt es sich bei den genannten Vorschriften teils um persönliche Ehevoraussetzungen, teils um Eheverbote. Persönliche Voraussetzung ist insbesondere die Geschäftsfähigkeit (§ 1304), die nicht gegeben ist im Falle des § 104 Nr. 2 („nicht nur vorübergehender Zustand krankhafter Störung der Geistestätigkeit...“). Zum anderen darf die Ehe gemäß § 1303 Satz 1 nicht vor Eintritt der Volljährigkeit eingegangen werden. Die früher bestehende Möglichkeit, dass das Familiengericht bei einer mindestens 16 Jahre alten Person vom Erfordernis der Volljährigkeit Befreiung erteilen konnte, wenn der künftige Ehegatte volljährig war, besteht seit dem 01.10.2017 nicht mehr.
Anders als in früheren Jahrzehnten, als ganzen Bevölkerungsgruppen die Eheschließung verboten war, kennt das BGB heute nur noch einige wenige Eheverbote, insbesondere für den Fall der „Doppelehe“ bei bereits bestehender anderer Ehe oder eingetragener Lebenspartnerschaft nach dem Lebenspartnerschaftsgesetz (§ 1306) und der sehr engen Verwandtschaft (§ 1307). Die Ehe ist in Deutschland danach nur noch zwischen „Blutsverwandten“ in gerader Linie (vgl. § 1589 Satz 1) verboten, also im Verhältnis Großeltern – Eltern – Kinder etc., und zwischen Geschwistern, die zumindest einen Elternteil gemeinsam haben („vollbürtige und halbbürtige Geschwister“), auch wenn das Geschwisterverhältnis durch Annahme als Kind (eines anderen) erloschen ist. Auch Vettern und Kusinen dürfen heiraten. Schließlich „soll“ gemäß § 1308 auch keine Ehe zwischen Personen geschlossen werden, deren juristische Verwandtschaft auf einer Annahme als Kind (Adoption) beruht. Wird allerdings gegen diese Vorschrift verstoßen, ist die (ohnehin) gültige Ehe nicht aufhebbar (vgl. § 1314 Abs. 1 Nr. 2, in dem § 1308 nicht genannt wird!).
Schließlich kann eine Ehe aufgehoben werden bei Verstößen gegen § 1311 oder in einem der Fälle des § 1314 Abs. 2, z. B. der so genannten „Scheinehe“ (Nr. 5), wenn überhaupt keine eheliche Gemeinschaft begründet werden soll oder in den weiteren, teilweise kurios anmutenden Fällen des § 1314 Abs. 2, insbesondere Nr. 1 und 2 (Eheschließung im „Zustand der Bewusstlosigkeit“ oder wenn man „nicht gewusst hat, dass es sich um eine Eheschließung handelt“).
2.2.3 Weitere Verfahrensvorschriften
Darüber hinaus gibt es weitere Verfahrensvorschriften insbesondere des Personenstandsgesetzes (PStG) für die Eheschließung, deren eventuelle Nicht-Einhaltung die rechtliche Gültigkeit der Ehe jedoch nicht berührt (§§ 11 ff. PStG).
2.3 Ehewirkungen
Die Eheschließung hat vielfältige rechtliche Konsequenzen (siehe dazu Übersicht 6) für die Eheleute – sowohl im Zivilrecht (vgl. insbesondere § 1353 ff.) als auch im öffentlichen Recht, dort u. a. mit Vergünstigungen im Sozialrecht und im Steuerrecht.
Übersicht 6
Ehewirkungen
1. Eheliche Lebensgemeinschaft
1.1 Leben in Gemeinschaft (§ 1353 Abs. 1 Satz 2)
1.2 Sorge um die gemeinsamen Angelegenheiten (§ 1353)
1.3 Gemeinsame Nutzung von Wohnung und Hausrat
1.4 Gegenseitiger Beistand (vgl. § 1353)
1.5 Gegenseitige Rücksichtnahme (vgl. § 1353)
1.6 Gleichberechtigte Partnerschaft (vgl. § 1356)
2. Ehename (§ 1355)
3. Unterhalt (§ 1360)
4. Eigentumsvermutungen (§ 1362)
5. Eheliches Güterrecht (§§ 1363 ff.)
6. Erbrecht (§§ 1371, 1922 ff.)
7. Zeugnisverweigerungsrechte
8. Vergünstigungen im Sozialrecht
9. Vorteile im Steuerrecht
2.3.1 Eheliche Lebensgemeinschaft
Gemäß § 1353 Abs. 1 Satz 1 wird die Ehe von zwei Personen verschiedenen Geschlechts oder (seit 01.10.2017) gleichen Geschlechts auf Lebenszeit geschlossen – auch wenn mittlerweile in Deutschland mehr als jede dritte Ehe geschieden wird. Auch eine kinderlose Ehe ist eine juristisch vollwertige Ehe.
Zentrale rechtliche Konsequenz der Eheschließung ist gemäß § 1353 Abs. 1 Satz 2, dass die Ehegatten „einander zu ehelicher Lebensgemeinschaft verpflichtet“ sind und füreinander Verantwortung tragen. Dabei handelt es sich um unbestimmte Rechtsbegriffe, die oft schwer mit konkretem juristischem Inhalt zu füllen sind. Manche Verpflichtungen sind zudem zumindest nicht prozessual durchsetzbar. Nach der Rechtsprechung und der juristischen Literatur umfasst der Begriff der „ehelichen Lebensgemeinschaft“ insbesondere Folgendes:
• Leben in Gemeinschaft. Dies bedeutet – von Missbrauchsfällen abgesehen (vgl. § 1353 Abs. 2) – regelmäßig Zusammenleben, aber nicht zwingend ständiges Zusammensein z. B. an einem Wohnsitz, wie dies bei Fernbeziehungen ohnehin nicht möglich wäre. Als juristisch zum Wesen der Ehe gehörend angesehen werden nach wie vor die Pflicht zur Wahrung der ehelichen Treue und – je nach Alter und Gesundheit – zur Geschlechtsgemeinschaft.
• Sorge um die gemeinsamen Angelegenheiten (vgl. BGH JZ 1960, 371). Dabei geht es – je nach Absprache zwischen den Eheleuten – z. B. um Haushaltsführung, Kinderbetreuung, Freizeitplanung, Vermögensdisposition.
• Gemeinsame Nutzung der Ehewohnung und Mitbenutzung der den Ehegatten gehörenden Hausratsgegenstände (vgl. BGHZ 71, 216).
• Beistand (auch) in persönlichen Angelegenheiten, soweit zumutbar, bis hin etwa auch zur Verpflichtung zur Verhinderung von strafbaren Handlungen in der Ehewohnung (BGH NJW 1954, 1818) oder des Selbstmordes des Ehepartners oder zur Verpflichtung, in steuerlichen Angelegenheiten im Sinne der jeweils günstigsten Lösung (z. B. bei der Steuerklassenwahl) zusammenzuarbeiten (BGH FamRZ 1977, 38).
• Gegenseitige Rücksichtnahme in persönlichen, beruflichen aber auch finanziellen Angelegenheiten – dabei muss das Recht auf Wahrung der eigenen Persönlichkeits- und Intimsphäre gewahrt bleiben (BGH FamRZ 1990, 846).
• Gleichberechtigte Partnerschaft. Spätestens seit Bestehen des Grundgesetzes 1949 (vgl. Art. 3 Abs. 1 und 2 GG) ist das Führen einer gleichberechtigten Partnerschaft zwischen Mann und Frau – wie nunmehr auch zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern – juristische Selbstverständlichkeit. Aber die Realität sah noch lange anders aus, teilweise bis heute.
2.3.2 Ehename
Welche Möglichkeiten ein Paar bei der Wahl des Ehenamens hat, zeigt die Übersicht 7.
Übersicht 7
Mögliche Alternativen der Namensgestaltung (§ 1355)
am Beispiel von Frau Schulz und Herrn Schmidt
1. Schulz, Schulz Ehename (§ 1355 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2)
2. Schmidt, Schmidt Ehename (§ 1355 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2)
3. Schulz, Schmidt kein Ehename (§ 1355 Abs. 1 Satz 3)
4. Falls Ehename Schulz (§ 1355 Abs. 4 Satz 1)
– a) Frau Schulz, Herr Schmidt-Schulz
– b) Frau Schulz, Herr Schulz-Schmidt
5. Falls Ehename Schmidt (§ 1355 Abs. 4 Satz 1)
– a) Frau Schulz-Schmidt, Herr Schmidt
– b) Frau Schmidt-Schulz, Herr Schmidt
Weitere Alternativen bei:
– Abweichen des Namens vom Geburtsnamen (vgl. § 1355 Abs. 4 Sätze 2 und 3)
– Tod eines Ehegatten oder Scheidung (§ 1355 Abs. 5)
Seit 1994 müssen Eheleute keinen Ehenamen mehr bestimmen, auch wenn sie dies weiterhin tun „sollen“ (vgl. § 1355 Abs. 1 Satz 1). Haben sie einen Ehenamen bestimmt, gibt es nunmehr eine Fülle von Kombinationsmöglichkeiten (siehe Übersicht 7). Die Wahl desselben (!) Doppelnamens aus den Geburtsnamen der Ehepartner ist jedoch weiterhin nicht möglich. Geschiedene, die wieder heiraten, dürfen den angeheirateten Nachnamen des Ex-Ehepartners zum gemeinsamen Ehenamen in einer neuen Ehe bestimmen.
2.3.3 Unterhaltspflichten
Gemäß § 1360 sind die Ehegatten verpflichtet, einander Unterhalt zu gewähren (Ehegattenunterhalt), und zwar durch Arbeit, Verwertung von Vermögen oder Führen des Haushalts, und ohne dass sie sich – wie bei anderen Unterhaltsarten – Geldbeträge zukommen lassen müssen. Deshalb spricht man hier auch von „Naturalunterhalt“.
Wie dies im Einzelfall konkret geschieht, wer welche Aufgaben übernimmt, obliegt der partnerschaftlichen Absprache der Eheleute (vgl. § 1356). Weitere Einzelheiten sind in § 1360a geregelt. Gemäß § 1357 Abs. 1 ist jeder Ehegatte berechtigt, Geschäfte zur angemessenen Deckung des Lebensbedarfs der Familie mit Wirkung auch für den anderen Ehegatten zu besorgen. Durch solche Geschäfte werden beide Ehegatten berechtigt und verpflichtet, es sei denn, dass sich aus den Umständen etwas anderes ergibt.
2.3.4 Eigentumsvermutung
§ 1362 enthält eine für die Soziale Arbeit nicht zentrale Bestimmung zu Gunsten von Gläubigern.
2.3.5 Eheliches Güterrecht
Die folgende Übersicht 8 zeigt die drei Möglichkeiten der Gestaltung des Güterrechts.
Übersicht 8
Eheliches Güterrecht
Es bestehen drei Möglichkeiten der Gestaltung:
1. Gütertrennung durch notariellen Ehevertrag (§ 1414)
2. Gütergemeinschaft durch notariellen Ehevertrag (§§ 1415 ff.)
3. Zugewinngemeinschaft als gesetzlich vorgesehener Regelfall, wenn kein Ehevertrag geschlossen wurde (§§ 1363 ff.); dabei:
– zunächst: Gütertrennung;
– bei Beendigung des Güterstandes: Zugewinnausgleich
Das umfangreichste Thema des gesamten Familienrechts des BGB ist das eheliche Güterrecht, insbesondere das Vertragsgüterrecht, mit fast 200 Paragraphen (§§ 1373 bis 1563). Eheleute können durch notariellen Vertrag nach § 1410 entweder Gütertrennung nach § 1414 oder Gütergemeinschaft nach § 1415 vereinbaren (zur Wirksamkeit und Inhaltskontrolle von Eheverträgen vgl. allerdings BGH FamRZ 2004, 930 sowie FuR 2008, 208). Tun sie dies, wie die meisten Ehepartner, nicht, leben sie gemäß § 1363 Abs. 1 im gesetzlichen Güterstand der so genannten „Zugewinngemeinschaft“.
Bei Letzterem sind in zeitlicher Hinsicht zwei Phasen zu unterscheiden. Zunächst (und überwiegend auf Dauer) besteht Gütertrennung, d. h. die Vermögensgegenstände bleiben weiterhin im Eigentum des jeweiligen Ehepartners. (Nur) im Falle der Ehescheidung (§§ 1564 ff.) bzw. ggf. auch bereits nach 3-jährigem Getrenntleben (§§ 1385 f.) erfolgt der so genannte Zugewinnausgleich auf der Grundlage dessen, was die Eheleute während der Ehezeit erworben haben („Zugewinn“).
„Zugewinn“ ist der Betrag, um den das Endvermögen eines Ehegatten dessen Anfangsvermögen übersteigt (§ 1373 Abs. 1). Dabei wird zunächst das Anfangsvermögen jedes Ehegatten ermittelt (§§ 1374 Abs. 1, 1376, 1377), wobei diesem Anfangsvermögen auch während der Ehezeit ererbtes oder geschenktes Vermögen zugerechnet wird (§ 1374 Abs. 2), so dass dieses im Ergebnis auch weiterhin demjenigen Ehegatten in vollem Umfange verbleibt, der es geerbt oder geschenkt bekommen hat. Ggf. sind bei der Ermittlung des Anfangsvermögens allerdings gemäß § 1374 Abs. 3 Verbindlichkeiten über die Höhe des Vermögens hinaus abzuziehen. Sodann wird das Endvermögen jedes Ehegatten ermittelt (§§ 1375 Abs. 1, 1376), dem ggf. auch „verschobene“ Vermögenswerte etc. zugerechnet werden (§ 1375 Abs. 2). Im nächsten Schritt wird bei jedem Ehegatten „saldiert“ (Endvermögen minus Anfangsvermögen). Das Ergebnis ist der „Zugewinn“ jedes Ehegatten. Übersteigt der Zugewinn des einen Ehegatten den Zugewinn des anderen, so steht gemäß § 1378 Abs. 1 die Hälfte des Überschusses dem anderen Ehegatten als Ausgleichsforderung zu.
Fall 1: Beispiel für einen Scheidungsfall

Im Ergebnis steht mithin dem Ehemann ein Differenzbetrag in Höhe von 75.000 (der Hälfte von 150.000) als Ausgleichsforderung gegenüber der Ehefrau zu.
2.3.6 Erbrecht (Buch 5. BGB)
Das Erbrecht baut weit gehend auf familienrechtlichen Grundsätzen und Zusammenhängen auf und privilegiert z. B. im Todesfall den überlebenden Ehegatten (vgl. §§ 1371, 1931 ff.). Außerdem gibt es auf Ehegatten zugeschnittene besondere Regelungen wie z. B. über gemeinschaftliche Testamente (§§ 2265 ff.).
2.3.7 Prozessrecht
Ehegatten haben Zeugnisverweigerungsrechte im Zivil- und im Strafprozess (§ 383 Abs. 1 Nr. 2 ZPO, § 52 Abs. 1 Nr. 2 StPO).
2.3.8 Sozialrecht
Es gibt eine Reihe privilegierender Vorschriften für Eheleute, z. B. in der Kranken- und Pflegeversicherung (beitragsfreie Mitversicherung von Ehegatten unter bestimmten Voraussetzungen).
2.3.9 Steuerrecht
Die wichtigste Privilegierung von Eheleuten im Steuerrecht erfolgt über das so genannte Ehegattensplitting bei Zusammenveranlagung, wobei der Splitting-Vorteil besonders groß ist, wenn ein Ehepartner über kein oder nur ein geringes Einkommen und der andere über ein sehr großes Einkommen verfügt.
 Literatur
Literatur
Bergschneider, L. (2018): Verträge in Familiensachen. 6. Aufl.
Johannsen, K., Henrich, D. (Hrsg.) (2015): Eherecht. 6. Aufl.
Langenfeld, G., Milzer, L. (2019): Handbuch der Eheverträge und Scheidungsvereinbarungen. 8. Aufl.
Schulz, W., Hauß, J. (2015): Vermögensauseinandersetzung bei Trennung und Scheidung. 6. Aufl.
Fall 2: Eheschließung und Ehewirkungen
1. Die beiden volljährigen Verlobten A und B aus Gelsenkirchen befinden sich im Urlaub im Bayerischen Wald und genießen auf dem Großen Arber den Blick über die herrliche Landschaft. In der Berggastwirtschaft sprechen sie über ihre geplante Heirat. Am Nachbartisch hört dies ein ebenfalls im Urlaub befindlicher Standesbeamter aus München. Dieser „bietet“ an, doch gleich an Ort und Stelle zu heiraten. So geschieht es: A und B erklären „vor dem Standesbeamten, die Ehe miteinander eingehen zu wollen“ (vgl. § 1310 Abs. 1 Satz 1). Ist die Ehe rechtswirksam zustande gekommen?
2. Gesetzt den Fall, dies hätte sich im Standesamt von Gelsenkirchen zugetragen – mit dem Unterschied, dass der dortige Standesbeamte übersehen hätte, dass B in diesem Fall A´s Schwester war. Was jetzt?
3. Gesetzt den Fall, die volljährigen A und B sind „ordnungsgemäß“ verheiratet. A verlangt nunmehr aber, dass B ihren Beruf aufgibt und nur noch ihn „umsorgt“. Wie ist in diesem Fall die Rechtslage?
4. Nach einigen Jahren Ehe verstehen sich A und B nicht mehr. A möchte nun, dass seine neue Freundin F in die Ehewohnung einzieht und mit ihm im Schlafzimmer schläft. A meint, B könne im Wohnzimmer bleiben. Muss B dies akzeptieren?
3 Getrenntleben und Ehescheidung
Die Ehescheidung ist juristisch gesehen ein Unterfall der Trennung. Andererseits setzt die Scheidung in der Regel Getrenntleben voraus, so dass zunächst auf Letzteres eingegangen wird.
3.1 Getrenntleben
Getrenntleben von Eheleuten stellt zumeist einen Schwebezustand zwischen „normaler“ und geschiedener Ehe dar. Der Tatbestand des Getrenntlebens ist in § 1567 – als Voraussetzung der Scheidung – definiert. Er enthält objektive und subjektive Merkmale, die beide erfüllt sein müssen. Objektiv darf gemäß § 1567 Abs. 1 Satz 1 keine häusliche Gemeinschaft mehr bestehen. Dies reicht aber alleine noch nicht aus, denn es gibt zahlreiche Eheleute, die – aus welchen Gründen auch immer – räumlich voneinander entfernt leben. Hinzukommen muss nämlich des Weiteren (subjektives Merkmal), dass ein Ehegatte die häusliche Gemeinschaft erkennbar nicht (mehr) herstellen will, weil er die eheliche Lebensgemeinschaft ablehnt.
Getrenntleben ist gemäß § 1567 Abs. 1 Satz 2 auch innerhalb der ehelichen Wohnung möglich, gelegentlich aber schwer feststellbar. Erforderlich dafür ist nach der Rechtsprechung (vgl. BGH FamRZ 1978, 671; 1979, 469) z. B., dass kein gemeinsamer Haushalt geführt wird, eine „Trennung von Tisch und Bett“ erfolgt ist und dass ein gelegentliches Zusammentreffen der Ehegatten rein räumliches Nebeneinander darstellt. Die Sorge für gemeinsame Kinder schließt ein Getrenntleben nicht aus.
Um eventuelle Versöhnungsversuche der (Noch-) Eheleute zu erleichtern, unterbricht gemäß § 1567 Abs. 2 ein Zusammenleben über kürzere Zeit die Ein- und Dreijahresfristen für die Scheidung nach § 1566 nicht (siehe dazu 3.2).
Nicht erst eine eventuelle Scheidung, sondern bereits ein Getrenntleben nach § 1567 hat erhebliche rechtliche Konsequenzen, wie in der Übersicht 9 dargestellt ist.
Übersicht 9
Rechtliche Konsequenzen des Getrenntlebens (§ 1567)
1. Trennungsunterhalt (§ 1361)
2. Verteilung Hausrat (§ 1361a)
3. Ehewohnung (Nutzung) (§ 1361b)
4. ggf. vorzeitiger Zugewinnausgleich (§ 1385)
5. ggf. Konsequenzen für das Sorgerecht (Kinder)
6. Steuerrechtliche Konsequenzen (ggf. Verlust von Splittingvorteilen)
Getrenntleben von Ehegatten hat eine grundlegende unterhaltsrechtliche Konsequenz: Die bisherige Verpflichtung nach § 1360, einander und die Familie nach näherer Vereinbarung der Eheleute durch Arbeit und aus einem eventuellen Vermögen zu unterhalten sowie ggf. den Haushalt zu führen („Naturalunterhalt“), wandelt sich gemäß § 1361 in einen Anspruch des einen Ehegatten gegen den anderen entsprechend dessen Lebensbedarfs um, wobei der laufende Unterhalt gemäß § 1361 Abs. 4 nunmehr durch Zahlung einer monatlichen Geldrente zu leisten ist.
Für die bisher gemeinsam genutzten Hausratsgegenstände sieht § 1361a ein Verteilungsverfahren vor, und § 1361b regelt Modalitäten der Nutzung der Ehewohnung (durch einen Ehepartner, durch beide oder bei Härtefällen durch Zahlung von Nutzungsvergütungen). Bei Streitfällen entscheiden ggf. die Familiengerichte über Fragen nach den §§ 1361a, b.
Bereits nach drei Jahren Getrenntlebens (also nicht nur im Fall der Scheidung!) kann jeder Ehegatte gemäß § 1385 auf vorzeitigen Zugewinnausgleich klagen (vgl. Kapitel 2.3.5). Automatische sorgerechtliche Konsequenzen hat das Getrenntleben nicht (vgl. § 1671 Abs. 1; siehe dazu auch Kapitel 9). Allerdings verlieren Eheleute – außer im Kalenderjahr des Beginns des Getrenntlebens – die ihnen eingeräumten Steuervorteile, insbesondere die Splitting-Vorteile und das Recht zur Wahl von Steuerklassen.
3.2 Scheidung
Die Ehescheidung erfolgt – wie die Eheschließung – durch den Staat, allerdings nicht durch den Standesbeamten, sondern gemäß § 1564 auf Antrag eines oder beider Ehegatten durch richterliche Entscheidung (des Fa-miliengerichts). Die Scheidung hat zahlreiche rechtliche Konsequenzen, hauptsächlich gleichsam „spiegelbildlich“ zu den Ehewirkungen (siehe 2.3), z. B. mit Blick auf Unterhalt, Hausrat, Vermögen, Versorgungsanwartschaften, allerdings nicht mehr „automatisch“ mit Blick auf das Sorgerecht für Kinder (vgl. dazu Kapitel 9). Seit 1977 – vorher galt das Verschuldensprinzip – gibt es nur noch einen einzigen Scheidungsgrund: das Scheitern der Ehe („Zerrüttung“) gemäß § 1565. Die Ehe ist gescheitert, wenn eine der in Übersicht 10 genannten drei gesetzlichen Alternativen gegeben ist.
Übersicht 10
Ehescheidung durch richterliche Entscheidung (§ 1564)
Im Falle des Scheiterns der Ehe („Zerrüttung“) gemäß § 1565 Abs. 1 Satz 1 kann eine Ehe geschieden werden, weil:
1. die Lebensgemeinschaft nicht mehr besteht und die Wiederherstellung nicht mehr erwartet werden kann (§ 1565 Abs. 1 Satz 2) sowie in der Regel ein Jahr Getrenntleben (vgl. § 1565 Abs. 2). In diesem Fall ist eine Prüfung durch das Familiengericht nötig;
2. ein Paar ein Jahr getrennt lebt und der andere Ehegatte einverstanden ist (§ 1566 Abs. 1). (= unwiderlegbare Vermutung);
3. ein Paar drei Jahre getrennt lebt (§ 1566 Abs. 2). (= unwiderlegbare Vermutung).
Ausnahme: besondere Härte § 1568
Der Grundtatbestand ist der des § 1565 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. Satz 1. Dem Familiengericht obliegt dabei eine materielle Zerrüttungsprüfung. Das Gericht muss z. B. durch Befragen der Parteien, ggf. durch Vernehmung von Zeugen, den Zustand der Ehe analysieren, eventuelle Versöhnungschancen prognostizieren und sodann zu der Überzeugung gelangen und dies ausdrücklich feststellen, dass die Ehe unheilbar zerrüttet und damit gescheitert ist, weil „die Lebensgemeinschaft der Ehegatten nicht mehr besteht und nicht erwartet werden kann, dass die Ehegatten sie wieder herstellen.“ Dies setzt ggf. ein Nachforschen auch von Eheinterna voraus.
Um dies in möglichst vielen Fällen zu vermeiden, wird der Grundtatbestand des § 1565 Abs. 1 Satz 2 um die weiteren Tatbestände des § 1566 Abs. 1 (einvernehmliche Scheidung bei einem Jahr Getrenntleben) und Abs. 2 (drei Jahre Getrenntleben, wenn es zu keiner einvernehmlichen Scheidung kommt) ergänzt, die jeweils für das Familiengericht unwiderlegbare Vermutungen für das Scheitern der Ehe beinhalten. Der Grundtatbestand des § 1565 Abs. 1 Satz 2 bleibt aber wichtig u. a. für folgende Fallgestaltungen:
• Scheidung bei Getrenntleben von weniger als einem Jahr (§ 1565 Abs. 2), die aber nur ausnahmsweise bei „unzumutbarer Härte“, z. B. bei wiederholten tätlichen Angriffen gegen die / den Scheidungswilligen, möglich ist und
• nicht einvernehmliche Scheidung bei Getrenntleben von mehr als einem Jahr, jedoch weniger als drei Jahren.
Auch wenn die Ehe gescheitert ist, soll sie dennoch nicht geschieden werden, wenn einer der Ausnahmetatbestände des § 1568 Platz greift, die gleichsam für den Fall der „Scheidung zur Unzeit“ vorgesehen sind. Sehr eng gefasste Gründe für eine solche Ausnahme können mit Blick auf gemeinsame minderjährige Kinder (erste Alternative) oder den nicht scheidungswilligen Ehegatten (zweite Alternative) vorliegen, die von den Familiengerichten jedoch nur selten akzeptiert werden.
3.3 Scheidungsfolgen
Eine Ehescheidung hat tief greifende rechtliche Konsequenzen, nicht nur mit Blick auf die erheblichen Gerichts-, Rechtsanwalts- und ggf. Notariatsgebühren. Die rechtlichen Scheidungsfolgen sind in der Übersicht 11 aufgeführt.
Übersicht 11
Scheidungsfolgen
1. (ggf.) Unterhalt nach Scheidung (§§ 1569 ff.)
2. Zugewinnausgleich (§§ 1372 ff.)
3. Versorgungsausgleich (§§ 1587 ff.)
4. (ggf.) Änderungen beim Sorgerecht (§ 1671)
ferner: Konsequenzen im:
5. Steuerrecht (Wegfall des so genannten „Ehegattensplittings“, ungünstigere Steuerklassen)
6. Sozialrecht (Wegfall von Vergünstigungen)
7. Ggf. Überlassung der Ehewohnung und Haushaltsgegenstände (§§ 1568a, 1568b)
3.3.1 Unterhalt nach Scheidung
Das Unterhaltsrecht nach den §§ 1569 ff. ist eines der besonders komplizierten Themen des Familienrechts; es wurde zum 01.01.2008 erneut grundlegend novelliert. Auch die Rechtsprechung hat sich hier ständig fortentwickelt. Im Folgenden werden die wichtigsten Grundzüge dargestellt, während Einzelfragen des für die Soziale Arbeit noch wichtigeren Verwandtenunterhaltsrechts in Kapitel 5 und 6 ausführlicher behandelt werden.
Der Ehepartner, der weniger oder nichts verdient, hat nicht automatisch einen Unterhaltsanspruch gegen den / die frühere /n Ehepartner /in. Vielmehr müssen dazu die in Übersicht 12 genannten zehn rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sein.
Übersicht 12
Voraussetzungen für einen Unterhaltsanspruch des geschiedenen Ehegatten
1. Es liegt kein Unterhalts(verzichts)vertrag vor (§ 1585c).
2. Ein geschiedener Ehegatte kann nach der Scheidung nicht selbst für sich sorgen, weil er keine angemessene Erwerbstätigkeit (§ 1574) ausüben kann (§ 1569).
3. Die Voraussetzungen eines der §§ 1570, 1571, 1572, 1573, 1575 oder 1576 müssen zusätzlich zu § 1569 erfüllt sein.
4. Bedürftigkeit des Unterhaltsberechtigten (§ 1577)
5. Leistungsfähigkeit des Unterhaltsverpflichteten (§ 1581)
6. keine Beschränkung oder kein Wegfall der Unterhaltsverpflichtung wegen Unbilligkeit bzw. grober Unbilligkeit (§ 1578 b, § 1579)
7. ggf. Rangverhältnisse mehrerer Unterhaltsbedürftiger (§ 1582)
8. Art der Unterhaltsgewährung: Geldrente (§ 1585)
9. Maß und Höhe des Unterhalts nach den ehelichen Lebensverhältnissen (vgl. Düsseldorfer Tabelle) (§ 1578)
10. Ende des Unterhaltsanspruchs bei Wiederheirat oder Tod des / der Unterhaltsberechtigten (§ 1586)
Unterhaltsverzichtsverträge: Entsprechend der im BGB grundsätzlich bestehenden Vertragsfreiheit können Ehegatten nach § 1585c auch über die Unterhaltspflicht für die Zeit nach der Scheidung notarielle Vereinbarungen treffen und dabei auch Unterhaltsansprüche nach Scheidung ganz oder teilweise ausschließen. Allerdings kann ein solcher Vertrag nach der Rechtsprechung (vgl. BGH FamRZ 1992, 1403; NJW 1995, 1148; FamRZ 2004, 601; NJW 2004, 930) in Ausnahmefällen gegen den Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242) verstoßen oder sittenwidrig (§ 138) und deshalb nichtig sein, wenn Unterhaltsansprüche z. B. auch für den Fall ausgeschlossen werden, dass der nicht verdienende Ehepartner kleine Kinder zu betreuen hat, zu deren Lasten ein solcher Unterhaltsverzichtsvertrag ginge (so BVerfG FamRZ 2001, 343).
Ein Ehegatte kann nicht selbst für sich sorgen: Ein Unterhaltsanspruch nach Scheidung – also nach Ende einer Ehegattenunterhaltsansprüche begründenden Ehe – besteht gemäß § 1569 grundsätzlich nicht. Es sei denn, ein Ehegatte ist „außerstande“, für seinen Unterhalt zu sorgen (siehe dazu die Übersicht 13).
Übersicht 13
Unterhalt nach Scheidung (§ 1569)
1. Grundsatz: Jeder sorgt für sich selbst (Grundsatz der Eigenverantwortung). Jeder muss eine angemessene Erwerbstätigkeit ausüben (§ 1574) entsprechend:
– seiner Ausbildung,
– seinen Fähigkeiten und einer früheren Erwerbstätigkeit,
– seinem Lebensalter
– und seinem Gesundheitszustand.
Die früheren Lebensverhältnisse sind zu berücksichtigen.
2. Ausnahme: Anspruch auf Unterhalt gegen den anderen Ehegatten auch nach einer Scheidung
– wegen Betreuung eines Kindes (§ 1570)
– wegen Alter (§ 1571) oder Krankheit / Gebrechen (§ 1572)
– bis zur Erlangung angemessener Erwerbstätigkeit (§§ 1573 / 1574)
– als „Aufstockungsunterhalt“ (§ 1573 Abs. 2)
– bei Ausbildung, Fortbildung, Umschulung (§ 1575)
– aus Billigkeitsgründen (§ 1576)
Ein geschiedener Ehegatte muss also seinen Unterhalt grundsätzlich selbst verdienen. Maßstab für die Aufnahme einer insoweit zu fordernden „angemessenen“ Erwerbstätigkeit sind dabei Ausbildung, Fähigkeiten, frühere Erwerbstätigkeit, Lebensalter und Gesundheitszustand. Nur (noch) zu „berücksichtigen“ sind dabei auch die (bisherigen) „ehelichen Lebensverhältnisse“ (§ 1574 Abs. 2). Ggf. besteht ein Unterhaltsanspruch nach § 1569 nur „nach den folgenden Vorschriften.“ Das heißt, dass zusätzlich zu § 1569 des Weiteren auch zumindest ein Tatbestand der §§ 1570 bis 1576 erfüllt sein muss.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.