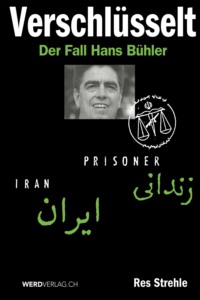Kitabı oku: «Verschlüsselt», sayfa 2
Bestochen habe er niemanden. Die beiden kleinen Geldbeträge, die er iranischen Bekannten gegeben habe, einmal 200000 Rial (umgerechnet vielleicht 200 Franken) für einen Medikamentenkauf kurz vor dem iranischen Neujahr zur Behandlung eines erkrankten Kindes, ein zweites Mal 20 000 Rial (20 Franken) für eine Taxifahrt nach einer unerwartet langen Sitzung, könnten angesichts der Dimension dieser Geschäftsabschlüsse doch nicht ernstlich als Bestechungsversuche gewertet werden. Und die Taggelder, die er iranischen Teilnehmern an Trainingskursen in der Schweiz ausgehändigt habe, seien im Rahmen der Kundenbetreuung üblich und auch ganz normal über das Buchhaltungskonto der Firma abgerechnet worden. Spionage schliesslich sei als Vorwurf völlig aus der Luft gegriffen.
B. zeigte sich zuversichtlich, dass sich die Dinge in den nächsten Tagen klären würden, er definitiv in die Schweiz zurückkehren und die Arbeit wieder aufnehmen könne. Ob die Firma trotzdem seine Frau und Tochter informieren könnte?
Sie mussten sich Sorgen machen, denn in den dreizehn Jahren ihrer Lebensgemeinschaft war er wohl hin und wieder verspätet nach Hause gekommen, aber nie, ohne zu telefonieren. Er hatte seiner Tochter zugesagt, dass er am Samstag, dem Besuchstag der Kantonsschule, auf jeden Fall da sein werde, und sie hatte in der Englischstunde wohl Zeichen gemacht in Richtung der Mutter: Wo bleibt er bloss? Jetzt ist er wieder nicht da, kein einziges Mal im Jahr kommt er, obwohl er doch immer wieder sagt, dass ihn meine Schule interessiere und dass Fremdsprachen wichtig seien! Und wer würde den Rasen mähen am Wochenende, wenn er nicht da war? Wenn es nur nicht die Tochter selber versuchen würde!
In diesen Gedanken und Befürchtungen war B. eingenickt. Noch im Traum sah er den Fuss der Tochter eingeklemmt zwischen den Messern des Rasenmähers. Vom Schrei der Tochter und den Koransuren geweckt, schreckte er hoch. Sein Zellenguckloch war schon geöffnet, eine Hand reichte Brot herein.
Beim folgenden Verhör gab B. die zwanzig beschriebenen Seiten ab. Noch während der Verhörer die Seiten überflog, bat B., unverzüglich in die Schweiz telefonieren zu dürfen. Firma und Familie würden sich grosse Sorgen machen, wenn er nicht auf dem gebuchten Flug sei. Falls ein Telefon in die Schweiz unmöglich sei, müsse jedenfalls das Schreiben an die Firma unverzüglich weitergeleitet werden.
Der Verhörer schwieg und las B.s Zellenaufzeichnungen zu Ende. Dann beschied er, dass ein solches Schreiben unmöglich an die Firma weitergeleitet werden könne. B. bat darum, wenigstens die Schweizer Botschaft in Teheran in einem kurzen Brief anzuweisen, seine Hotelrechnung zu begleichen. Der Betrag würde nach seiner Freilassung umgehend zurückerstattet. So war die Botschaft immerhin auch über seine Verhaftung orientiert, ohne dass sich B. gleich auf sein Recht auf einen Botschaftsbesuch berufen hatte, was ihm die iranischen Behörden nachteilig hätten auslegen können. Auch den Anspruch auf einen Verteidiger wollte B. vorderhand nicht stellen. Die iranischen Behörden wären ohnehin nicht darauf eingegangen und hätten ihn danach womöglich als abgebrühten Professionellen behandelt, der nichts ohne Anwalt macht. Es war ja noch immer denkbar, dass B. von einem Tag auf den andern freikam, wenn die Befrager alles wussten.
III
In aller Herrgottsfrühe wurde an B.s Zellentüre gehebelt.
«Birun», sagte der Gefängniswärter schroff – es war die Aufforderung herauszukommen. B. musste den Toilettenkübel leeren und Wasser nachfüllen. Er hatte in der ersten Woche seiner Gefangenschaft gelernt, dass das Farsi-Wort für «Heraus» völlig unterschiedlich gesagt wurde, je nach Wärter und auch Stimmung. Hiess es freundlich und melodiös «Biiiirun», so erhoffte sich B. einen Fortschritt seines Falles, womöglich hatte sich seine Unschuld inzwischen herausgestellt. Ein barsches «Birun!» verdarb ihm den ganzen Tag, schien neue Härten im Verhör und eine Verschärfung der Haftbedingungen anzukündigen.
B. ging hinaus und tastete sich mit Kübel, Krug und Frottiertuch Richtung Waschraum. Am besten konnte er sich orientieren, wenn er der Wand entlang ging. Bei Richtungswechseln zupfte ihn der Begleiter am Ärmel, bis sie am Ziel waren. Würde er genügend Zeit für seine Notdurft haben? Nach kurzer Zeit schon polterte der Wärter an die WC-Türe. B. erbat sich noch eine Minute, aber dann wurde schon wieder geklopft, und er brach ab. Verärgern wollte er die Wärter nicht, sonst wäre es wohl vorbei gewesen mit den freundlichen «Biiiirun» auf alle Zeiten.
Am Abend wurde B. unprogrammgemäss von ein paar Soldaten aus der Zelle geführt. Die Soldaten hatten Henkersmützen mit kleinen Sehschlitzen an, um nicht erkannt zu werden. B. erschrak – wo wollten sie hin mit ihm? Sie führten ihn in den Waschraum. B. wurde aufgefordert zu duschen. Während er duschte, vergnügten sich die Soldaten auf besondere Art: Einer signalisierte mit einfacher Handbewegung, dass B.s Kopf abgeschnitten würde, und dann begannen sie mit dem Kopf Fussball zu spielen – imaginär, einer jonglierte B.s Kopf ein paarmal gekonnt in der Luft und dann passte er ihn einem Kollegen zu, wie Jungen eben Fussball spielen.
Waren die Soldaten in den Henkersmützen übermütig? B. erschrak, einer hatte eine Rasierklinge in der Hand. Er reichte sie B. und forderte ihn auf, alle Körperhaare wegzurasieren. Wozu das? Hygiene oder Schikane? Hassten sie ihn, weil er Schweizer war? Ein paar Tage vor B.s Verhaftung war in der iranischen Presse gegen die Schweiz Stimmung gemacht worden. Die Schweiz habe einen unbescholtenen iranischen Staatsbürger verhaftet und beabsichtige, ihn nach Frankreich zu deportieren, wo seine Verwicklung in die Ermordung des Oppositionellen Schapur Bachtiar behauptet wurde. Vergeltungsmassnahmen gegen Schweizer waren angedroht worden. Womöglich hatte diese Scharfmacherei bei den Soldaten ihre Wirkung hinterlassen.
War B. ein weiteres Opfer der angedrohten Vergeltungsmassnahmen? Bereits war die Bewegungsfreiheit der schweizerischen Diplomaten in Teheran eingeschränkt und eine Schweizer Delegation des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz des Landes verwiesen worden. B. beeilte sich unter der Dusche, um möglichst rasch wieder in der Zelle zurück zu sein. War er gar Geisel, um die Auslieferung Sarhadis zu verhindern? Dann hätten sie ihn doch einfach aufs Eis legen können und nicht so auszuquetschen brauchen, wie sie das in den Verhören taten. B. war inzwischen klar, dass es in den kommenden Tagen und womöglich Wochen physisch und psychisch ums Überleben ging. Für ihn persönlich war der Ernstfall eingetreten.
Jetzt war soldatische Haltung gefragt, wie sie B. in der Bülacher Rekrutenschule bei der Übermittlungstruppe gelernt hatte. B. begann seinen Überlebenskampf straff zu organisieren. Morgens um drei Uhr wurde er geweckt. Danach erdröhnten die Koransuren. Kehrte Stille ein, so kniete sich B. zu seinen Gebeten nieder: ein Vaterunser für seine Frau, eines für die Tochter, eines für die Mutter, je eines für Bruder und Schwester, deren Partner und Kinder. B. kam so jeden Morgen auf zehn Vaterunser. Die erste Viertelstunde des Tages war vorbei. Er war als Bub Ministrant gewesen, seither aber kaum mehr in der Kirche. B. erbat sich nichts Spezielles in den Gebeten, sondern wollte einfach die Verbindung zu den Angehörigen aufrechterhalten. Dann musste alles richtig kommen.
Um sechs Uhr wurde Brot und Käse durchs Guckloch gereicht, ein- oder zweimal war Konfitüre im Brot. Noch bevor sich B. erlaubte zu frühstücken, absolvierte er sein Turnprogramm. Er plagte sich zunächst mit Liegestützen, ging langsam nach unten, blieb unten, bis es weh tat, und kam erst dann wieder langsam hoch, viermal mindestens. Dann horchte er, ob nicht Gefängnispersonal im Gang unterwegs war, und liess den Körper aus ordentlicher Distanz gegen die Wand kippen, so dass er sich verletzt hätte, wenn er nicht im letzten Moment die Arme zum Abstützen nach vorne gerissen hätte. Das wiederholte er zehnmal, um die Reflexe wachzuhalten. Danach ging B. zehnmal tief in die Hocke, bis die Gelenke knackten, blieb einen Moment unten und kam wieder hoch. Zum Schluss trabte er an Ort, zunächst langsam, dann schneller und immer schneller, bis zur totalen Erschöpfung nach vielleicht fünfzig Malen. Nach diesem Programm hatte B. richtig Hunger und freute sich auf das Frühstück.
Um sieben Uhr legte sich B. kurz hin. Das war seine schönste Stunde, nochmals kurz zu dösen, bis er um neun oder halb zehn Uhr zu den Verhören abgeholt wurde.
«Funkoffizier, arrangieren Sie, dass 007 heute abend an Bord kommt!»
Der Wunsch des deutschen Luxusjachtbesitzers war für B. Befehl. Das Schiff befand sich kurz vor dem Einlaufen in den Hafen von Marbella. Ein Gast auf der Jacht war Golflehrer und hatte dem Schauspieler Sean Connery einst Golfspielen beibringen müssen, damit er als James Bond auf dem Golfplatz neben Gert Fröbe keine schlechte Figur machte. Der Golflehrer hatte den Vorschlag gemacht, Connery zum Aperitif auf die Jacht einzuladen, und B. hatte diesen Auftrag übernehmen müssen. Das war ihm recht, denn B. war fasziniert von James Bond, seit er zu Beginn der sechziger Jahre «Liebesgrüsse aus Moskau» im Kino gesehen hatte. Aus der russischen Gesandtschaft in Istanbul wird eine Dechiffriermaschine vom Typ «Lektor» entwendet – inzwischen war dieses Filmszenario für B. Realität. Geheimdienste interessieren sich mit Vorliebe für Chiffriergeräte, dort sind die Schlüssel zum Abhören von Nachrichten. B. hatte Erfolg, Connery kam zum Aperitif pünktlich um acht Uhr, unterhielt sich angeregt mit Schiffspassagieren und Besatzung und wurde zwei Stunden später höflich hinauskomplementiert, denn für 22.00 Uhr hatte der Schiffseigner Nachtruhe und Lichterlöschen in den Gemeinschaftsräumen verordnet. Die Passagiere hatten sich auf ihre Kabinen zurückzuziehen und zu schlafen.
«Birun!» – B. wurde aus dem Traum aufgeschreckt und zu neuen Verhören gerufen. Was hätte er dafür gegeben, in der marineblauen Schiffsfunkeruniform aufzuwachen!
Auf dem Weg ins Verhörzimmer musste B. zusammen mit dem Gefängniswärter zwei Kontrollschleusen passieren und dabei jedesmal seine Gefängnisnummer nennen: «Zifer, yek, do, do, hascht – yek» (01228-1). Daraufhin wurden ihm Handschellen angelegt, und es ging über den Hof Richtung Verwaltungsgebäude. Dort musste B. zusammen mit anderen Gefangenen in einem Raum warten, bis ihn sein Verhörer abholte. Sprechen war auch hier strengstens verboten, oft mussten die Arme über dem Kopf an die Wand gehalten werden. Das ging jeweils zehn Minuten ganz gut, wurde dann aber zu einer harten Bewährungsprobe, so dass die Ankunft des Verhörers geradezu wie eine Erlösung empfunden wurde.
Trotzdem schien B. in den Augen seiner Befrager seine Lage noch immer nicht richtig begriffen zu haben. In der zweiten Woche der Verhöre wurde ihm vom Assistenten ein Blatt über die Schulter gereicht. B. wurde angewiesen, den handschriftlich geschriebenen Text genauestens zu lesen.
«Im Namen Gottes. Mister Hans, wir wollen, dass Sie realisieren: Sie sind in einem iranischen Gefängnis. Wir können Sie behalten, solange wir wollen. Die 52 US-Geiseln waren 1979/80 während 444 Tagen unsere Gefangenen. Sie waren Diplomaten. Sie, Mister Hans, sind kein Diplomat. Es hat keinen Sinn, weiter zu lügen.»
B. las die Sätze zweimal. Hatte er noch immer etwas verschwiegen? Wieder begann er zu einzelnen Anklagepunkten Stellung zu nehmen, schrieb eine Viertelstunde, ohne sich unterbrechen zu lassen. Die Befrager wurden ungeduldig, schauten ihm über die Schultern und wiesen ihn an, sich kürzer zu fassen, speziell, wenn sie feststellten, dass er dieselben Ereignisse schilderte wie in früheren Protokollen. Inzwischen hatte B. während der Verhöre und in der Zelle mehr als hundert Seiten beschrieben. Auffällig war, dass alle auf die Seite 1 folgenden Protokollbogen oben links mit der Seitenzahl 2 markiert waren. Sollte es damit möglich werden, einzelne Seiten aus den Akten zu entfernen?
Um die Gebetszeit am Mittag wurden die Verhöre jeweils unterbrochen. B. wurde in die Zelle zurückgebracht. Auf einem Tablett bekam er meist Reis, gedämpft mit irgendeiner Beilage, jeden Tag. B. ass vielleicht die Hälfte, je nach Stimmung tadelte ihn das Gefängnispersonal oder erkundigte sich nach seinem Befinden. Häufig brachte er keinen Bissen herunter, nicht weil das Essen eintönig war, sondern weil sein Magen nicht aufnahmebereit war. Die Angst sitzt im Magen – das wusste B. seit den ersten Tagen seiner Haft. Je grösser seine Besorgnis, um so grösser der Klumpen im Magen, der für nichts anderes mehr Platz liess. B. krümmte sich, turnte, tigerte in der Zelle auf und ab. Der Klumpen blieb.
Am Nachmittag gingen die Verhöre in der Regel weiter, ausser am Wochenende, nach dem islamischen Kalender Donnerstag und Freitag. B. hatte sich eine Strategie zurechtgelegt, um die Woche zu verkürzen. War das letzte Verhör am Mittwochnachmittag gut, so folgte am Donnerstag kein weiteres mehr. Dann war Wochenende. Am Samstag gingen die Verhöre wieder los, aber jetzt war Wochenende in der Schweiz. War Montag, so war schon bald wieder Mittwoch, und damit stand erneut das islamische Wochenende vor der Tür. Leider waren die Tage ohne Verhöre nicht einfacher durchzustehen als jene mit Verhören. Ein Morgen ohne Verhör bedeutete einen ganzen Morgen in der Zelle – die Stunden kamen B. vor wie eine ganze Woche. Am islamischen Sonntag hatten die Gefangenen ein Recht auf Unterhaltung, aus dem Lautsprecher im Gefängnisgang schepperte eine Komödie.
«Frau, wo bist du?»
«Ich komm’ ja schon, ihr Männer seid alle gleich!»
Es waren harmlose Szenen aus dem iranischen Alltag, aber fremdes Lachen verängstigte B. inzwischen genauso wie die Drohungen des Verhörers – vielleicht eine Folge des ersten Lachens seines Betreuers beim Verlassen der Zelle: «It is a prison!»
Zeitweilig gelang es B., seine eigene Unterhaltung zu organisieren. Vorab die Zeit als Schiffsfunker gab viel her.
«Funkoffizier, arrangieren Sie, dass Friseur Schmitz aus Wien am Dienstag nachmittag an Bord kommt!»
Der Friseur musste für den deutschen Schiffseigner generalstabsmässig nach Cannes geholt werden. Er wurde eingeflogen und hatte sich im Hotel bereitzuhalten. Auf exakte Anweisung des Schiffseigners war er um 14.55 Uhr abzuholen, auf direktem Weg zum Schiff zu bringen und hatte für 15.15 Uhr zum Haarschnitt bereit zu sein. Zehn Minuten später war der Spuk vorbei.
Mehr als zehn Minuten trug auch die Erinnerung nicht. An den Nachmittagen durfte B. meist eine Viertelstunde «Luft essen». Das hiess, im Innenhof zehn Meter mit Augenbinde auf- und abgehen, neben anderen, die ebenfalls Augenbinden aufgesetzt hatten. B. stellte sich den rundum von Gebäuden umrahmten Innenhof ähnlich vor wie jenen im Stockalperpalast von Brig, den er einst als Tourist besichtigt hatte. Um den geraden Weg zu halten und den anderen nicht in die Quere zu kommen, musste er sich an den Rillen im Boden orientieren. Ausserdem diente ein Drahtzaun, der den Innenhof in zwei Teile teilte, zur Orientierung. So war es möglich, dass mehrere Gefangene gleichzeitig «Luft assen».
Abends gab es meist wieder Reis und Suppe, hin und wieder wurde auch eine gekochte Kartoffel und ein hartgesottenes Ei durchs Guckloch gereicht. B. hatte Zahnschmerzen, weil sein Zahnarzt in Zürich eine Wurzelbehandlung kurz vor der Abreise nur provisorisch abschliessen konnte und das Provisorium nun hätte ersetzt werden müssen. Ausserdem hatte er Rückenschmerzen, hervorgerufen durch die harte Unterlage, schlief nachts kaum mehr und verlor innerhalb des ersten Monats nach und nach dreissig Kilo seines Körpergewichts. Der Klumpen im Magen war so gross geworden, dass er zeitweilig keinen Bissen mehr herunterbrachte. War das Zeitvertreib, dass er in der Zelle schon versuchte, Käfer zu jagen, oder hätte er die grosse schwarze Kakerlake wirklich gegessen, wenn er sie mit der Sandale erwischt hätte? B. wusste es nicht und war froh, dass sie es geschafft hatte, sich in der Wandritze in Deckung zu retten.
B. beneidete die Kakerlake dafür, dass sie sich verkriechen konnte. Was hätte er dafür gegeben, sich in ein Loch verkriechen zu können! Die Wolldecken schützten ihn zwar vor Blicken durch den Spion, wenn er sie über den Kopf zog und heulte wie ein kleines Kind, aber sie boten keinen Schutz vor dem «Birun!» B. versuchte sich unter den Wolldecken klein zu machen, krümmte sich wie ein Embryo in der Gebärmutter.
«Birun!» – hinaus ging es zu neuen Verhören.
Auf das stereotype «How are you?» des Verhörers antwortete B. inzwischen ebenfalls stereotyp und abwesend mit «Thank you». Als die Verhörer seine wachsende Nervosität feststellten, das ununterbrochene Fusswippen, und seinen Zusammenbruch befürchten mussten, führten sie ihn in die «Klinik» in einem Trakt im ersten Stock des Gefängnisses. B. erhielt auf einem Krankenbett eine Infusion mit einer weisslichen Flüssigkeit.
«Was wird mir gegeben?»
«Etwas, was dir gut tut», antwortete der Verhörer.
B. fragte nicht weiter, es war allein schon ein herrliches Gefühl, auf einem Bett zu liegen. Er versuchte Zeit zu schinden, solange es ging, verwickelte den Klinikarzt in ein Gespräch, fragte, ob er eine Familie habe und wie viele Kinder – ein Lieblingsthema, das Gespräche endlos ausdehnen konnte. Eine Weile unterhielten sie sich, aber dann war der Arztbesuch zu Ende. B. musste aufstehen und wurde hinausgeführt. Während fünf Tagen musste er nun morgens und abends in Anwesenheit eines Gefängniswärters Beruhigungs- und Schmerztabletten schlucken.
Nun konnte B. wenigstens wieder ein paar Stunden schlafen. Kein Zweifel, die Befrager wollten ihn bei Sinnen halten. Je länger die Verhöre dauerten, um so mehr rückte der Vorwurf der Spionage ins Zentrum des Befragerinteresses. Nachdem der Terminkalender, den er im Hotel liegen gelassen hatte, ausgewertet worden war, hielten sie B. der Reihe nach vor, Spion für Ägypten, China, die BRD und – als Krönung gewissermassen – für die USA zu sein.
«Ich bin kein Spion!» antwortete B. auf alle Vorhaltungen und schrieb stereotyp unter jede Aufzeichnung in diesem Zusammenhang: «I AM NO SPY!»
«Und was bezweckten die Telefonate mit Mexiko?»
B. hatte kurz vor seiner Verhaftung vom Hotel in Teheran aus nach Mexiko telefoniert, um sich zu vergewissern, dass das Ausstellungsmaterial für «America’s Telecom 92» rechtzeitig in Acapulco eintraf. Ausserdem hatte er im Dezember von Mexiko aus nach Teheran telefoniert, um sich bei der iranischen Vertretung der Firma nach Angeboten der Konkurrenz zu erkundigen. Das schweizerische Bundesamt für Aussenwirtschaft (Bawi) war entgegen seiner langjährigen Praxis nur noch bereit, Ausfuhrbewilligungen für die Geräte seiner Firma zu erteilen, wenn der Iran dieses Material auch aus anderen Ländern bekommen konnte. Chiffriergeräte galten zwar nicht als Kriegsmaterial, doch als strategisch wichtige Exporte unterlagen sie in Nato-Staaten und assoziierten Ländern wie der Schweiz strengen Ausfuhrbestimmungen. Der iranische Vertreter hatte B. am Telefon keine Auskunft geben wollen, weil solche Informationen von militärischer Bedeutung seien. Rechnete er damit, dass sein Telefon abgehört wurde?
«Sie haben militärisch geheime Informationen beschaffen wollen! Warum?»
B. versuchte den Verhörern die Änderung der schweizerischen Ausfuhrbestimmungen begreiflich zu erklären. Diese Information war Voraussetzung, dass die Firma überhaupt in den Iran liefern durfte!
«Warum wollten Sie wissen, wie viele militärische Fahrzeuge der verschiedenen Typen die iranische Armee hat? Das hat nichts mit den schweizerischen Ausfuhrbestimmungen zu tun!»
Solche Fragen hatte B. den iranischen Kaufinteressenten stellen müssen, wenn er Garantie leisten wollte, dass die Chiffriergeräte in den Fahrzeugen befestigt werden konnten. Die Firma musste die exakten Masse kennen, um zusätzliche mechanische Befestigungen anzubringen.
«Ich musste mich vergewissern, dass die Geräte nach der Lieferung montierbar waren. Andernfalls hätten sie die iranischen Kunden mit Schnüren anbinden müssen!»
B. konnte in solchen Phasen der Verhöre seine Wut nur schlecht verbergen. Der bedingungslose Einsatz für die Kunden und letztlich für die Sicherheit des Landes wurde ihm als Spionage ausgelegt! Er durfte sich keine Ungeduld anmerken lassen, wenn seinen Beteuerungen nicht geglaubt wurde.
«Haben Sie gewusst, dass der Vertreter Ihrer Firma in Teheran im Besitz einer Pistole war?»
«Ja, er hat sie mir einmal gezeigt. Es war alles korrekt, er hatte einen Waffentragschein und deponierte die Waffe bei Besuchen in Regierungsstellen stets bei der Sicherheitskontrolle am Gebäudeeingang.»
B. war froh, sich so ausführlich erklären zu können, das würde seiner Sache dienlich sein. Jedesmal, wenn B. in den Raum geführt wurde, wo er beim Gefängniseintritt seine Sachen hatte abgeben müssen, hegte er die Vermutung, dass seine Freilassung unmittelbar bevorstand. Jetzt werden sie dir gleich alles zurückgeben, dachte B., vielleicht steht schon der Gefängnisdirektor da und wünscht gute Heimkehr. Aber das eine Mal wurden ihm Fingerabdrücke genommen, ein zweites Mal hatte er in einen Stuhl zu sitzen und die Füsse an einen bezeichneten Ort zu stellen, damit ein Fotograf mit Henkersmütze und Sehschlitzen ein Bild schiessen konnte. Ein drittes Mal musste er seine exakte Adresse in der Schweiz aufschreiben und ein kleines Plänchen zeichnen, wie sie die Firma in der Schweiz finden konnten.
Wollten sie seine Kleider in die Schweiz zurückschicken? Oder gar seine Leiche?