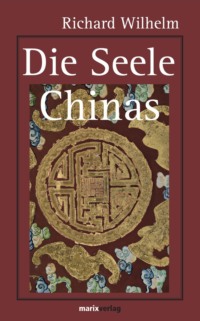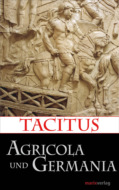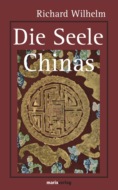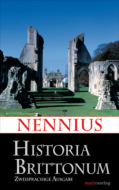Kitabı oku: «Die Seele Chinas», sayfa 4
Wenn nun aber der Seezoll als wirtschaftliche Behörde in China sehr gut gewirkt hat, so kann man doch, von einzelnen Ausnahmen abgesehen, nicht sagen, dass er als Keimzelle für die übrigen Reformeinrichtungen in Betracht gekommen wäre. Als wirtschaftliche, verhältnismäßig wohlbegrenzte Einrichtung vertrug er wohl zur Not die starke Selbstständigkeit der fremden Beamten, die der chinesischen Regierung gegenüber sehr souverän mit den von ihnen eingezogenen Geldern verfuhren. Auf anderen Gebieten hätte ein solcher Staat im Staate den Tod der chinesischen Unabhängigkeit bedeutet. Sir Robert Hart hat auch die Gelegenheit, die ihm bei der Begründung der Hochschule T’ung Wen Kuan in Peking gegeben war, nicht so benützt, dass daraus wirklich eine musterhafte Anstalt geworden wäre. Erst nach langen, schwierigen Arbeiten ist unter chinesischer Leitung allmählich die jetzige Peking-Universität an ihre Stelle getreten. Auch die Missionare konnten sich bei allem guten Willen häufig von den christlichen Beschränkungen nicht ganz los machen. Die von ihnen geleiteten Universitäten hatten alle die Tendenz, den Christen irgendwelche Prärogativen zu geben. Wo ein Einzelner weitsichtiger gewesen wäre, wurde er von den Übrigen aufs gehässigste angegriffen. So war der alte, ehrwürdige D. Martin, der ein gutes Wort für den Ahnendienst einzulegen wagte – der nebenbei bemerkt in Japan keine Missionsschwierigkeit gemacht hat –, lange Jahre hindurch verfemt und geschmäht.
Man musste irgendwie seinen Weg im Ungewissen vorantasten. Es entstanden Schnellpressen, um das nötige Lehrermaterial auszubilden. Ein Raritätenkabinett und Panoptikum unter Leitung eines englischen Missionars in Tsinanfu genoss allgemeine Hochachtung, und man nahm sogar die Predigten in Kauf, die man über sich ergehen lassen musste, ehe man zugelassen wurde zum Anblick der Wunder des Westens.
Daneben wurden Studenten ins Ausland geschickt, um dort die neue Wissenschaft an der Quelle zu trinken. Aber auch hierin herrschte kein System. Erst als Amerika den Überschuss der Boxerindemnität an China zurückgab, damit jährlich eine Anzahl chinesischer Studenten in amerikanische Universitäten geschickt werden, begann eine wirklich wissenschaftliche Ausbildung der chinesischen Jugend. Das aber war erst später. Zunächst wandte sich der große Strom der Lernbegierigen nach Japan. Man kann nicht sagen, dass Japan der ihm hieraus entstehenden Aufgabe gewachsen gewesen wäre. Allerdings muss man zugunsten Japans anführen, dass der Andrang die ordentliche Aufnahmefähigkeit der japanischen höheren Schulen bei Weitem überstieg. So mischte sich private Tätigkeit oft recht zweifelhafter Art in den Betrieb. Gleichzeitig waren die Sendboten der chinesischen Revolution unter den jungen Leuten tätig. Es gab mancherlei Konflikte, und schließlich kamen die meisten wieder zurück, nicht sehr wesentlich gefördert an Kenntnissen, aber reif für die Revolution.
Viertes Kapitel
Die Revolution
Während die Dinge in China immer chaotischer wurden, starb mit der Kaiserin-Witwe Tsi Hsi die einzige starke Persönlichkeit, die imstande gewesen war, die Verhältnisse nach einheitlichen Gesichtspunkten zu regeln und den Ehrgeiz einzelner Satrapen so weit zu dämpfen, dass keine Gefahr für die Gesamtheit erwuchs. Sie war es auch gewesen, die die Reformen gegen die sehr widerstrebenden Mandschukreise und ihren Anhang in der Hauptstadt mit großer Energie vertreten hatte. Bei dem ungeheuren passiven Widerstand dieser Leute, die naturgemäß ihre ganze Drohnenexistenz aufs Spiel gesetzt sahen, wenn die Reformen nicht wirksam sabotiert werden konnten, war ohne eine solche Persönlichkeit von ganz überragender Kraft nicht daran zu denken, dass etwas wirklich Gründliches sich durchsetzen werde.
Der Tod der Kaiserin-Witwe trat nach einer längeren Krankheit ein. Unmittelbar vorher starb ihr schwacher Neffe auf dem Thron. Man hat viel davon gesprochen, dass sie ihn, als sie ihren Tod herannahen fühlte, habe ermorden lassen. Beweise dafür sind nicht vorhanden. Der Kaiser war schon lange vorher gesundheitlich sehr herunter, und selbst wenn er ermordet worden ist, kann es von seinen Feinden und den Eunuchen geschehen sein, ohne dass sie einen Auftrag dazu hatten. Schon zu Lebzeiten haben sie ihn reichlich schlecht behandelt und oft lange vor dem Tor knien lassen, wenn er seine Tante besuchen wollte. So wäre es durchaus verständlich, dass sie nicht wünschten, nach dem Tod ihrer Herrin in seine Hände zu geraten und dass sie darum der Abwendung dieses Ereignisses künstlich nachhalfen. Jedenfalls aber schien die alte Herrscherin bei Erhalt der Nachricht eher erleichtert zu sein. Sie ging nun unverzüglich daran, ihren zweijährigen Großneffen, den Sohn des Prinzen Tschun, der als Sühneprinz in Deutschland bekannt ist, zum Kaiser ausrufen zu lassen, obwohl in dem Prinzen P’u Lun und dem Prinzen Kung zwei nähere Aspiranten vorhanden waren. Aber energisch bis zuletzt setzte sie ihren Willen gegen allen Widerstand durch, dann starb sie.
Man kann nicht sagen, dass dem Prinzen Tschun, der für seinen unmündigen Sohn zunächst die Regentschaft führen musste, eine leichte Aufgabe zugefallen war. Was der Energie der verstorbenen Fürstin schon schwer geworden war, wurde für ihn doppelt erschwert, da er nicht in der durch Jahrzehnte lange Gewohnheit befestigten Stellung war, die sie eingenommen hatte, vielmehr mitten im Streit der Intrigen drin stand, die namentlich im Prinzen P’u Lun einen Mittelpunkt hatten, der sich als eine Art von Citoyen Orléans aufspielte4.
Wenn das aber auch in Betracht gezogen werden muss, so kann man doch wohl sagen, dass ihm auch die Kräfte fehlten, die zu einer so heroischen Aufgabe gehörten. Der mächtigste Mann in China war damals Yüan Schï K’ai. Zwischen ihm und dem Throne aber stand der Schatten des verstorbenen Kaisers. Es heißt, dass dieser ein Schriftstück hinterlassen habe, das, fast unleserlich geschrieben, mit folgenden Worten begonnen habe:
»Ich war der zweite Sohn des Prinzen Tschun5, als die Kaiserin-Witwe mich für den Thron erwählte. Sie hat mich stets gehasst, aber an meinem Elend während der letzten zehn Jahre ist Yüan Schï K’ai schuld. Wenn die Zeit kommt, wünsche ich, dass er unnachsichtlich enthauptet wird.«
Dieses Schriftstück wurde zwar später von der Gemahlin des Kaisers beiseite gebracht, jedoch nicht, ohne dass es vorher von unabhängigen Zeugen gesehen worden war.6 Dem Prinzregenten blieb also nur die Wahl, entweder diesen letzten Wunsch seines toten Bruders auszuführen und Yüan Schï K’ai unschädlich zu machen oder über den Toten hinwegzugehen und Yüan Schï K’ai sein volles Vertrauen offen anzubieten. Er tat das Einzige, was unmöglich war: Er reizte den Löwen aufs Äußerste, ohne ihn wehrlos zu machen. Durch ein Edikt übertrug er Yüan Schï K’ai die Beerdigung des verstorbenen Kaisers. Natürlich fand sich niemand, der ihn des Mangels an Sorgfalt dabei anklagte. Infolge davon jagte der Prinzregent Yüan Schï K’ai schimpflich aus Amt und Würden, wie man etwa einen Hausknecht wegschickt. Yüan Schï K’ai verbiss den Groll. Er zog sich in seine Heimat in Honan zurück, hielt sich still und ließ Fotografien anfertigen, wie er im Strohmantel in ländlicher Umgebung den Freuden des Angelns sich hingab, fern von der großen Welt und ihrem Treiben. Die Fotografien verschenkte er an seine Freunde. Im Stillen aber hielt er seine Fäden in der Hand. Bei Hofe hatte er einen guten Freund im Senior des Kaiserhauses, dem Prinzen K’ing, mit dem er lange Hand in Hand gearbeitet hatte, und auch sonst hatte er an allen entscheidenden Posten seine Leute sitzen. So wartete er, bis seine Zeit gekommen war. Und diese Zeit kam.
Die Mandschu-Aristokratie benützte die neuen chaotischen Verhältnisse, um ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen. Die Reformen drängten sich. Es wurde eine Menge Geld ausgegeben und doch nichts Wirkliches erreicht. Diese Zustände führten zu einer weitgehenden Missstimmung im ganzen Reich. Die Beamten, die einer klaren und einheitlichen Leitung von oben her entbehrten, kamen unter all den verschiedenen sich drängenden Reformedikten, für deren Durchführung sie an Ort und Stelle Gelder aufbringen sollten, in die größte Verlegenheit. Die Bande der Autorität lösten sich immer mehr. Es ist kein Wunder, dass unter diesen Umständen, da die Regierungsmaschine versagte, die Vertreter des Volkes die Neugestaltung der Verhältnisse selbst in die Hand nehmen wollten. Man wollte selbst die Mittel aufbringen, die zum Bau von Eisenbahnen und Bergwerken notwendig waren, um auf diese Weise von fremden Kapitalien unabhängig zu werden und den drückenden Verpflichtungen zu entgehen, die mit einer Finanzkontrolle des Auslandes verbunden waren.
In Peking war ein Reichsausschuss zusammengerufen worden, der als vorbereitendes Parlament dienen sollte. Aber dieser Reichsausschuss, der unter dem Präsidium des Prinzen P’u Lun stand, hatte sich sehr bald recht oppositionell gebärdet: Beschleunigte Einführung der Verfassung, verantwortliches Ministerkabinett, Kontrolle der Staatsfinanzen durch die Volksvertretung und anderes waren Forderungen, die der Regierung manche schwere Stunde bereiteten und nur durch die Vertagung des Reichsausschusses zunächst zum Schweigen gebracht werden konnten.
Wenn durch Vertagung des Reichsausschusses eine rückläufige Bewegung einzusetzen schien, so war dasselbe der Fall mit der Finanzierung der industriellen Unternehmungen durch innere nationale Anleihen. Man traute diesen Unternehmungen nicht und so kam das nötige Geld nicht zusammen. Die Regierung ihrerseits wollte so wichtige Dinge wie die großen zentralen Bahnlinien auch nicht gern in private Hände übergehen lassen. So suchte man nach einem energischen Mann, der den verfahrenen Wagen wieder ins Geleis bringen sollte. Ein solcher Mann fand sich in dem »Eisenbahnkönig« Schong Hsüan Huai, einem früheren Mitglied des Kreises um Li Hung Tschang. Als dieser seinen Einzug in Peking gehalten hatte, schienen mit einem Male die alten Zeiten wiedergekommen zu sein. Es kam zu großen Anleihen mit den Vertretern der fremden Banken. Die zentrale Bahn von Hankou nach Kanton, die das ganze Reich von Norden nach Süden durchschneiden sollte, und die Bahn von Hankou nach Setschuan, die als Querlinie von jenem Zentrum aus in die westlichen Gebiete vordringen sollte, waren im Begriff, von diesen Anleihen gebaut zu werden.
Die Sache hatte nur einen Haken. Der Betrag der nationalen Anleihe, die für den Bau der Bahn zusammengekommen war, sollte wieder zurückgegeben werden. Dabei zeigte es sich, dass bedeutende Veruntreuungen vorgekommen waren und die Geldgeber lange nicht den einbezahlten Betrag zurück erhielten. So gärte es in der Tiefe weiter.
Dazu kam noch ein anderer Umstand. Schon seit Jahren war eine Revolutionspartei am Werk, die das, was dem Taipingaufstand misslungen war – die Beseitigung der Mandschudynastie – vollenden wollte. Es waren meist junge Studenten, die in Japan und Amerika moderne und republikanische Ideen in sich aufgenommen hatten. Abermals ein Kantonese Sun Wen (Sun Yat Sen), ursprünglich in einer Missionsanstalt als Arzt ausgebildet, war der Leiter dieser Bewegung. Vom Schicksal auf die mannigfaltigste Weise umhergetrieben, hatte er durch seinen Idealismus und den starken persönlichen Einfluss, der von ihm ausging, namentlich in der Jugend einen großen Anhang gewonnen, und bis zu seinem Tode hat er trotz aller Misserfolge und Rückschläge diesen Einfluss in den Herzen der Jugend nicht verloren. Denn er war der Einzige unter den öffentlichen Männern Chinas, der, wenn er auch nicht immer ganz auf der Höhe seiner Prinzipien stand, doch im Großen und Ganzen eine Idee bis zu seinem Tode vertreten hat. Diese Idee war einmal die nationalistische: China für die Chinesen, nicht für einen Kaiser, am wenigsten für einen aus fremdem Stamm wie die Mandschuherrscher, nicht für die Fremden zur Ausbeutung, sondern frei und selbstständig. Auch innerhalb Chinas sollte nicht ein Teil über den anderen herrschen – bisher hatte doch stets der Norden das Übergewicht gehabt, sondern gleichberechtigt sollten die verschiedenen Provinzen und Stämme einander gegenüberstehen, mit vollem Recht lokaler Selbstverwaltung, nur zusammengeschlossen zu einem Staatenbund, etwa nach amerikanischem Muster. Mit diesen politischen Gedanken verband er auch soziale. Eine Industrialisierung Chinas im großen Stil gehört zu seinem Programm, aber diese Industrialisierung soll so vor sich gehen, dass die Gedanken des Sozialismus dabei voll zu ihrem Recht kommen.
Diese revolutionären Ideen waren an sich dem chinesischen Wesen ganz fremd. Der nationale Gedanke war in China im Lauf der Geschichte längst überwunden worden. Im Altertum hatte es auf chinesischem Boden auch Nationalstaaten gegeben, die sich aus dem großen Feudalgebilde des heiligen chinesischen Reichs der Tschoudynastie heraus entwickelt hatten. Während der Jahrhunderte der »kämpfenden Reiche«, die der Zusammenfassung Chinas in eine Beamtenmonarchie unter Ts’in Schï Huang Ti (etwa 250 v. Chr.) vorangingen, hatte es nicht an nationaler Gesinnung und nationalen Kämpfen gefehlt. Aber das lag weit zurück. Längst war der Orbis terrarum, die Welt, als höchste Einheit an die Stelle der Nation getreten. Das hatte sich zunächst auch nicht geändert, als Europa in den Gesichtskreis Chinas eintrat. Man hatte von jeher gewusst, dass China nur das Mittelreich war, dass außen herum mehr oder weniger widerspenstige Barbarengebiete und Inseln lagen. Japan war als Seeräubernation schon lange bekannt, nun kamen noch andere dazu. Das war unangenehm, aber nichts Unerhörtes. Erst der Boxerkrieg hat mit diesen Vorstellungen aufgeräumt. Die jungen Studenten hatten entdeckt, dass es außer der alten chinesischen Welt noch eine andere, größere gebe. In dieser Welt war China eben eine Nation unter vielen, eine Nation groß an Gebiet und reich an Menschen, versehen mit fruchtbarem Land und Schätzen des Bodens mehr als irgendeine andere, und doch misshandelt und gequält von allen Seiten, verachtet und beiseite geschoben und an politischem Einfluss noch nicht einmal so mächtig wie die Schweiz. Alle diese Missstände wurden der Regierung zugeschrieben, die in den Händen eines ungebildeten, fremden Volksstammes sich befand, der in trägem Wohlleben am Mark des chinesischen Volkes zehrte. Daher kam jene Hassstimmung unter den jungen Leuten, die sich gleichmäßig gegen die Fremden wie gegen die eigene Regierung richtete. Die chinesischen Christen standen der Revolution durchaus sympathisch gegenüber. Viele der revolutionären Führer sind selber Christen, denn die christliche Kirche, besonders die evangelische, die unter sehr starkem amerikanischem Einfluss steht, stand dem Gedanken der Demokratie an sich nahe. Auch hatten die Christen so viel unter dem Druck der alten Regierung zu leiden gehabt, dass eine Umwälzung für sie Befreiung bedeutete.
In der Masse der Bevölkerung dagegen hatten die revolutionären Gedanken zunächst wenig Anklang gefunden. Der gute Bürger hielt sich fern von ihnen. Sie untergruben ja nicht nur die Autorität des Staates, sondern auch der Familie.
Aber die Revolutionäre gingen sehr aktiv vor. Gelegentlich veranstalteten sie lokale Unruhen. Sie fanden immer mehr Anklang bei der studierenden Jugend, auch mancher missvergnügte Beamte, der sich ungerecht behandelt fühlte, neigte im Stillen ihnen zu. Besonders unter dem Militär fanden sie Eingang. Dennoch verhielt sich die Regierung ihnen gegenüber zurückhaltend. Ihre ausgesprochene Fremdenfeindlichkeit war manchem Beamten in der Stille vielleicht gar nicht so unangenehm. Andere wieder wollten sich die Finger nicht verbrennen, da der Terrorismus, den sie ausübten, seinen Eindruck nicht verfehlte. Diese zögernde Haltung der Regierung vermehrte natürlich nur den Mut der Revolutionäre.
Zwei Umstände waren es, die ihnen schließlich in einer Weise, die selbst ein gesteigerter Optimismus nicht voraussehen konnte, Einfluss verschafften. Die Missernten der vorhergehenden Jahre hatten schwere Not über weite Gebiete Chinas gebracht. Missernten sind immer etwas Schlimmes. Die Masse der Bevölkerung, die nur eben existieren kann, wenn alles gut geht, kommt durch Missernten stets in Not. Viele gehen zugrunde. Andere suchen als Räuber ihr Leben zu fristen. Und es entsteht ein Murren gegen den Kaiser, der als Himmelssohn dafür verantwortlich ist, dass das Volk seinen Lebensunterhalt findet.
Das alles wirkte nun zusammen. In Setschuan brach ein Aufstand los. In Wutsch’ang erhob sich das Militär. Ein Offizier, Li Yüan Hung, wurde von seinen Truppen zum Führer der Bewegung erhoben.7 Der Aufstand verbreitete sich wie ein Lauffeuer.8 Die Luft war voll von Revolution, und ihre Gegner verloren die Besinnung. Die kaiserlichen Beamten haben zum größten Teil, soweit sie nicht offen ins revolutionäre Lager übergingen, ihre Stellungen fluchtartig verlassen. Sie wandten sich nach Hongkong, Schanghai, Tientsin und ganz besonders nach Tsingtau: überall dahin, wo sie vor dem Ansturm der Revolutionäre sicher sein konnten. Dieser fluchtartige Rückzug der Großwürdenträger ist eine sehr außerordentliche Erscheinung und ist ihnen von europäischer Seite vielfach als Feigheit ausgelegt worden. In Wirklichkeit lagen die Dinge anders. Ganz ähnlich wie die deutsche Revolution war die chinesische nicht nur ein Sieg der revolutionären Partei, sondern ein Zusammenbruch der Monarchie in sich selbst. Wo von oben her die klaren Direktiven fehlen, ist es den Beamten unmöglich, stark zu sein, weil sie keinen Augenblick sicher sind, wie weit sie in ihren Handlungen von der kopflos gewordenen Zentralregierung überhaupt noch gedeckt werden. Die chinesischen Beamten haben sich während der Revolution zurückgezogen und die konsequenteren unter ihnen verharren bis an ihr Ende in selbstgewählter Verbannung. Aber keiner von ihnen hat Memoiren veröffentlicht.
Allein die Sache der Dynastie war keineswegs verloren. Die Nordtruppen waren im Allgemeinen treu geblieben und begannen auf der ganzen Linie siegreich vorzurücken. Aber das lag nicht im Interesse des stillen Anglers Yüan Schï K’ai, dessen Weizen nun zu reifen begann. Er hatte nämlich bei Hofe seine Beziehungen. Als die Dinge nun gefährlich wurden, trat der alte Prinz K’ing, sein Freund, auf und sagte: »Wir brauchen einen starken Mann, und der einzige, der es kann, ist Yüan Schï K’ai. «
Diese Behauptung blieb nicht unwidersprochen. Man fürchtete sich vor ihm. Aber schließlich wurde er zurückberufen und sollte in Gemeinschaft mit den Generälen, die schon die ersten Waffenerfolge errungen hatten, das Weitere in die Hand nehmen. Er blieb zu Hause. Darauf wurde ihm die militärische Oberleitung im Aufstandsgebiet und der Posten eines Generalgouverneurs übertragen. Er versprach zu kommen. Gleichzeitig nahm er unter der Hand Kontakt mit den Führern des Aufstandes auf. Er wurde nach Peking berufen und zum Chef des neu zu bildenden Kabinetts ernannt. Da kam er.
Mit ein paar energischen Maßregeln brachte er den Norden, wohin die Revolution sich auch auszudehnen begonnen hatte, wieder in seine Hand. Er konstituierte ein Ministerkabinett aus den disparatesten Elementen, das nie zusammen getreten ist. Er berief eine konstituierende Versammlung, nachdem ein Waffenstillstand mit den Revolutionären abgeschlossen war. Diese Versammlung kam nicht zustande, da die Volksregierung ihrerseits in Schanghai tagte. Er rief die siegreich vordringenden Truppen zurück und begann mit der revolutionären Regierung zu verhandeln.
Was jetzt folgt, ist ein überlegenes Ränkespiel, wodurch bewirkt wurde, dass das Mandschuhaus schrittweise zum freiwilligen Verzicht auf den Thron bewogen wurde zugunsten Yüan Schï K’ais, während auf der anderen Seite der neugewählte Präsident der Republik China, Sun Yat Sen, auf den Präsidentenposten verzichtete, ebenfalls zugunsten von Yüan Schï K’ai. Dabei halfen ein englischer Gesandter und ein amerikanischer Missionar lebhaft mit. Denn die Stimmung des Auslandes war schließlich ausschlaggebend gewesen für die Entscheidungen des Hofes. Der Grund für diese Haltung lag darin, dass Yüan Schï K’ai einerseits der typische starke Mann und andererseits ehrgeizig und verräterisch war, so dass er alle Eigenschaften hatte, die dem Europäer die Größe des Staatsmanns auszumachen scheinen. Auf chinesischer Seite wurde er wesentlich anders beurteilt. In China gehört zu einem wirklich großen Staatsmann nicht nur überlegene diplomatische Geschicklichkeit, sondern vor allem eine großzügige, klar erkennbare moralische Persönlichkeit. Dafür war Yüan Schï K’ai zu zweideutig. Er hat, wie ein Chinese damals sagte, die Fahne, die ihm die Mandschudynastie anvertraut hatte und die er hochzuhalten versprochen hatte, weggeworfen mit der Begründung, dass auf diese Weise das Fahnentuch erhalten bleibe.
Yüan Schï K’ai ließ sich nun den Zopf9 abschneiden, hisste die neue fünffarbige10 Flagge der Republik an seinem Palast, und China wurde feierlich zur Republik erklärt. Man muss, wenn man gerecht sein will, zu seinen Gunsten sagen, dass sein Verrat nicht so schwer ins Gewicht fällt, als es scheinen könnte. Der regierende Prinzregent hatte sich wirklich den Dank Yüan Schï K’ais nicht verdient und dass er ihn schließlich im letzten Moment als Retter gesucht hat, geschah nicht aus Vertrauen zu ihm, sondern infolge der gänzlichen Ratlosigkeit. Yüan Schï K’ai hat immerhin »das Fahnentuch gerettet«. Er hat der regierenden Familie ein Otium cum dignitate, einen Ruheaufenthalt mit dem nötigen Einkommen verschafft, das solange ausbezahlt wurde, als die Mittel dazu da waren. Die Witwe des Kaisers Kuanghsü freilich, die von ihrer Tante keineswegs die Klugheit geerbt hatte, hat erst später gemerkt, um was es sich bei ihrem Verzicht auf den Thron eigentlich handelte. Sie hat sich dann tagelang unter heftigem Weinen vom Verkehr mit der Außenwelt abgeschlossen. Die Prinzen haben alle ihre Zustimmung gegeben, außer dem Prinzen Su, der später in Dalny starb, und dem Prinzen Kung, der sich nach Tsingtau zurückzog.
Außerdem muss anerkannt werden, dass Yüan tatsächlich damals der einzige Mann war, der Ordnung schaffen konnte und auch Ordnung geschaffen hat. Freilich hat er seine zuverlässigen Truppen bei Schanghai bei einer zweiten Revolution, die kurz danach ausbrach, dadurch ganz besonders in ihrer Treue gestärkt, dass er ihnen den zehnfachen Betrag der Bestechungsgelder bezahlte, der ihnen von gegnerischer Seite angeboten worden war. Er hat es zeitlebens verstanden, sich Freunde zu schaffen mit dem ungerechten Mammon. Auch Sun Yat Sen hat er durch Ernennung zum Fürsten und ein Monatsgehalt von 30000 Silberdollar mit dem Auftrag, für die Organisation des chinesischen Eisenbahnwesens zu sorgen, für längere Zeit zur Ruhe gesetzt. Seine Kunst bestand nicht weniger darin, dass er diese Gelder richtig verwandte, als darin, dass er sie stets in der nötigen Höhe zur Verfügung hatte. Dabei war er nicht kleinlich. Zu seinen erbittertsten Feinden gehörte Ku Hung Ming. Auf Chinesisch und Englisch hat er ihn in der Öffentlichkeit bekämpft und hat kein gutes Haar an ihm gelassen. Aber Ku Hung Ming gehört ein wenig zu der Gelehrtenbohème. Mit der Fähigkeit begabt, viel Geld auszugeben, hat er es doch verschmäht, auf schmutzige Weise Bestechungsgelder anzunehmen. So kam es, dass er in chronischen Geldnöten lebte. Yüan Schï K’ai hörte davon und ernannte ihn zum Erzieher seines Sohnes mit 500 Dollar Monatsgehalt. Er durfte nach wie vor gegen ihn schimpfen und nichts geschah, um ihm eine gemäßigte Sprache nahezulegen. Aber sein Schimpfen machte keinen Eindruck mehr, seit bekannt war, dass er im Dienste Yüan Schï K’ais stand.
Es wäre wohl alles gut gegangen, und Yüan Schï K’ai hätte wohl die Fähigkeit gehabt, das alte China in eine wohlorganisierte moderne Republik überzuführen, wenn er sich damit begnügt hätte, Präsident zu bleiben. Denn solange er das tat, stand er – wie man auch im Übrigen seine Handlungsweise beurteilen mag – auf legalem Boden. Allein er ging einen Schritt weiter und wollte Kaiser werden. Inwieweit das sein eigener Gedanke war, ob er sich nicht durch andere Einflüsse dahin hat treiben lassen, mag dahingestellt bleiben. Er ging auch dabei sehr klug vor, indem er die Initiative seinen Freunden zuschob und selber gleichsam nur gezwungen ihren Forderungen sich anbequemte.
Die Zeit für das Unternehmen schien nicht ungünstig zu sein. Der Weltkrieg war hereingebrochen, der auch in Ostasien seine Wellen warf. Yüan Schï K’ai ließ sich zwar nicht bewegen, in den Krieg aktiv einzugreifen – er war zu klug, um solchen uferlosen Gedanken sich hinzugeben – aber auf der anderen Seite fand er auf Seiten der fremden Mächte ein geneigtes Ohr, und schon wurde sein Sohn bei einem Empfang in der englischen Gesandtschaft als Kronprinz geehrt. Schritt für Schritt ging er dazu über, die Herrschaft in seine Hände zu bekommen. Eine neue Devise wurde geschaffen. Das Jahr 1915 sollte das erste der Periode »Hung Hsiän« sein. Yüan Schï K’ai selbst vollbrachte das kaiserliche Opfer am Himmelsaltar in Peking nach einem eigens für diesen Zweck zusammengestellten Zermoniell, das sich an gewisse Vorbilder aus der Hanzeit anlehnte. Freilich der Gedanke des Opfers wurde sehr stark in positivistischem Sinne abgewandelt. Während früher auf drei hohen Masten drei rote Laternen brannten in der Winternacht des Opfers, durch die das Göttliche im Himmel, auf Erden und im Menschen symbolisiert werden sollte, wurden die Lampen für den Himmel und die Erde beseitigt. Die kosmische Beziehung fiel weg aus dem Gottesdienst. Gott war nur noch ein symbolischer Ausdruck für den Genius der Menschheit, dem Yüan Schï K’ai seine Huldigung darbrachte. Wie sehr die Opfer ihren Sinn gewechselt hatten, geht auch schon daraus hervor, dass Yüan Schï K’ai im Panzerauto – aus Furcht vor Attentaten – unmittelbar vor dem Opfer ankam und auch ebenso verschwand, während früher die Herrscher zu dreitägigem Fasten in der Sänfte sich nach der Halle des Fastens begab.
Am schwierigsten war das Verhältnis zu Japan. Japan hatte durch die Bindung der Großmächte im Weltkrieg in Ostasien freie Hand bekommen, die es auch weidlich auszunützen suchte. Unter dem Vorwand, Tsingtau den Deutschen zu entreißen, marschierten die japanischen Truppen raubend und plündernd von Norden her quer durch die Schantunghalbinsel auf Tsingtau zu, stießen dann aber die Schantungbahn entlang nach der Provinzialhauptstadt von Schantung, Tsinanfu, vor, ehe sie daran dachten, Tsingtau ernstlich zu bekämpfen. Sie führten den Krieg gegen Deutschland lässig und ohne jede Begeisterung, stets darauf bedacht, sich eine Hintertür offen zu lassen für den Fall, dass Deutschland siege. Umso ungenierter suchte Japan dagegen China unter seine Herrschaft zu bringen. Yüan Schï K’ai war nie der Freund Japans gewesen und musste die Duldung für seine Pläne durch die 21 Bedingungen teuer bezahlen, die Japan dem chinesischen Staat auferlegte. Durch diese Bedingungen wollte sich Japan nicht nur in den Besitz der wichtigen Kohlenminen von P’ing Hsiang, der ungeheuer ausgiebigen Eisenminen von Taye am Yangtse und der Eisenwerke von Hanyang setzen, sondern China sollte auch auf allen anderen Gebieten, besonders dem militärischen, dem japanischen Staat rettungslos ausgeliefert werden. So übel waren die Machenschaften, dass die Japaner sie sogar ihren englischen Bundesgenossen in ihren wesentlichen Punkten zu verheimlichen für gut befanden. Noch bis auf den heutigen Tag wird der Tag, da die 21 Bedingungen oktroyiert wurden, als Tag nationaler Schmach in China begangen.
Dennoch gelang es Yüan Schï K’ai nicht, sein Ziel zu erreichen. In Yünnan entstand ein Aufruhr, der sich sehr rasch über das ganze Reich verbreitete. Provinz nach Provinz fiel ab, und schließlich blieb nichts übrig, als nach ein paar Monaten die Devise »Hung Hsiän« wieder abzuschaffen, und den Schritt vom Kaiser zum Präsidenten wieder zurück zu tun. Aber solche weltgeschichtlichen Schritte werden nicht ungeschehen gemacht. Wie um Wallenstein alles unsicher wurde und misslang, nachdem er offen sich seinem Kaiser entgegengestellt hatte, so wich nun der Erfolg von den Fahnen Yüan Schï K’ais, der ja in mehr als einer Hinsicht mit Wallenstein verglichen werden kann. Er starb schließlich, wie die Sage meldet, beunruhigt und gequält von den Geistern, die ihn nicht mehr losließen: Ein Mann mit gebrochenen Herzen.