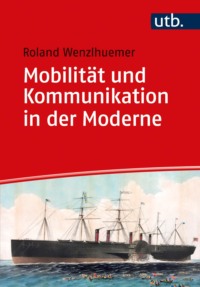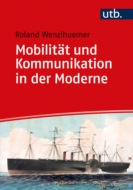Kitabı oku: «Mobilität und Kommunikation in der Moderne», sayfa 4
[24] Burke, Kulturgeschichte, S. 9.
[25] Landwehr, S. 11.
[26] Ebd., S. 8.
[27] Newton.
[28] Thompson.
[29] Burke, Kulturgeschichte, S. 15‒32.
[30] Geertz, S. 9
[31] Landwehr, S. 8.
[32] Daniel, Kulturgeschichte, S. 13.
[33] Ebd., S. 8f.
[34] Schivelbusch.
[35] Bayly, S. 451‒487.
[36] Rosa.
[37] Rieger.
[38] Bellmann.
[39] Herren-Oesch, Rüesch u. Sibille.
5. Globalgeschichtliche Perspektiven
Die Geschichtswissenschaft beschäftigt sich zentral mit dem Menschen als sozialem Wesen, das sich in den verschiedensten Formen von Gemeinschaften organisiert. Solche sozialen Gebilde gehen aus den Verbindungen bzw. aus den Austauschprozessen hervor, die Menschen untereinander unterhalten. Diese Verbindungen zwischen Individuen und Gruppen sowie ihre Entwicklung durch die Zeit sind Grundbeobachtungselemente einer Geschichtswissenschaft, die das Denken und Handeln historischer Akteure erklären und verstehen will. Allerdings ist dieses Interesse an sozialen Verbindungen für jede Wissenschaft vom Menschen so grundlegend, dass es kaum einmal explizit gemacht wird. Die Verbindungen, die Menschen bewusst und unbewusst zueinander unterhalten, können ganz unterschiedlicher Natur sein – emotional oder pragmatisch, freiwillig oder erzwungen, bereichernd oder belastend. Und sie können unterschiedlichste Distanzen überbrücken. Angeregt auch durch die Globalisierungserfahrungen, die viele Menschen seit dem ausgehenden 20. Jahrhundert in ganz intensiver Form machen, interessieren sich die Geistes- und Sozialwissenschaften mittlerweile zunehmend für Verbindungen, die sich über weite Entfernungen erstrecken und dabei räumliche, nationale oder kulturelle Grenzen überwinden. In der Geschichtswissenschaft hat sich in den letzten Jahrzehnten der Forschungsbereich der Globalgeschichte entwickelt, der sich spezifisch mit solchen globalen oder transregionalen Verbindungen und ihrer Rolle in der Geschichte auseinandersetzt.
Christopher Baylys grundlegendes Werk über die Geburt der modernen Welt trägt im englischen Original den Untertitel „Global connections and comparisons“.[40] Daran direkt oder indirekt anschließend ist in der Folge häufig der historiografischer Zugang der Globalgeschichte beschrieben worden, in dessen „Mittelpunkt […] grenzüberschreitende Prozesse, Austauschbeziehungen, aber auch Vergleiche im Rahmen globaler Zusammenhänge“[41] stehen würden, wie Sebastian Conrad es in seiner deutschsprachigen Einführung in die Globalgeschichte zusammenfasst. Patrick O’Brien hat dieselbe Definition in seinem Prolegomenon zur ersten Ausgabe des Journal of Global History im Jahr 2006 unternommen.[42] Versteht man den Vergleich als wissenschaftliche Methode und damit als ein Untersuchungsinstrument, so bleiben globale Verbindungen als grundlegende Untersuchungseinheiten der Globalgeschichte übrig. Sie sind die Bausteine für jede Form von transregionalem Kontakt, Austausch und Vernetzung. Ein zentrales Interesse der globalhistorischen Forschung gilt dabei Fragen nach der Entstehung solcher Verbindungen und nach ihrer Bedeutung für die historischen Akteure. Sie werden als geschichtsmächtig identifiziert und hinsichtlich ihrer Bedeutung innerhalb der wirtschaftlichen, sozialen oder kulturellen Entwicklungszusammenhänge einer bestimmten Region oder Zeit untersucht. Im Zentrum eines solchen Zugangs steht die Überzeugung, dass wir das Denken und Handeln historischer Akteure – und damit die Geschichte selbst – nicht verstehen und erklären können, wenn wir nicht auch die überregionalen Verbindungen, ihre lokalen Manifestationen und deren Zusammenspiel untersuchen.
Transregionale Verbindungen sind somit die Grundbeobachtungselemente der Globalgeschichte. Dass die Mobilität von Menschen, Waren und Informationen in diesem Zusammenhang ganz entscheidend ist, bedarf kaum einer weiteren Erklärung. Transport- und Kommunikationsmittel sind die Träger globaler Verbindungen. Sie etablieren und unterhalten globale Konnektivität. Das Studium von Transport- und Kommunikationstechnologien, ihrer Entwicklung und ihrer Nutzung spielt daher für die Globalgeschichte eine grundlegende, kaum zu hintergehende Rolle. Das Interesse der Globalgeschichte beschränkt sich dabei nicht auf Mobilitätspraktiken von potentiell weltumspannendem Charakter wie zum Beispiel der Dampfschifffahrt oder der Telegrafie. Sie blickt genauso auf Verkehrs- und Kommunikationsmittel, die in regionalen oder nationalen Kontexten zur Anwendung kamen, insgesamt aber in größere Mobilitätszusammenhänge und globale logistische Ketten eingebettet waren. Die Eisenbahngeschichte hält diesbezüglich besonders viele anschauliche Beispiele bereit, wie etwa in Kapitel III.1 zu sehen sein wird.
Die globalhistorische Beschäftigung mit Mobilität und ihren Trägermedien ist dabei von einem Verständnis globaler Verbindungen geprägt, das zunehmend analytischer und differenzierter wird. Lange wurden auch in der Globalgeschichte Verbindungen hauptsächlich von ihren Enden her gedacht. Untersuchungen fokussierten auf die Menschen, Orte oder Dinge, die in Verbindung miteinander standen oder in Verbindung gebracht wurden. Dort suchte man nach den Effekten von Kontakt und Austausch und studierte selbige als Faktoren menschlichen Denken und Handelns. Der Schwerpunkt solcher Arbeiten lag hauptsächlich auf dem Verbundenen, nicht auf der Verbindung selbst. Verbindungen wurden oft als quasi neutrale Zwischenglieder gesehen. Zudem war die globalgeschichtliche Forschung lange vor allem auf den Nachweis einer Verbindung zwischen Gegenständen konzentriert, die man bisher als nicht verbunden wahrgenommen hatte. Das hieß in der Praxis häufig, dass globale Verbindungen binär gedacht wurden, als existent oder nicht existent. Mittlerweile hat sich der Blick der Globalgeschichte auf ihre hauptsächlichen Untersuchungseinheiten aber verfeinert. Aktuelle Studien nehmen globale Verbindungen als eigenständige historische Phänomene ernst, die einen eigenen Raum und eine eigene Zeit aufweisen. Sie sind bemüht, Verbindungen als Mediatoren zu betrachten, die selbst einen prägenden Einfluss auf die jeweiligen Austauschprozesse und damit auf das Verbundene haben. Außerdem hat die globalhistorische Forschung erkannt, dass ein binäres Verständnis von Verbindungen der Komplexität historischer Sachverhalte nicht gerecht werden kann. Verbindungen treten immer im Plural auf und verhalten sich zueinander. Beziehungen zwischen einzelnen Akteuren und deren Gemeinschaften basieren immer auf einem ganzen Bündel verschiedener Verbindungsformen.
Die Globalgeschichte fragt daher nicht bloß, welche Transport- und Kommunikationssysteme globale Vernetzung ermöglichen, sondern sie interessiert sich für die verschiedenen Formen von Mobilität, die sich daraus ergeben. Die Art und Weise, wie Verbindungen als Mediatoren wirken, speist sich zu einem großen Teil aus den Mobilitätsformen, die diese Verbindungen stützen. Dampfschiffpassagen können hier als Beispiel dienen. Im späten 19. Jahrhundert dauerte eine Atlantiküberfahrt auf einem Dampfer zwischen sieben und zehn Tage. Zwischen Europa und Asien war man mehrere Wochen unterwegs, nach Australien gerne zwei Monate und mehr. Während dieser Zeit lebten Passagier und Crew auf dem engen Raum des Schiffes zusammen und waren in ein besonderes soziales Gewebe eingebunden. Die Schiffspassage war für viele ein entsprechend prägendes, einschneidendes Erlebnis, das ihre Sicht auf Abfahrts- und Ankunftsort veränderte. Der Schiffsverbindung fiel damit die Qualität eines Mediators zu. In abgeänderter Form lässt sich das für jede mediatisierte Verbindung festhalten. Ähnlich ist es hinsichtlich der Pluralität von Verbindungen, die sich ebenfalls in unterschiedlichen Mobilitäten widerspiegelt. Um bei diesem Beispiel zu bleiben, kann man sagen, dass eine Dampfschiffpassage ihren besonderen Charakter erst in der Zusammenschau mit anderen Formen von Transport und Kommunikation bekommt. Sie war eingebettet in ein Ensemble von Segelschiffüberfahrten, weltweiten Telegrafenkabeln oder auch der Unmöglichkeit anderer Verbindungen, die Wasserflächen nicht überqueren können. Die Dampferpassage hat eine bestimmte Rolle in diesen vielfältigen Verbindungsbündeln. Die Globalgeschichte will auch dieser spezifischen Bedeutung in der Pluralität von Verbindungen nachspüren.
Die Fragen, die sich daraus für die Globalgeschichte ergeben, sind vielschichtig. Die Freilegung historischer Transport- und Kommunikationsstrukturen von globaler Bedeutung und die Frage nach ihrer Funktionsweise und ihrer Leistungsfähigkeit spielen eine grundlegende Rolle. Vor allem aber interessiert sich die Globalgeschichte dafür, welches Potential als Mediatoren bestimmte Mobilitätstechnologien und -praktiken entfalten konnten. Wie haben sie den Charakter einer Verbindung mitgeformt? Welche Inhalte wurden hauptsächlich transportiert bzw. gegenüber anderen Inhalten privilegiert? In welche technologisch-sozialen Ensembles waren bestimmte Transport- und Kommunikationssysteme eingebettet? Gerade diese letzte Frage ist beispielsweise auch in Valeska Hubers anschaulicher Studie zur Geschichte des Sueskanals von entscheidender Bedeutung. Darin findet Hubers zu Beginn dieses Kapitels bereits erwähntes Konzept der multiple mobilities konkrete Anwendung im Rahmen einer klar umrissenen Fallstudie. Die Historikerin untersucht den 1869 eröffneten Sueskanal, der gemeinhin als verkehrstechnische Entwicklung von größter Bedeutung gilt, aus einer weniger fortschrittsorientierten, differenzierten Perspektive. Sie zeigt, wie der Kanal durch die Verkürzung der Route zwischen Europa und Asien Transport- und Kommunikation beschleunigte, gleichzeitig aber selbst zu einer Zone der Entschleunigung oder teilweise sogar des Stillstands wurde. Huber zeichnet die Beziehungen der Dampfschifffahrt durch den Kanal zu anderen Formen des Transports wie zum Beispiel Kamelkarawanen oder einheimischen Dhaus nach. Dadurch ebenso wie durch die Betonung verschiedenster Reisearten und -erfahrungen durch den Kanal bringt sie Leben in ihre Idee multipler Mobilitäten und kann eindrucksvoll zeigen, dass der Sueskanal den Schiffsverkehr eben nicht nur vereinfacht und beschleunigt, sondern auf viel komplexere Weise geprägt hat.[43]
Ein anderes Beispiel für eine globalgeschichtliche Auseinandersetzung mit Transport und Kommunikation findet sich in meiner eigenen Arbeit zur Entstehung eines globalen Telegrafennetzwerks im 19. Jahrhundert. Darin habe ich zum einen versucht, die Struktur dieses Netzes nachzuzeichnen und herauszuarbeiten, was es hieß, telegrafisch angebunden zu sein oder nicht. Darüber hinaus wollte ich aber vor allem wissen, was globale telegrafische Kommunikation verbindungsgeschichtlich bedeutet hat, welche Informationen eigentlich telegrafisch übermittelt wurden und welche nicht, welche unmittelbaren Auswirkungen eine solche Auswahl und die damit verbundene Komprimierung der versendeten Inhalte hatte. Es hat sich im Verlauf der Untersuchung herausgestellt, dass telegrafische Verbindungen einen ganz deutlichen Charakter als Mediatoren hatten und durch ihre spezifische Funktionsweise nachhaltig auf die übermittelten Inhalte und deren Wahrnehmung durch die Korrespondenten wirkten.[44]
Es versteht sich von selbst, dass keine der vier hier vorgestellten Perspektiven auf die Geschichte der Mobilität die eine richtige ist; dass keine Forschungsrichtung wichtigere oder relevantere Fragen stellt als ein andere. Die Liste der bestenfalls kursorisch vorgestellten Ansätze und der Versuch, deren Zugang zur Mobilitätsgeschichte aus ihren breiteren Erkenntnisinteressen herzuleiten, müssen exemplarisch bleiben. Es geht nicht darum, einen vollständigen Überblick darüber zu geben, aus welchen Winkeln man auf die Geschichte von Transport und Kommunikation blicken kann, um am Ende dann ein möglichst komplettes Bild zu haben. Viel wichtiger ist es nachzuzeichnen, auf wie vielen unterschiedlichen Ebenen ein analytisches Verständnis der menschlichen Mobilität, ihrer historischen Entwicklung, der technischen Grundlagen und der verwobenen kulturellen Praktiken für das Verständnis menschlicher Gesellschaften grundlegend ist. In diesem Zusammenhang wurden hier nur vier exemplarische Zugänge vorgestellt. Jenseits dieser Auswahl sind aber viele andere Fragenkomplexe aktuell und hochrelevant. Die Umweltgeschichte interessiert sich für den historischen Zusammenhang zwischen Mobilität, Natur und Umwelt. Fragen der Nutzbarmachung von Energiequellen sind hier beispielsweise von zentraler Bedeutung. Die Emotionsgeschichte wiederum untersucht die emotionalen und psychopathologischen Auswirkungen von Mobilität und greift damit ein für das frühe 21. Jahrhundert hochaktuelles Thema auf. All diese und viele andere Zugänge zur Geschichte der Mobilität seit dem 18. Jahrhundert werden in den folgenden Kapiteln immer wieder in miteinander verwobener Form auftauchen. Sie zeugen von der Prägekraft und historischen Wirkmächtigkeit des Gegenstands.
[40] Bayly.
[41] Conrad, Globalgeschichte, S. 9.
[42] O’Brien, S. 4.
[43] Huber, Channelling Mobilities.
[44] Wenzlhuemer, Connecting.
III. Themen und Untersuchungsgegenstände
1. Verregelmäßigung
1.1 Nach Fahrplan
Der britische Offizier und Ingenieur Henry W. Tyler (1827–1908) war ein gefragter Mann. Seine technische und organisatorische Expertise wurde in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts viele Male in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen eingeholt. Als Mitglied der Royal Engineers assistierte er bei der Organisation der Großen Weltausstellung 1851 in London. Im Jahr 1867 überprüfte er nach einem Choleraausbruch in der britischen Hauptstadt die Londoner Wasserversorgung. Im Hauptberuf aber war Tyler Eisenbahninspekteur. In dieser Funktion wurde er 1866 vom britischen Postmaster-General Lord Stanley auf eine Inspektionsreise durch Frankreich und Italien geschickt. Tyler sollte auf dieser Reise nach der schnellsten und verlässlichsten Route für die so genannte Eastern Mail , also für die Post zwischen Großbritannien und der Kolonie Indien, suchen. Wie Tyler in seinem offiziellen Bericht später auch ausführte, war in den 1860er-Jahren seit langem klar, dass diese Postroute nicht um das Kap der Guten Hoffnung führen würde, sondern über das europäische Festland, das Mittelmeer und Ägypten.[1] Es war absehbar, dass die in den nächsten Jahren bevorstehende Eröffnung des im Bau befindlichen Sueskanals die Effizienz dieser Route nochmals steigern würde. Die Aufgabe des Inspekteurs war es vor allem, die beste Routenführung durch Europa zu erheben. Er machte sich zu diesem Zweck unter anderem ein Bild von den Eisenbahnnetzwerken in Frankreich und Italien sowie von den Transferhäfen, in denen der Umstieg auf das Dampfschiff nach Ägypten erfolgte. Für Tyler war bald klar, dass die schnellste und berechenbarste Route nicht länger über Frankreich und den französischen Hafen Marseille verlief, sondern dass der Ausbau des Eisenbahnnetzes den Weg über Frankreich, Italien und den italienischen Hafen Brindisi mittlerweile attraktiver gemacht hatte. Tyler hielt in seinem Bericht fest, dass die Post auf dieser Route etwa 35 Stunden schneller transportiert werden konnte als über Marseille[2] – und dies trotz der Notwendigkeit, die Alpen zu überqueren. Die Querung der Alpen, die seit jeher ein formidables Kommunikationshindernis darstellten, schreckte Tyler nicht. Bisher hatte die Post auf dieser Strecke zwar für die Passquerung auf eine Kutsche umgeladen werden müssen, was nicht nur zu erheblichen Verzögerungen, sondern insbesondere bei widrigen Witterungsverhältnissen zur völligen Unberechenbarkeit der Transportzeit geführt hatte. Aber als Tyler 1866 seinen Bericht verfasste, baute man bereits seit längerem an einem Eisenbahntunnel und noch nicht ganz so lange an einer Passeisenbahn, mit Hilfe derer die Alpen am Mont Cenis gequert werden sollten. Tyler wusste, dass die Fertigstellung beider Unternehmungen in den kommenden Jahren erfolgen würde und damit eine schnelle, vor allem aber eine pünktliche und berechenbare Alpenquerung möglich wurde. Mit dieser Regelmäßigkeit und Berechenbarkeit wurde die Route über die Alpen nach Brindisi für Tyler endgültig zur bestmöglichen. Denn wie auch in der Schlusspassage seines Berichts deutlich wird, ging es dem Eisenbahninspekteur natürlich auch um die Geschwindigkeit des Posttransports, vor allem aber sorgte er sich um dessen Verlässlichkeit und Planbarkeit. Tyler hielt explizit fest, dass seinen diversen Routenberechnungen jeweils nicht die schnellstmögliche Transportgeschwindigkeit zugrunde liegt, sondern eine, die Pünktlichkeit erlauben würde. „[I]t was desirable to fix, not the shortest time in which the journey could be performed, but such rates of speed as would admit of punctuality.“ [3]
Henry W. Tylers Bericht über die Postroute zwischen Großbritannien und Indien und insbesondere seine Ausführungen zur Querung der Alpen sind instruktiv. Der Mont Cenis, der seit jeher Verkehr und Kommunikation zwischen Savoyen und dem Piemont behinderte, wurde im Laufe des 19. Jahrhunderts von einem regionalen zu einem globalen Verkehrshindernis. Die Überwindung des Bergmassives wurde zu einem Glied in einer langen logistischen Kette zwischen Europa und Asien. In dieser Kette ging es zum einen um interne Abstimmungen zwischen den einzelnen Teilstrecken und Transportmitteln, also zum Beispiel um gut getaktete Umladungen bzw. Umstiege zwischen Eisenbahn und Dampfschiff. Um eine möglichst hohe Abstimmung zu erreichen, mussten die einzelnen Streckenlaufzeiten reproduzierbar und damit vorhersehbar sein. Zum anderen spielte aber auch die Schnelligkeit und Berechenbarkeit der Gesamtstrecke eine große Rolle. Die Korrespondenten wollten schnell und möglichst direkt kommunizieren. Sie wollten vor allem aber auch einschätzen können, wann ihre Briefe den weit entfernten Adressaten erreichen würden bzw. wann mit Antwort gerechnet werden durfte. Eine schnelle und verlässliche Postroute, auf der im Übrigen auch Reisende verkehrten, würde für sie die Tücken und Unsicherheiten der großen Entfernung bezwingen.
Beschäftigt man sich mit der Geschichte von Kommunikations- und Transportprozessen, so treten die zunehmende Schnelligkeit (also die Beschleunigung) sowie die höhere Regelmäßigkeit (und damit die Berechenbarkeit) von Verbindungen als zwei zentrale und immer wiederkehrende Motive auf. Beiden spielen eine grundlegende Rolle. Zwar hat das Motiv der Beschleunigung in der historischen Forschung zumeist mehr Aufmerksamkeit bekommen, dem Prozess der Verregelmäßigung kommt aber zumindest gleichwertige Bedeutung zu. Beide Entwicklungen werden in der Kommunikations- und Transportgeschichte üblicherweise mit dem Einsatz von Dampfkraft im Verkehrswesen assoziiert und demnach insbesondere mit dem Aufkommen der Eisenbahn und der Dampfschifffahrt verbunden. Tatsächlich wurden mit der Dampftechnologie und diesen neuen Verkehrsmitteln im Laufe des 19. Jahrhunderts, sowohl was die durchschnittliche Geschwindigkeit, aber auch was die Regelmäßigkeit und Planbarkeit von Transportprozessen angeht, neue Sphären erreicht. Wie dies teilweise bereits im einleitenden Beispiel von der Postroute zwischen Großbritannien und Indien deutlich wurde, machte der Einsatz von Dampfkraft die Feinabstimmung langer logistischer Ketten möglich, erlaubte die genaue Berechenbarkeit von Ankunftszeiten sogar auf globalen Transportrouten, sorgte für die flächendeckende Durchsetzung und Abstimmung von Fahrplänen und Kursbüchern oder führte zu Vereinheitlichungsprozessen etwa bei der Zeitmessung. Eisenbahn und Dampfschiff stehen in besonderem Maße für diese Entwicklung. Die Dampfkraft und im Falle der Eisenbahn auch die Fortbewegung aus der Schiene erlaubten gleichermaßen Geschwindigkeit wie auch Gleichmäßigkeit in der Fortbewegung.
Allerdings kam es in dieser Hinsicht bereits lange bevor sich der Dampfantrieb im Verkehrswesen etablierte, zu zahlreichen vorlaufenden Entwicklungen. Seit dem 16. Jahrhundert können wir in Europa eine Zunahme sowohl der Geschwindigkeit von Transport- und Kommunikationsprozessen wie auch von deren Regelmäßigkeit beobachten. Der Historiker Wolfgang Behringer hat sogar die These aufgestellt, dass die frühneuzeitlichen Neuerungen im Transport- und Kommunikationswesen die „Mutter aller Kommunikationsrevolutionen“[4] gewesen und in ihnen alle wesentlichen Entwicklungen späterer Phasen bereits strukturell angelegt gewesen seien. Dieser Anspruch erscheint etwas überzogen. Es ist aber durchaus festzuhalten, dass das frühneuzeitliche Europa insgesamt wohl kommunikativer und mobiler gewesen ist als das die historische Forschung lange Zeit gesehen hat. Der Kontinent stand nicht nur im Austausch mit altbekannten oder kürzlich entdeckten außereuropäischen Gebieten, vor allem innerhalb Europas gab es ein gesteigertes Maß an Mobilität und Kommunikationsbedarf. Truppen wurden verlegt, Gläubige pilgerten oder flohen vor Verfolgung, Händler machten Geschäfte, Menschen suchten anderswo nach Arbeit.[5] Neue Kommunikations- und Transportmöglichkeiten ermöglichten bzw. begleiteten diese Entwicklung. Eine ganz zentrale Rolle spielt in dieser Hinsicht die Entstehung des frühneuzeitlichen europäischen Postwesens, das auch in Behringers Argumentation das wichtigste Beispiel darstellt.
Herrschaftliche Botensysteme gab es bereits in der Antike. Am bekanntesten ist wahrscheinlich der cursus publicus der Römischen Kaiserzeit, den Augustus zur Kommunikation mit den Provinzen ins Leben gerufen hatte. Solche Nachrichtenübermittlungssysteme funktionierten üblicherweise auf der Basis von Wechselstationen, an denen Boten oder Pferde getauscht wurden. Sie waren dadurch verhältnismäßig schnell und zuverlässig, gleichzeitig aber auch teuer im Unterhalt und der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Eine Öffnung solcher Kommunikationssysteme für die Allgemeinheit kam erst mit der schrittweisen Einrichtung eines öffentlichen Postsystems in der Frühneuzeit, das sich in seinen strukturellen Grundlagen an den herrschaftlichen Systemen orientierte und ebenfalls mit der „Portionierung des Raumes“[6] durch Wechselstationen und Botenstafetten arbeitete. An der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert übernahm die aus der Lombardei stammende Familie de Tasso (dt. von Taxis) auf Geheiß von Maximilian I. (1459–1519) die Organisation der Habsburgischen Hofpost, die zunächst zu in mehreren Postverträgen festgehaltenen Bedingungen die wichtigsten habsburgischen Herrschaftszentren miteinander verband. Zur Finanzierung dieses teuren Systems begannen die Taxis, das herrschaftliche Kommunikationssystem für andere Nutzer zu öffnen. Gegen ein so genanntes porto [7] konnten seit Karl V. (1500–1558) nun auch Privatleute Nachrichten verschicken. Im Laufe des 16. Jahrhunderts setzte sich die Hofpost gegen andere Angebote, zum Beispiel von einzelnen Städten unterhaltene Botenanstalten oder auch die so genannte Metzgerpost, durch.[8] Im Jahr 1597 wurde die Habsburgerpost zur Reichspost des Heiligen Römischen Reiches, die unter einem kaiserlichen Postregal schnell und verlässlich Nachrichten beförderte.
Während herrschaftliche Postkommunikation nach Bedarf erfolgte, machte die Öffnung des Systems für private Nutzer auch eine gewisse Regelmäßigkeit der Nachrichtenbeförderung notwendig. Die Einrichtung der so genannten Ordinari-Post, also von Postkursen mit fixierten, zu Beginn meist wöchentlichen Abfahrtszeiten, trug dem Rechnung. Behringer spricht bereits für das Jahr 1534 von einem ersten Ordinari-Kurs zwischen Augsburg und Antwerpen, eine Vermehrung solcher Kurse innerhalb des Reiches fand aber vor allem im Laufe des 17. Jahrhunderts statt. Im frühen 18. Jahrhundert war das Kursnetzwerk der Ordinari-Post im Reich soweit verdichtet, dass an allen größeren Orten ein regelmäßiger Postverkehr bestand.[9] Auch wenn selbst im frühen 19. Jahrhundert noch manche Zeitgenossen über die Effizienz der Post klagten oder sich – wie etwa Ludwig Börne 1821 in seiner „Monographie der deutschen Postschnecke“[10] – darüber lustig machten, so handelte es sich dabei um ein schnelles und weitestgehend verlässliches System zur Nachrichtenbeförderung. In anderen Ländern setzte die Entwicklung eines öffentlichen Postwesens mit Verzögerung ein und orientierte sich zum Teil an der kaiserlichen Reichspost. In Frankreich und England fand eine Öffnung des herrschaftlichen Kurierwesens erst ab den 1620er-Jahren statt. Dafür wurden in Frankreich bereits um 1630 erstmals Postkutschen auf festen Kursen eingesetzt, die neben der Post auch Personen beförderten. Diese so genannten Fahrposten breiteten sich vor allem nach dem Dreißigjährigen Krieg auch im Heiligen Römischen Reich aus. Solche Postkutschen wurden von der Reichspost auf wichtigen Strecken im Postensystem mit Pferdewechsel betrieben. Verzichtete man auf den Pferdewechsel, so fiel diese Form der Personenbeförderung nicht unter das kaiserliche Postregal und wurde vor allem im Süden des Reiches auch als landesherrliche Konzession vergeben. So verlieh Württemberg im Jahr 1683 einem gewissen Johann Geiger das Recht, den Fahrposten zwischen Stuttgart und Heidelberg zu betreiben:
Es wird hiermit allen Reysenden zu wissen gethan / daß auff Hochfürstl. Durchl. zu Würtemberg / gnädigste Verordnung und Consens Johann Geiger […] alle Wochen mit einer Post=Calletsch […] alle Montag von Stuttgart abfähret / und in deß Heil. Röm. Reichs=Stadt Heylbron / in dem Wirthshauß beym Falcken / und andern Tags von dannen nach der Churfürstlichen Residentz=Stadt Heydelberg / bey der Herberg zum Ritter S. Georgen einkehret / daselbsten aber am Mittwoch umb 1. Uhr wiederumb weggehet / und am Donnerstag zu Heylbronn / deß Freytags Abends aber wiederumb in Stuttgart anlanget.[11]
In Großbritannien, wo das Generalpostamt im 18. Jahrhundert zunehmend die Konkurrenz privater stage coach Unternehmen spürte, erfolgte die Gründung einer vergleichbaren Institution erst im Jahr 1784 mit der Einrichtung des ersten Postkutschenkurses zwischen London und Bristol. Das System war aber so erfolgreich und effizient, dass schon im folgenden Jahr viele weitere Kurse aus London in alle Himmelsrichtungen eingerichtet wurden. Wie die Fahrposten auf dem Kontinent, so verkehrten auch die Royal Mail Coaches nach einem festen Fahrplan, der immer feiner und exakter wurde. Um diesen Fahrplan möglichst genau einhalten zu können, führten die Postkutscher eine Uhr mit, die an den Haltstellen jeweils auf die lokale Zeit eingestellt wurde. Unter anderem an dieser Praxis lässt sich erkennen, wie genau man versuchte, die Ankunfts- und Abfahrtszeiten einzuhalten. Ähnliches gilt auch für die Postkutschen in Mitteleuropa. Durch die Verdichtung des Postwagennetzwerks, die Verbesserung des Straßensystems und die Einführung von Eilkursen wurden die Laufzeiten im Zuge des 18. und frühen 19. Jahrhunderts immer berechenbarer. Brachte der Umstieg auf eine andere Linie zunächst noch lange, nicht genau kalkulierbare Wartezeiten und oft sogar eine Übernachtung mit sich, so wurden die Anschlüsse und Abfahrtszeiten im Laufe des 18. Jahrhunderts immer exakter und bald schon auf die Stunde genau angegeben. Anfang des 19. Jahrhunderts gingen viele Kursbücher zur minütlichen Angabe von Abfahrtszeiten über.[12] Das preußische Postwesen beispielsweise galt zu dieser Zeit als so verlässlich, dass in Preußen im Jahr 1825 die Zeit des General-Postamts in Berlin zur Standardzeit im gesamten Königreich wurde[13] (zur Vereinheitlichung der Zeitmessung siehe Kapitel III.4 zur Standardisierung). Nach einer bekannten Anekdote konnte man nach der preußischen Postkutsche tatsächlich die Uhr stellen. Das hieß aber nicht, dass zum Beispiel abseits der gut ausgebauten Strecken, in schwierigerem Terrain oder bei schlechten Witterungsverhältnissen nicht auch immer wieder deutlich vom Fahrplan abgewichen wurde.
Das Post- und Postkutschenwesen im frühneuzeitlichen Europa nahm damit hinsichtlich der Schnelligkeit und Verlässlichkeit von Transport und Kommunikation viele Entwicklungen vorweg, die gemeinhin der dampfgetriebenen Beförderung zugeschrieben wurden. Postwagen verkehrten auf festen Kursen und nach festen Plänen. Ihr Takt sowie die Abstimmung verschiedener Kurse untereinander war aber noch nicht besonders dicht. Vor allem auf den weniger gut ausgebauten Strecken kam es häufig zu signifikanten Abweichungen vom Fahrplan. Die Post stand zur Nutzung zumindest theoretisch jedermann offen, auch wenn die Kosten sowohl für die Briefpost wie auch für die Personenbeförderung viele Menschen dennoch von der Nutzung ausgeschlossen hat. Eine Beschleunigung und Verregelmäßigung lässt sich in der Frühneuzeit übrigens nicht nur im Landverkehr feststellen, sondern auch hinsichtlich der wichtigsten transozeanischen Verbindungen. So kann beispielweise für den Nordatlantik (und damit die Route zwischen Nordamerika und Europa) eine deutliche kommunikative Verdichtung bereits für die Zeit zwischen 1670 und 1750 festgestellt werden – also lange bevor die Dampfkraft, geschweige denn die Telegrafie (siehe Kapitel III.2 zur Dematerialisierung) zum Einsatz gelangt wäre.[14]