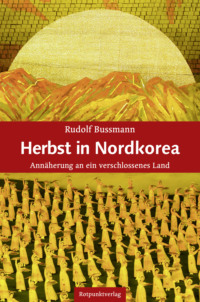Kitabı oku: «Herbst in Nordkorea», sayfa 2
Tumen, der Todesfluss, und Paektusan, der heilige Berg
Ein Stück Ufer, ein Fluss. Ein flacher, träge dahinfließender Fluss, an die siebzig Meter breit. Darin spiegelt sich der graue Himmel. Schilf und Gebüsch auf der anderen Seite, dahinter eine Ebene. In der Ferne ein Berg.
Dort drüben ist Nordkorea. Wir stehen auf der chinesischen Seite der Grenze, inmitten der südkoreanischen Reisegruppe, mit der wir einige Tage unterwegs sind. Es gibt nichts zu sehen als nur diesen Fluss und den fernen Berg, an dessen Fuß helle Würfel auf eine Siedlung schließen lassen. Die Gespräche sind verstummt, man steht auf der Treppe zum Ufer und schaut hinüber.
Vom Flughafen Yanji aus sind wir eine gute Stunde in östlicher Richtung gefahren und werden diese Strecke wieder zurückfahren. Das Changbai-Gebirge mit dem Vulkanberg Paektu, unser Reiseziel, liegt in der Gegenrichtung. Die Gruppe ist eigens an den Fluss Tumen gereist, um einen Blick hinüber in die terra incognita zu werfen, in das verbotene Land, das man nur aus Filmen, Büchern, Erzählungen kennt.
An der Anlegestelle warten kleine Motorboote. Auf ihnen kann man sich in die Mitte des Flusses fahren lassen, exakt an die Grenze. Es ist die maximale Annäherung an Nordkorea.
»Ich mag nicht mitfahren. In wenigen Tagen werden wir im Land sein. Es ist lächerlich, an seiner Grenze im Boot hin und her zu fahren«, sage ich zu Yu-mi.
Sie steigt ein, streckt mir die Hand entgegen: »Komm! Nirgends ist die Spannung größer als an einer Grenze, die man nicht betreten darf. Hier bleibt das Land eine vibrierende Imagination. Sobald du in ihm bist, wird es simple Wirklichkeit.« Ich steige ein.
Die Boote füllen sich. Eine Viertelstunde Fahrt kostet zwanzig US-Dollar, für hiesige Verhältnisse viel Geld. Das Geschäft mit den Emotionen der Menschen, für die diese Landeshälfte tabu ist – obwohl Teil ihrer Geschichte, ihrer Identität, ihrer Sehnsucht –, ist einträglich. Es ist eine skurrile Fahrt ohne jede Abwechslung, einige Minuten flussabwärts, einige Minuten flussaufwärts.
Um die Bootshaltestelle herum wurde ein kleiner Vergnügungspark eingerichtet. Ein paar Männer kauern auf dem Boden um ein Brettspiel. Mütter stehen neben einer Schaukel und schauen ihren Kindern zu. Die Zwillingsräder, miteinander durch eine gemeinsame Sitzbank verbunden, mag bei diesem Wetter niemand mieten, es ist trüb und windig.
Für das Erinnerungsfoto an dieser entlegenen Ecke ist ein spezieller Rahmen gebaut worden, eine Art Fußballtor, an dessen oberer Latte die Wappen von Nord- und Südkorea angebracht sind. Anstelle des Torwarts bringt sich gerade eine Familie in Position. Ein Fluss, eine verlassene Ebene, ein Berg, auf dem sich die Antennen einer Militäranlage in die Höhe recken, das ist die Ansicht vom fremden Bruder, welche die Touristen nach Südkorea mitnehmen werden.
Aufgeregte Stimmen auf dem Rückweg zum Reisebus. Eine Frau will eine verdächtige Bewegung im Ufergebüsch wahrgenommen haben. War es eine Patrouille von Grenzsoldaten? Ein Flüchtling, der sich anschickte, das Wasser zu durchschwimmen? So entstehen Legenden. Den Tumen kümmern sie nicht, sein Wasser fließt ungerührt dem Japanischen Meer zu. Er entspringt am Paektusan, unweit von seinem Zwillingsfluss Yalu (koreanisch Amnokkang, auch Amnokgang; kang oder gang bedeutet Fluss), mit dem zusammen er den Grenzverlauf zwischen Nordkorea und China bestimmt. Während der Yalu nach Südwesten ins Gelbe Meer fließt, nimmt der Tumen Kurs Richtung Nordosten; auf den letzten siebzehn Kilometern bildet er die Grenze zwischen Nordkorea und Russland.
Korea ist an drei Seiten von Meer umflossen. Auf dem Land markieren Yalu und Tumen die Grenze. Seit der ersten politischen Einheit der Halbinsel im 10. Jahrhundert unter dem Reich Koryŏ (das dem Land den Namen gegeben hat) trennen sie die Koreaner von ihren Nachbarn. Trotz Einfällen der Jurchen, Mandschus und Mongolen bildeten sie eine Grenze, die periodisch zwar verletzt, überschritten, ignoriert wurde, letztlich aber als Abschluss des von den Koreanern beanspruchten Gebiets Bestand hatte.
Die beiden Flüsse sind es auch, über die aus Nordkorea Geflüchtete nach China, von da nach Südkorea oder in andere Länder gelangen. Wie vielen die Flucht geglückt ist, darüber gibt es nur Schätzungen; seit der Gründung der Demokratischen Volksrepublik Korea sollen es bis zu 300’000 sein, wobei die Dunkelziffer weit höher liegen dürfte. Die meisten ließen sich in China und Russland nieder. Die verlässlichsten Zahlen stammen aus Südkorea, wo zwischen 1953 und 2020 über 33’000 Flüchtlinge registriert wurden.1 Nach der Machtübernahme von Kim Jong-un nahm der Flüchtlingsstrom ab. Er liegt inzwischen bei jährlich rund tausend Menschen, für die lange die Bezeichnung defectors, Überläufer, verwendet wurde. Der Begriff defector ist irreführend, da er die Geflüchteten nicht nach dem Grund ihrer Flucht unterscheidet und auch Menschen, die während der Hungersnot in den neunziger Jahren aus dem Land flohen, als Abtrünnige stigmatisiert. Mehr und mehr setzt sich die Bezeichnung refugee durch, einer, der flieht, weil er existenziell bedroht ist, sei es durch Hunger, sei es durch fehlenden Schutz vor Willkür, Folter, Arbeitslager oder der Hinrichtung.
Da an der schwer bewachten Grenze zu Südkorea kein Durchkommen ist und der Fluchtweg über das Meer nur selten gewagt wird, spielen sich die meisten Flüchtlingsdramen entlang des Yalu und des Tumen ab. Gegen das nötige Fluchtgeld steht den Flüchtenden ein Netz von Schleppern und Fluchthelfern zur Seite, welche die entsprechenden Pfade kennen und die Grenzsoldaten bestechen. Geflüchtete berichten von abenteuerlichen Transfers bis vor den Fluss, den sie dann allein zu durchqueren hatten. Wie viele Menschen in den nächtlichen Kontrollen der Armee hängen geblieben sind, wie viele erschossen wurden, darüber weiß niemand Bescheid.
Auf der Rückfahrt bleibt es still im Bus. Man wollte bloß mal einen Blick auf den anderen Teil der koreanischen Halbinsel werfen und stand unvermittelt vor einem Fluss, der Schauplatz so mancher Tragödie ist. Man wollte sich auf einem kleinen Bootsausflug amüsieren und fuhr über einen Abgrund. Man stieg am chinesischen Ufer an Land, ohne von einer Kugel getroffen zu werden, nur weil man die richtige Staatsbürgerschaft besitzt.
Der zweite Blick auf Nordkorea eröffnet sich zwei Tage später oben auf dem Gipfelgrat des Paektusan auf 2700 Metern Höhe. Den Ausblick mussten wir uns mit viel Geduld verdienen. Am Vortag war das Wetter so schlecht, dass wir uns am Fuß des weitläufigen Changbai-Gebirges in Bereitschaft halten mussten, in Gesellschaft von Dutzenden chinesischer Reisegruppen. Auch heute warteten wir zunächst vergeblich. Die Gipfel waren von Wolken verhüllt. In den höheren Regionen habe es geschneit, die Schneeräumungsarbeiten seien im Gang, hieß es. Wir mussten mit einer Ersatzwanderung Vorlieb nehmen, stiegen entlang von Bächen zu kleinen Bergseen hoch, vorbei an dampfenden Schwefelquellen und Wasserfällen, blickten in steile Taleinschnitte und bestaunten bizarre Lavaformationen. Eine beeindruckende Landschaft, aber nicht das, was wir sehen wollten. Am Nachmittag dann, einige Reisegruppen waren schon unverrichteter Dinge ins flache Land zurückgekehrt, kam bei den chinesischen Führern Hektik auf. Es konnte ihnen auf einmal nicht rasch genug gehen: Hier, in diesen Bus einsteigen! Kaum waren wir ein paar Minuten gefahren, aussteigen, in einen anderen Bus umsteigen, losfahren, aussteigen. Schließlich wurden wir willkürlich auf kleinere Geländewagen aufgeteilt, Chinesen, Koreaner und ein Europäer, und ab ging’s, mit Allradantrieb die steile Rampe des Bergs in Haarnadelkurven hinan, in forciertem Tempo hoch zu einem Parkplatz ein Stück unterhalb des Vulkanrands.
Von dort marschieren wir in einer langen Kolonne auf einem Trampelpfad durch den Schnee in Richtung Gipfelgrat. Tief unten erstreckt sich in leichten Wellen das Land. Weite hellgelbe Felder ziehen sich hinüber in die Mandschurei, Schatten von Wolken segeln darüber weg. Vor uns am Steilhang ragen vereinzelte Felsbrocken aus dem Schnee. Es ist kalt, die Leute sind in ihre Jacken eingehüllt, haben sich Mützen aufgesetzt, stapfen aufwärts, den Blick zum Boden, um nicht auszurutschen. Die Vulkankrete ist durch eine Absperrung aus Seilen gesichert. Die Menschen stehen dicht an dicht auf einem rund hundert Meter langen Abschnitt, der vom Schnee geräumt ist. Einige haben sich uns zugewandt.
»Warum schauen sie her und winken?«, fragt Yu-mi.
Sie blicken nicht zu uns, sie schwenken ihre Telefone und machen Selfies. Oder sie lassen sich ablichten, mit dem Bergpanorama im Hintergrund. Als wir oben ankommen, entfährt uns wie allen ein Laut des Staunens. Der Boden bricht ab, senkrecht fällt der Vulkanfels in die Tiefe. Hunderte Meter unter uns erstreckt sich in dem ausgreifenden Kessel glatt und unbewegt der Kratersee. Die Sicht hinüber auf die verschneite Caldera, wo irgendwo die Grenze zu Nordkorea beginnt, auf die schwarzen Zacken der erstarrten Lava und hinab in den weit geschwungenen Krater nimmt einem beinahe den Atem. Im See spiegelt sich der stahlblaue Himmel, silbrige Wolken ziehen darüber hin. Oben und unten sind vertauscht, man blickt hinunter in das Firmament. Fast zehn Quadratkilometer Fläche bedeckt der Himmelssee, er reicht bis in eine Tiefe von 384 Metern und zählt zu den bedeutenderen Kraterseen der Erde.
Immer schon und bis heute wird der Paektusan von den umliegenden Völkern verehrt. Der legendäre Gründer des ersten koreanischen Staates, Tan’gun, soll hier als Frucht der Verbindung des Himmelsgottes Hwanung und einer Bärin geboren worden sein. Als höchster Gipfel der koreanischen Halbinsel gilt er im nördlichen wie im südlichen Teil als Symbol eines vereinigten Korea, auch wenn sich Nordkorea bemüht, ihn als den heiligen Berg der koreanischen Revolution der Historiografie des Staates einzuverleiben. Das schwer zugängliche Bergmassiv diente Kim Il-sung, dem späteren Staatsgründer Nordkoreas, und den von ihm geführten Partisanen als Zentrum des Widerstands gegen die japanische Besatzung. In einem Geheimlager in einer verschneiten Blockhütte soll nach nordkoreanischer Darstellung auch Kim Jong-il, der Sohn und Nachfolger Kim Il-sungs, das Licht der Welt erblickt haben. In Wirklichkeit wurde er weit weniger romantisch in einem sowjetischen Ausbildungslager in Russland geboren.
Heute teilen sich Nordkorea und China den Berg. Die Aufteilung fand ohne Beteiligung der Koreaner statt, 1909 in der Gando-Konvention zwischen China und Japan, als Korea unter japanischer Kolonialverwaltung stand; das Abkommen wurde erst 1963 von nordkoreanischer Seite akzeptiert. Der heilige Berg ist längst zu einem Politikum geworden. Und der Tagestourismus auf seine Caldera hat die Aura des Spirituellen, die ihm seit Urzeiten anhaftet, entzaubert. Dennoch vertraute der Ausflug der Präsidenten von Nord- und Südkorea mit ihren Gattinnen vor zwei Tagen auf seine alte Symbolkraft. Von ihm sollte das Signal ausgehen, dass es eines Tages einen friedlichen Zugang aller Menschen und Völker zu diesem Berg geben wird.
_______________
1Das südkoreanische Ministerium für Wiedervereinigung führt eine offizielle Statistik über Flüchtlinge aus Nordkorea, vgl. www.unikorea.go.kr/eng_unikorea/relations/statistics/defectors/.
Über die Grenze
Um sieben Uhr früh wartet an der Rezeption des Yanbian International Hotel in Yanji der chinesische Fahrer, der uns an die nordkoreanische Grenze bringen wird. Es ist ein junger Mann, vielleicht dreißig; von ihm stammt der Brief, der am Vortag unter der Zimmertüre hindurchgeschoben wurde und mit großen ungelenken Buchstaben an den Termin erinnert. Der Mann verbeugt sich und streckt uns sein Smartphone entgegen, auf dem er uns via Übersetzungsprogramm eine gute Reise wünscht. Wir steigen in seinen Wagen.
In der Stadt herrscht dichter Morgenverkehr. Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto zur Schule oder lassen sie per Taxi hinfahren; einige Mütter sind, ihr Kind an der Hand, zu Fuß unterwegs. Wer ein Fahrrad oder einen der dreirädrigen Kleinwagen fährt, versucht, im gefährlich schmalen Korridor zwischen den Autokolonnen vorwärtszukommen, nur dort wird er geduldet. An den Bushaltestellen stehen die Wartenden eng nebeneinander direkt an der Fahrbahn. Für sie ist kein Platz vorgesehen; sie drücken ihren Rücken, vor ihren Füßen die rasenden Autos, an eine Hecke oder eine Mauer.
Wir verlassen die Stadt mit ihren 650’000 Einwohnern Richtung Osten. Allmählich lichten sich die Häuserreihen, Werkstattschuppen und Fabriken stehen vereinzelter. Auf einer neu gebauten Autobahn fast ohne Verkehr geht es über Hügel mit herbstlich farbigen Wäldern hinunter in die weite Ebene, die der Fluss Tumen geschaffen hat. Wir müssen den nördlichen Zipfel Nordkoreas umfahren. Auf der Höhe der Stadt Hunchun wechselt der Fahrer auf eine Autostraße, gesäumt von Büschen und roten Blumen, die uns südostwärts durch einen wenige Kilometer breiten Korridor zwischen Nordkorea und Russland an die nordkoreanische Grenze bringt.
Wir können über den Grenzübergang bei Quanhedao nach Nordkorea einreisen, der vorwiegend dem Warentransport dient und zudem chinesischen Reisegruppen offensteht. Gewöhnlich werden Touristen in den besser entwickelten Süden geführt, nach Pjöngjang, an die Grenze zu Südkorea und zu den großen Landwirtschaftskollektiven. Von den zwanzig Prozent des Staatsgebiets, die für Fremde überhaupt zugänglich sind, gehört die nordöstliche Ecke nicht zu den Vorzeigedestinationen. Umso größer unsere Neugier, die wenig bekannte Provinz Hamgyŏng-pukto zu besuchen. Die Wahrheit über ein Land ist am leichtesten in seinen ärmsten Gebieten zu erahnen.
Der Fahrer hält auf einem Parkplatz voll von Taxis und einigen Bussen. Wer keine Waren zu transportieren hat, steigt hier aus, lässt den Wagen stehen und geht zu Fuß über die Grenze. Am Ende des Parkplatzes erhebt sich ein hoher gemauerter Durchgang wie ein Triumphbogen. Dahinter findet unter freiem Himmel eine erste Passkontrolle statt. Vor uns erstreckt sich ein weiter Platz, leer, an seinem Ende liegt das chinesische Abfertigungsgebäude. Die Anlage erinnert an einen buddhistischen Tempelbezirk, wo Tore und Vorhöfe den Besucher von seinem gewohnten Leben lösen, ihn in das Heilige einstimmen und erst nach und nach Zugang zum Inneren gewähren.
Ich zögere. Erstmals seit dem Entschluss, hierher zu reisen, kommen mir Bedenken. Hinter diesen säkularen Tempelmauern werde ich nicht nur mein gewohntes Leben aufgeben, sondern auch meinen freien Willen und meine Entscheidungsfreiheit. Ich habe mich auf ein Abenteuer eingelassen, das ich nicht steuern, nicht beeinflussen, nicht unterbrechen kann und aus dem es unterwegs keinen Ausstieg gibt. Ich werde mich Leuten anvertrauen müssen, deren Absichten ich nicht kenne, die uns in der Hand haben, uns die Regeln diktieren und Dinge erklären, die wir nicht nachprüfen können.
Wir ziehen die Rollkoffer über das holprige Pflaster. Genau das, sage ich mir, hast du doch gerade vier Tage lang praktiziert. Du hast deinen Willen an die südkoreanische Reiseleiterin abgegeben und dich zu einem Trip aufgemacht, bei dem du nicht ein einziges Mal nach deinen Wünschen gefragt wurdest. Du hast alles mitgemacht, was für euch vorgesehen war, hast gegessen, was euch vorgesetzt, nicht hinterfragt, was euch gesagt wurde. Kein einziges Mal hast du dich von der Gruppe entfernt oder hast abends das Hotel verlassen. Was misst du jetzt mit ungleichem Maß?
Am Fuß der Freitreppe, die in das chinesische Grenzgebäude führt, fragt uns ein Offizier nach dem Grund unseres Grenzübertritts. Er wünscht uns eine gute Reise und weist uns zum Eingang. Im Innern ziehen einige Dutzend junge Frauen unsere Aufmerksamkeit auf sich, die in akkurater Dreierkolonne vor einer Absperrung stehen, schweigend, mit makellosem Make-up, die Haare streng nach hinten gebunden. Sie tragen Rock und Bluse oder ein Kleid und Pumps. Es sieht aus, als hätten sie sich zu einer Aufführung eingefunden. Keine lächelt, keine verzieht das Gesicht, sie stehen vollkommen ausdruckslos, geduldig und diszipliniert in der Reihe. Einzeln treten sie an den Schalter, wo sie unbeweglich und aufrecht stehen wie vor den Schranken des Gerichts.
»Wer ruft diese adretten Puppen ins Reich von Kim Jongun?«, frage ich Yu-mi.
Yu-mi schaut mich von der Seite an. Ihr rechtes Auge ist zugekniffen, kein gutes Zeichen bei ihr. »Ich weiß nur eines«, sagt sie, »es sind gut gekleidete junge Asiatinnen. Von ihnen als von Puppen zu sprechen, kann nur einem Mann einfallen. Einem Europäer«, ergänzt sie. »Bei einem ähnlichen Aufmarsch junger Pariserinnen würdest du kaum das Wort ›Puppen‹ in den Mund nehmen, oder?«
Zwei junge Männer nehmen uns in Empfang, nachdem wir die Schalter der chinesischen Grenze passiert haben. Es sind unsere nordkoreanischen Führer. Sie nehmen unsere Pässe an sich. Elektronische Geräte und Bücher müssen ausgepackt und auf einem Tisch ausgebreitet werden; sie gehen zusammen mit unseren Pässen einen eigenen Weg, während wir unsere Koffer auf das Laufband legen. Die junge Beamtin am Durchleuchtungsapparat weiß genau, was sie sehen will, die Tasche mit dem Fotoapparat und den Fotospeicherkarten. Diese werden, ebenso wie Bücher und Gadgets, auf einer Personalkarte aufgelistet, die bei der Ausreise wieder vorzuzeigen ist. Erst dann wird uns bewusst werden: Wichtig für die nordkoreanischen Beamten ist weniger, was man einführt, als dass man es wieder mitnimmt. Nichts soll dableiben, was Bilder, Wissen, Unterhaltung aus dem Rest der Welt ins Land bringen könnte.
Als ich den Koffer aufnehmen will, legt sich eine Hand auf die meine. Der Führer wird den Koffer zum wartenden Shuttlebus tragen. Die Innenfläche seiner Hand ist feucht.
Der Bus bringt uns über eine Betonbrücke hoch über der Schlucht, die der Tumen in die Hügel gegraben hat. Auf der nordkoreanischen Seite steigen wir vor einem Gebäude aus. Eben tritt eine Gruppe junger Frauen aus dem Haus, ähnlich schick angezogen wie die auf der anderen Seite. In Zweierkolonne warten sie auf die Ausreise nach China. Kaum haben wir den Bus verlassen, nähern sie sich und steigen wieselflink ein. Auch einige junge Herren in schwarzem Anzug sind unter ihnen. Es sind, erfahre ich auf meine Frage, chinesische Angestellte, die in Nordkorea arbeiten. Sie befinden sich auf dem Weg nach Hause, während diejenigen, die in unserer Richtung unterwegs sind, an ihren Arbeitsort fahren. Wir haben die nordkoreanische Sonderwirtschaftszone Rasŏn betreten, wo sich zahlreiche chinesische und einige russische Unternehmen angesiedelt haben, die eigene Leute beschäftigen. Begegnet uns hier eine Art Wirtschaftskolonialismus, der die einheimischen Arbeitskräfte und das einheimische Kapital an den Rand drängt? Ist das eine Variante des Frühkapitalismus, ist es eine Form des entwickelten Sozialismus oder eine Kombination von beidem?
Vor dem Kleinbus, mit dem wir in den nächsten Tagen unterwegs sein werden, bekommen wir Bücher, elektronische Geräte und Pässe zurück. Als das Gepäck verstaut ist, findet die eigentliche Begrüßung statt. Die beiden Männer, die uns an der Zollstation in Empfang genommen haben, stellen sich als Herr Kang und Herr Lee vor. Sie werden sich um uns kümmern – als Führer, Begleiter, Bewacher, Ratgeber, je nach Situation und Standpunkt. In ihren schwarzen Anzügen sehen die jungen Männer aus wie Maturanden. Der Fahrer tritt neben sie. An den Jacken der Genossen prangt die Anstecknadel mit dem Bildnis des Führers, die jeder nordkoreanische Staatsbürger über dem Herzen zu tragen hat.
»Wir werden betreut wie VIPs«, sagt Yu-mi zufrieden. »Drei Personen, die sich um zwei Reisende sorgen, das lasse ich mir gefallen!«
Die Gegend ist hügelig, Herbstwälder wechseln sich mit Maisfeldern ab. Der Blick verfängt sich in einem Mischwald, der dem des Jura gleicht, Eichen, Buchen, Ahorn, Birken. Ein kleiner Pass mit einem kurzen Ausblick, in der Ferne ein helles Schimmern – das Meer? Dann eine schluchtartige Verengung, die Straße taucht ins Schattige ab.
»Hier.« Herr Kang tippt mir auf die Schulter, zeigt aus dem Fenster. »An dieser Stelle löste sich der Hang. Vor drei Jahren während eines heftigen Regens. Dreihundert Millimeter Wasser in der Stunde, stellen Sie sich das vor! Eine Sturzflut, drei Stunden ohne Unterbrechung. Damit haben wir in Nordkorea zu leben. Der Hang löste sich und rutschte in die Tiefe. Der Bach, den Sie da unten sehen, schwoll innerhalb kurzer Zeit an und wurde zu einem reißenden Fluss. Er hinterließ eine breite Schneise in der Landschaft. Unten war ein Dorf. Es wurde unter Massen von Erde und Wasser begraben.« Herr Kang verstummt.
Der Wald tritt zurück. Die Schlucht läuft in sanft geschwungene Bodenerhebungen aus.
»Sehen Sie die Häuser dort drüben?«
Auf einer Terrasse liegt eine Siedlung mit neuen Häusern, einstöckig und in Reihen gebaut.
»Das Unglück geschah im August. Unser Geliebter Führer gab die Anweisung, sofort mit dem Wiederaufbau zu beginnen, auch die Armee wurde eingesetzt. Es vergingen keine drei Monate, und das Dorf stand wieder. Im Oktober waren die Häuser bezugsbereit.« Er macht eine bedeutsame Pause. »Wie lange dauert es in Europa, bis in einem solchen Fall der Wiederaufbau abgeschlossen ist? Wir schaffen in Nordkorea in gemeinsamer Arbeit das Unmögliche.«
Das nordkoreanische System ist dafür bekannt, dass es Projekte in ungewöhnlichem Tempo voranbringt. Eine hohe Anzahl Arbeitskräfte werden an einen Ort zusammengezogen und konzentriert eingesetzt, gerade auch wenn die nötigen technischen Hilfsmittel fehlen. Die Erwähnung des Führers in diesem Zusammenhang finde ich überflüssig. Später werde ich verstehen. Geschieht etwas auf oberste Anordnung, bedeutet dies, Wunder geschehen. Das nötige Material wird geliefert, die notwendigen Arbeitskräfte stehen zur Verfügung, das Vorhaben wird zügig in die Hand genommen und zu Ende geführt. Wehe aber dem Projekt, dem der Geliebte Führer seine Liebe nicht zuwendet. Es hat es schwer, voranzukommen, meist bleibt es unvollendet liegen.
Die Bergkette, hinter der die chinesische Grenze liegt, zieht sich zu unserer Rechten nach Süden wie das Rückgrat eines Reptils. Zu unserer Linken öffnet sich die Sicht aufs Meer, das die Koreaner seit je Ostmeer nennen. Den Namen »Japanisches Meer«, der sich international eingebürgert hat, setzten die Japaner während ihrer Besatzung durch – ein sprachliches Relikt kolonialer Herrschaft. Zwischen Meer und Bergen breitet sich eine Ebene aus, in der Reis angebaut wird. Mitten in ihr erhebt sich aus dem Dunst das Skelett einer Raffinerie. Rohre und Kamine stehen vor dem grauen Himmel, weder Rauch noch Gasfackeln sind zu sehen. Die Anlage macht einen verwahrlosten Eindruck.2
Im Moment sei sie außer Betrieb, sagt Herr Kang auf unsere Frage. Sie sei auch schon vierzig Jahre alt.
»Was heißt im Moment?«
Genaueres kann, will, darf er uns nicht sagen. Ob sie repariert wird, aus Sicherheitsgründen geschlossen wurde, ob sie je wieder in Betrieb genommen werden soll, wisse er nicht. Er ist eigentlich nicht verschlossen, er redet gern, es ist angenehm, ihm zuzuhören. Doch sobald das Gespräch auf gewisse Themen kommt, gerät es ins Stocken oder wird umgelenkt. Es sind die Themen, die uns interessieren; sie hängen mit der Wirtschaft des Landes, seiner Geschichte, seinen Katastrophen zusammen.
»Man muss hier im Kaffeesatz lesen«, bemerke ich zu Yu-mi.
»Behalte einfach die Augen offen«, sagt sie. »Zu Hause findest du vielleicht heraus, was du jetzt nicht erfährst.«
Tatsächlich wird die Raffinerie-Ruine vor Rajin zu Hause etwas von ihrem Rätsel preisgeben. Aus Büchern und Internetseiten werde ich von einer politischen Katastrophe erfahren, die mit der Wucht und Geschwindigkeit einer Sturzflut über das Land hereinbrach.
Sie stammt aus den siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts, einer Zeit, als Nordkorea ein wirtschaftlich aufstrebendes Land war. Nach dem Koreakrieg (1950–1953) waren von ihm nur noch Trümmer übrig geblieben; ein Zehntel seiner Einwohnerinnen und Einwohner war tot. In der letzten Kriegsphase hatten flächendeckende US-Luftangriffe die nordkoreanischen Städte, Industrieanlagen, Dämme, Brücken und Straßen praktisch vollständig zerstört, angeblich, um das Land für eine Friedenslösung gefügig zu machen. Es war eines der größten Massaker der Weltgeschichte. Bis zum Beginn der Waffenstillstandsverhandlungen seien neben den großen Infrastrukturanlagen wie Staudämmen 18 der 22 größten nordkoreanischen Städte zum großen Teil dem Erdboden gleichgemacht worden, lese ich im Internet. US-General William Dean, der ab Juli 1950 in nordkoreanischer Kriegsgefangenschaft gewesen war, erinnerte sich später an die nordkoreanischen Städte und Dörfer als »Ruinen oder verschneite, leere Flächen«. Fast jeder, der ihm begegnet sei, habe Angehörige im Bombenkrieg verloren.
Der Wiederaufbau begann sofort nach dem Waffenstillstandsabkommen vom 27. Juli 1953, den die UNO mit Nordkorea schloss. Unter Führung des charismatischen Kim Il-sung brachte die Bevölkerung das Land in einem beispiellosen Kraftakt so weit voran, dass alle ein Dach über dem Kopf und genügend zu essen hatten. Die nordkoreanische Wirtschaft wuchs stärker als die südkoreanische – 1960 kam der Staatshaushalt praktisch wieder ohne internationale Hilfe aus. Die Einbindung in die sozialistische Staatengemeinschaft führte zu einem regen Handelsverkehr, bei dem Nordkoreas Wirtschaft vom Export seiner reichen Bodenschätze profitierte. Im Gegenzug lieferte etwa die Sowjetunion billiges Erdöl, das in Raffinerien zu Treibstoff verarbeitet wurde. Die Entstehung der Raffinerie vor Rajin verdankt sich sowjetischer Bruderhilfe.
Dann kam 1989. Der Zusammenbruch des Ostblocks traf Nordkorea hart. China und die Sowjetunion, beide selbst in wirtschaftlicher Bedrängnis, kündigten bestehende Verträge und begannen Waren zu Weltmarktpreisen zu liefern. Der nordkoreanische Außenhandel ging dramatisch zurück; von 1990 bis 1998 brach er auf ein Drittel seines Werts ein (vgl. S. 73–84). Dem Land fehlten die Devisen, um Rohstoffe und Energie zu kaufen; die Wirtschaft war daran zu kollabieren. Im Zuge dieser Entwicklung dürfte die Raffinerie Anfang der neunziger Jahre ihre Tore geschlossen haben. Sie nahm bis auf ein kleines Zwischenspiel 1994, als vorübergehend amerikanisches Erdöl ins Land kam, ihre Produktion nicht wieder auf.
Das Hotelfenster in Rajin läßt sich nicht öffnen. Es ist mit einer getönten Folie überzogen. Ein nostalgisches Braun liegt über der leeren Kreuzung, der Brücke, die den Fluss überquert, über der Uferstraße. Ab und zu holpert ein alter Lastwagen vorbei. Personenwagen sind ein Ereignis, sie sind der Post, offiziellen Personen oder Ärzten vorbehalten.
Nähern sich der Kreuzung mehrere Wagen, kommt Bewegung in den blau uniformierten Verkehrspolizisten, der am Straßenrand vor einem Haus steht. Er marschiert in die Mitte auf sein betoniertes rundes Podest, strafft den Körper und beginnt mit ruckartigen Bewegungen die Leere zu dirigieren. Nach getaner Arbeit marschiert er in strengem Schritt an seinen Wartepunkt zurück.
Die beidseitigen Gehsteige sind dagegen belebt. Fußgänger, Leute mit Handwagen, Radfahrer müssen sich den Platz teilen, müssen mit ihren Rucksäcken, Taschen, Brettern, Säcken, den beladenen Rädern aneinander vorbeikommen und gleichzeitig die Spalten im Boden oder die aufstehenden Platten meiden. Oder den Pfützen dort, wo die Gehsteige aus Naturbelag bestehen, ausweichen. Die Straße gehört nicht ihnen, sie ist den nicht vorhandenen Autos vorbehalten. Vor der Kreuzung haben die Radfahrer anzuhalten, vom Rad zu steigen und den Fußgängerstreifen zu Fuß zu überqueren. Erst auf der anderen Straßenseite dürfen sie weiterfahren.
Verkehrsordnung in Absurdistan. Einigen wenigen Privilegierten sind die Straßen vorbehalten, während über neunzig Prozent der Menschen, die unterwegs sind, sich auf den Gehsteigen drängen. Die Benutzung des Fußgängerstreifens ist zwar Pflicht, schützt jedoch keineswegs vor den Autos, die uneingeschränkt Vortritt haben und die Fußgänger, die sich nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen, mit ungedrosseltem Tempo hupend von den Zebrastreifen jagen.
Ich erzähle Herrn Lee, wie der Verkehr bei uns geregelt ist; dass die Zebrastreifen mit der Pflicht, sie zu benutzen, zugleich den Schutz vor dem Autoverkehr garantieren und dass die Fahrbahn auch von Radfahrern benutzt wird. Er schaut mich erstaunt an.
_______________
2Zur Raffinerieruine vor Rajin vgl. Rüdiger Frank, Unterwegs in Nordkorea, S. 332.
Ücretsiz ön izlemeyi tamamladınız.