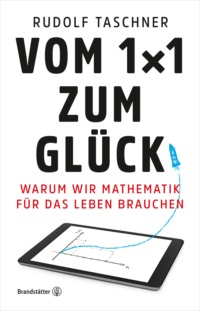Kitabı oku: «Vom 1x1 zum Glück»
Rudolf Taschner
VOM 1X1 ZUM GLÜCK
Warum wir Mathematik für das Leben brauchen

INHALT
VORWORT
| I | DIE LETZTE STUNDE |
| II | MATHEMATIK FÜRS LEBEN – ERSTER TEIL |
| III | DAS KLEINE EINMALEINS UND EIN BISSCHEN MEHR |
| IIII | MATHEMATIK FÜRS LEBEN – ZWEITER TEIL |
| V | EIN LOB AUF DIE ZENTRALEN TESTS UND EIN ABGESANG |
| VI | WARUM IST MINUS MAL MINUS PLUS UND ANDERE DUMME FRAGEN |
| VII | DREI SÄULEN SIND ES, AUF DENEN DER GUTE MATHEMATIKUNTERRICHT RUHT |
| VIII | DAS UM UND AUF DER MATHEMATIK IST DER BEWEIS |
| VIIII | DAS KLISCHEE VON MATHEMATIK UND SEINE WIDERLEGUNG |
| X | DIE ERSTE STUNDE |
VORWORT
Dieses Buch ist ein Essay. In zehn Kapiteln unterschiedlicher Länge wird darüber nachgedacht, was das überraschend klingende Wort bedeuten könnte: Die Mathematik ebnet den Weg zum Glück.
In den mit ungeraden Zahlen nummerierten Kapiteln und dem zehnten Kapitel blicke ich in erster Linie auf den Unterricht der Mathematik in unseren Schulen und schlage Maßnahmen vor, wie er sowohl zum Wohle der Kinder als auch der Gesellschaft zu gestalten wäre. Manche dieser Anregungen sind ausdrücklich wie Thesen verfasst, eine Fülle weiterer Anregungen findet sich zusätzlich zwischen den Zeilen. Dies entspricht der literarischen Gattung des Essays, das keine wissenschaftliche Abhandlung und keine Streitschrift sein möchte.
In den mit geraden Zahlen nummerierten Kapiteln (mit Ausnahme des zehnten Kapitels) schreibe ich vorrangig über die Mathematik selbst: Nicht über die an Universitäten gelehrte Disziplin, sondern über eine kulturelle Errungenschaft ersten Ranges, die man kennen soll, will man sich in der von Algorithmen und Technik durchdrungenen modernen Welt bewähren. Dieser Zugang zur Mathematik fand seit nunmehr 14 Jahren in dem von meiner Frau Bianca organisierten, im Wiener Museumsquartier beheimateten und von österreichischen Ministerien unterstützten math.space bei einem breiten Publikum begeisterten Zuspruch: Interessierte jeglichen Alters, vor allem aber junge Menschen wollen etwas von Mathematik erzählt bekommen. Auch im Internet kann man eine kleine Auswahl von math.space-Vorträgen als Videos verfolgen. All dies ist ein Beleg dafür, dass dieser Blick auf die Mathematik in den Schulen noch zu schärfen wäre.
Zumal er zu einem tiefen Verstehen von Mathematik führt, das glücklich macht.
Meine Frau Bianca und unsere Kinder Laura und Alexander unterstützten mich beim Schreiben und beim Korrigieren des Textes. Natürlich macht mich die Mathematik glücklich, aber das Glück der Geborgenheit, das Glück, in einer harmonischen Familie leben zu dürfen, ist ungleich wertvoller. Nikolaus Brandstätter und das hervorragende Team seines Verlages haben meinen Essay in gewohnt professioneller Weise zu einem schönen Buch verwandelt. Ihnen allen danke ich von ganzem Herzen.
Wien, im Sommer 2017
Rudolf Taschner
I
DIE LETZTE STUNDE
Wer in der Schule unterrichtet, weiß es: Es gibt zwei unvergessliche und prägende Augenblicke während der langen Zeit, die man mit den Kindern einer Klasse verbringt. Sie allein sind Lohn genug dafür, dass man sein berufliches Leben dem Lehren und Erziehen widmet. Einer dieser beiden unauslöschlichen Augenblicke ereignet sich bei den abschließenden Minuten der letzten Stunde.
Ich durfte es selbst wenige Male erleben. Als ich während meiner hauptberuflichen Tätigkeit als Mathematikprofessor, an einer Universität künftige Lehrerinnen und Lehrer fachlich auszubilden hatte, unterrichtete ich parallel dazu als Lehrer an einem Gymnasium jeweils eine Klasse in Mathematik. Dies erlaubte mir, die wissenschaftliche Lehre mit eigener praktischer Erfahrung des Schulalltags zu bereichern, was nicht nur für meine Studentinnen und Studenten, sondern auch für mich aufschlussreich war.
Die letzte Stunde jedenfalls in der achten Klasse, die ich ganz im Unterschied zu meinem sonst spontanen, nicht sonderlich organisierten Unterricht peinlich genau inszenierte, war mir immer besonders wichtig. Schon zu Beginn der Stunde bat ich ein wenig theatralisch darum, dass man mich aufmerksam machen soll, wenn in drei Minuten die Glocke zum Stundenende läuten werde. Ich hätte dann der Klasse etwas Wichtiges mitzuteilen. „Da wird er uns wohl verraten, welche Beispiele er zur Matura gibt“, wurde von Bank zu Bank geflüstert – es war damals noch die Zeit, als die schriftlichen Aufgaben zur Matura nicht zentral erstellt wurden; ich komme in dem Buch darauf an anderer Stelle zurück. Jedenfalls erzielte ich durch meine Ankündigung am Stundenbeginn eine leicht nervöse Aufmerksamkeit, während ich bei einigen Aufgabentypen, die vielleicht bei der schriftlichen Prüfung auftauchen werden, letzte hilfreiche Hinweise gab und ein paar Musterbeispiele ein letztes Mal vorrechnete. Die leise spürbare Anspannung der Kinder – ich nenne sie auch dann so, wenn sie bereits 18 Jahre alt sind, weil ich sie einst als echte Kinder kennengelernt hatte und sie dies, jedenfalls bis zu ihrer Matura, immer für mich blieben – nahm gegen Stundenende zu, und endlich war es soweit:
„In drei Minuten wird es läuten“, wurde von mehreren Seiten zum Katheder gerufen, „Sie wollten uns doch noch etwas sagen!“
„Gut, dass ihr mich erinnert“, spielte ich den Überraschten, „ich habe euch tatsächlich etwas mitzuteilen: Es sind jetzt die letzten Augenblicke, wo wir in der Klassengemeinschaft so zusammen sind, wie wir das jahrelang zuvor immer waren. Danach gibt es nur mehr die schriftlichen Prüfungen bei der Matura, die ziemlich amtlich ablaufen, und die mündlichen Prüfungen, bei denen ihr einzeln, jede und jeder für sich, gefordert sein werdet. Jetzt, in diesen Minuten, sehen wir einander so zum letzten Mal. Und da ist es mir wichtig, dass ich euch Folgendes sage:
Ihr seid unsere Hoffnung.
Und mit uns meine ich das Lehrerkollegium, mich eingeschlossen, aber auch eure Eltern, eure Mütter und Väter, ja eigentlich alle in euren Augen ältere Menschen in unserem Staat und unserer Gesellschaft.
Ihr seid unsere Zukunft. Wir haben niemand anderen als euch, von denen wir erwarten können, dass sie unser Land weiter gestalten werden.
Wir haben als Lehrerinnen und Lehrer alles, was wir wissen und können, in euch investiert. Und selbst wenn es in manchen Momenten pädagogischer Verzweiflung, für die ich mich jetzt in aller Form entschuldige, vielleicht nicht so von euch empfunden wurde: Wir setzen alle Jetons unseres Lebensspiels auf euch. Weil wir erwarten, dass ihr Karrieren so vernünftig ergreift und euer Leben so sinnvoll gestaltet, dass es nicht nur euch, sondern auch der ganzen Gemeinschaft Nutzen bringt. Weil wir davon ausgehen, dass ihr im Staffellauf des Lebens den Stab von uns übernehmt. Und weil wir uns wünschen, dass ihr mit dem, was wir euch vermittelten, glücklich werdet.
Ich hoffe, ich habe euch so viel gegeben, dass ich euch füglich alles Glück dieser Welt wünschen kann. Das ist es, was ich euch noch sagen wollte.“
Noch waren die drei Minuten nicht vorüber, ich genoss für ein paar Sekunden die vollkommene Stille, die den Raum erfüllte, und verließ – zugegeben nicht ganz gesetzeskonform ein wenig vorzeitig – die von mir überraschte Klasse. Mit solchen Worten hatte niemand aus der Schar der Kinder gerechnet. Dennoch habe ich jede einzelne Silbe ernst gemeint.
Mit Mathematik Menschen Wege zum Glück öffnen zu können: Tatsächlich bin ich davon überzeugt, dass dies möglich ist.
Und dass sich die Schule darum bemühen muss.
II
MATHEMATIK FÜRS LEBEN – ERSTER TEIL
Zahlen verkünden Macht und Besitz
Das Rechnen wurde erfunden, weil man reich werden oder wenigstens reich bleiben wollte. Darum ist es attraktiv. Sicher: Geld allein macht nicht glücklich, aber – wie Marcel Reich-Ranicki einmal gesagt haben soll – „es ist besser, in einem Taxi zu weinen als in der Straßenbahn“.
Leider wird das viel zu wenig betont. Obwohl man über das Interesse der Reichen und Mächtigen an Zahlen phantasievolle Geschichten – sind sie nicht wahr, so sind sie doch gut erfunden – erzählen kann, die man bis in die frühesten Epochen der Menschheit verlegt. Es sind Geschichten, die zeigen, wie wichtig es ist, dass man das Addieren und Subtrahieren, das Multiplizieren, das Dividieren beherrscht. Nur damit bewahrt man bei seinem Eigentum den Überblick, kann es vielleicht sogar vermehren.
Schon in der jüngeren Steinzeit, als Menschen sesshaft wurden, beginnt das Rechnen. Der Häuptling eines Stammes will wissen, ob er mehr keulenschlagende Gefährten hat als der Nachbarstamm. Denn wenn dies der Fall ist, kann er den Kampf um einen vielversprechenden Landstrich wagen. Der Häuptling selbst, er ist ja Politiker, ist des Zählens nicht kundig. Aber er beschäftigt einen Medizinmann aus der Gilde der damaligen Gelehrten, einen echten Spindoktor, der ihm diese Arbeit abnimmt. Auf zwei Hölzern schnitzt der Medizinmann Kerben: Bei dem einen genauso viele, wie der eigene Stamm an streitbaren Kriegern sein Eigen nennt. Bei dem anderen genauso viele, wie man beim fremden Stamm an Kämpfern vermutet. Dann werden die beiden Kerbhölzer nebeneinander gelegt und verglichen. Der Unterschied zwischen den Anzahlen der Kerben auf dem Holz des eigenen und dem des fremden Stammes entscheidet, ob man das Wagnis einer Schlacht eingehen soll oder nicht. Tatsächlich dürfte das damit verbundene Subtrahieren, die Bildung der Differenz, die erste aller Rechenoperationen überhaupt gewesen sein. Denn wir wollen immer vergleichen. Waren es einst die Kerben auf Hölzern, sind es heute Stimmen bei Wahlen oder Salden von Haben und Soll. [Siehe Abb. 1]

Abb. 1: Links die Krieger des eigenen Stammes, rechts die keulenschlagenden Kämpfer des gegnerischen Stammes. Deren Anzahlen befinden sich auf den beiden Kerbhölzern, und aus ihnen ersieht man, ob ein Kampf ratsam ist oder nicht.
Im Übrigen waren Kerbhölzer Jahrtausende danach immer noch in Gebrauch. Der Gläubiger, der das Holz, auch Stock genannt, hielt und deshalb englisch der Stockholder heißt, hat mit den Kerben eingetragen, wie viele Taler er dem Schuldner geliehen hat. Darum hat der Schuldner buchstäblich „etwas auf dem Kerbholz“. Selbst das Wort „Zahl“ hat mit dem Kerbholz zu tun: Es entwickelte sich aus dem indogermanischen Wort „del“, das die Einkerbung bedeutet. Unser Wort „Delle“ ist mit ihm verwandt. Ein kritischer Blick auf die Autokarosserie lehrt, wie eindrücklich Zahlen sein können.
Ein echter Gläubiger, ein wahrer Kapitalist der antiken Epoche, hatte nicht bloß einen, sondern mehrere Schuldner. Mehrere Kerbhölzer hielt er in der Hand. Bei der Frage, wie viele Sesterzen er insgesamt verliehen hat, ist der Gläubiger gezwungen zu addieren. Natürlich macht er es gerne, denn im Unterschied zu seinen Schuldnern liebt er die großen Zahlen. Die römischen Zahlzeichen lassen noch erahnen, wie früher die Zahlen geschrieben wurden. Bei den ersten vier Zahlen – I für eins, II für zwei, III für drei, IIII für vier (wir vergessen hier die Schreibweise IV für vier; sie ist jüngeren Datums und im vorliegenden Zusammenhang nur verwirrend) – wird man direkt an die Kerben erinnert. Oder an die Finger einer Hand, wenn man den Daumen verdeckt (so zählt man noch heute bevorzugt im englischsprachigen Bereich). Würde man für fünf das Zeichen IIIII verwenden, hätte man schon Probleme, es auf einem Blick von dem Zeichen IIII für vier zu unterscheiden. Schreibt man stattdessen das Symbol V, das an eine Hand mit weggestrecktem Daumen und den aneinanderhaftenden restlichen Fingern erinnert, hat man die Zahl fünf augenblicklich erfasst. Und es ist klar, dass das Zählen mit VI für sechs, VII für sieben, VIII für acht und VIIII für neun weitergeht. Bei der Zahl zehn denkt man an zwei Hände: ein V wird angeschrieben, das zweite V horizontal gespiegelt darunter, und schon bekommt man das römische Zeichen X für zehn.
Zahlen, die kleiner als 50 sind – und dies sind in den Anfangszeiten des Rechnens gar nicht so kleine Zahlen –, kann man damit erfassen. Aber mühsam ist es doch. Angenommen, der Gläubiger hat dem ersten Schuldner VII Sesterzen, dem zweiten Schuldner XVIII und dem dritten Schuldner XIIII Sesterzen geliehen. Auf XXXVIIII, also auf 39 Sesterzen als gesamten Schuldenstand zu schließen, ist schon eine aufwendige Rechnung. Aber sie will gemacht werden. Denn der Gläubiger möchte über sein verborgtes Kapital Bescheid wissen. Und bereits in römischer Zeit hat man für solche Additionen eigene Rechengeräte erfunden. Man wusste schon damals: Rechnen ist ein ödes Geschäft. Zuerst verschob man Perlen oder kleine Steine, Calculi genannt – das Wort Kalkül für Rechnung kommt daher. Dann konstruierte man ein Gestell, bei dem die Perlen an Stäben entlanggeführt werden: den Abakus. Bis heute wird er in Russland und Asien gelegentlich noch als preiswertes Rechengerät verwendet.
Zahlen geben Sicherheit
Doch gehen wir in noch frühere Zeitalter zurück, drei Jahrtausende vor Christus: Haran, ein reicher Bauer aus Mesopotamien, dem Zweistromland, möchte einige seiner Rinder und Schafe dem Händler Nahor in Ur, der Stadt, aus der Abraham stammte, verkaufen und dafür Saatgut, Textilien und Baumaterial erwerben. Um auf Nummer sicher zu gehen, dass der Knecht, den Haran mit den Tieren zu Nahor schickt, diese vollzählig beim Händler abliefert, nimmt der Bauer einen irdenen Topf und wirft für jedes Rind, das er dem Knecht anvertraut, eine Kugel in den Topf. Und für jedes Schaf, das er verkaufen will, wirft er eine Scheibe in den Topf. Zwar kann Haran noch nicht mit Zahlwörtern zählen, aber die Kugeln und Scheiben leisten das Gleiche. Sodann verschließt Haran den Topf mit einem Deckel und verschmiert den Rand von Topf und Deckel mit Lehm. Das verschlossene Gefäß wird im Feuer gebrannt, sodass der Deckel fest am Topf geheftet bleibt. Mit diesem Gefäß und den Tieren schickt Haran den Knecht auf die mehrere Tage dauernde Reise zu dem Händler in Ur.
Dort endlich angekommen, nimmt Nahor dem Knecht den Topf aus der Hand. Der Händler weiß aus Erfahrung mit den Bauern, mit denen er Geschäfte macht, was es mit diesem Behältnis auf sich hat: Nahor lässt den Topf auf den Steinboden fallen, dieser zerbricht in Dutzende Scherben und die Kugeln und Scheiben kommen wieder zum Vorschein. Jetzt wird gezählt. Kuh – Kugel, Kuh – Kugel: So viele Kugeln, so viele Kühe müssen abgeliefert werden. Schaf – Scheibe, Schaf – Scheibe: Bei den Schafen ist es das Gleiche. Und wehe, wenn eines der Tiere fehlen sollte: Der Knecht müsste es mit seinem Leben büßen. Natürlich: Wenn die Reise zum Händler mehrere Tage in Anspruch nahm und eines der Tiere trächtig war, konnten sogar noch mehr Tiere abgeliefert werden, als es Kugeln und Scheiben im Topf gab. Dies ist der entscheidende Unterschied zwischen der Biologie und der Mathematik: In der Biologie ändert sich alles mit der Zeit. Die Zahlen hingegen bleiben über alle Zeiten hinweg immer die gleichen. Sie sind für immer konstant. Nicht die Biologie, die Mathematik ist die nachhaltigste aller Wissenschaften.
Einzig unser Zugang zu den mathematischen Objekten wandelt sich. Er wird von Generation zu Generation einfallsreicher. So kennt Nahor bereits andere Bauern, die es geschickter machen als der alte Haran. Die jungen Bauern nehmen eine Lehmtafel und ritzen in ihr Zeichen ein: Runde Kreise stehen für die Kugeln, die Haran in den Topf warf, senkrechte Striche stehen für die Scheiben. Wenn danach die Lehm- zu einer Tontafel gebrannt wird, sind die so eingetragenen Zahlen genauso unverwüstlich wie die Kugeln und Scheiben in Harans verschlossenem Topf. Und zusätzlich bieten sie den Vorteil, dass der Knecht auf der langen Reise zum Händler stets überprüfen kann, ob die Tiere in seiner Herde vollzählig vorhanden sind. Noch heute finden wir solche Tontafeln in dem von Euphrat und Tigris durchzogenen Wüstenland mit eingravierten Zeichen. Zwar nicht Kreise und Striche, wie es in der vereinfachten Geschichte beschrieben ist, sondern mit Keilschriftzeichen. Doch diese leisten das Gleiche: Es war das Bestreben der Menschen, über ihren Besitz gleichsam Buch zu führen, das sie zur Erfindung von Zahlen, aber auch zur Erfindung der Schrift veranlasste.
Vom Ursprung des Multiplizierens
„Der Erste, der ein Stück Land eingezäunt hatte und auf den Gedanken kam zu sagen: ‚Dies ist mein‘, und der Leute fand, die einfältig genug waren, ihm zu glauben, war der wahre Begründer der zivilen Gesellschaft. Wie viele Verbrechen, Kriege, Morde, wie viele Leiden und Schrecken hätte nicht derjenige dem Menschengeschlecht erspart, der die Pfähle herausgerissen oder den Graben zugeschüttet und seinen Mitmenschen zugerufen hätte: ‚Hütet euch davor, auf diesen Betrüger zu hören! Ihr seid verloren, wenn ihr vergesst, dass die Früchte allen gehören und dass die Erde niemandem gehört!‘“
1754 erschien die Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Menschen von Jean-Jacques Rousseau. Obiges Zitat bildet den Ausgangspunkt seiner Idee vom Naturzustand des Menschen. In diesem paradiesischen Zustand, so Rousseau, war der Mensch gleichgültig gegenüber Eigentum. Wäre er es nur geblieben, klagt der einfältige Rousseau. Dann gäbe es keinen Kampf um mehr Besitz. Es gäbe nämlich überhaupt keinen Besitz – und auch keine Zahlen. Denn niemand würde sich genötigt fühlen, irgendetwas zu zählen.
Tatsächlich gibt es in schwer zugänglichen Winkeln der Welt immer noch Naturvölker, die von Eigentum und Besitz und daher auch von Zahlen nichts wissen. Sie kennen neben Einzelnem nur noch Paare und höchstens Dreiergruppen. Bei mehr als drei Bäumen sehen Bakairis oder Bororos, Ureinwohner Brasiliens, einfach nur „viele“ Bäume und greifen sich, um dies zum Ausdruck zu bringen, in die Haare. Ganz fremd ist auch uns dies nicht: Als Spaziergänger sehen wir die Bäume im Wald, kommen aber nie auf die Idee, sie zu zählen. Sie gehören uns auch nicht. Es reicht uns, dass es viele sind. Allein der Landwirt, der einen Forst sein Eigen nennt, will über die Zahl seiner Bäume Bescheid wissen.
Ein Stück Land, am besten ein Rechteck, einzuzäunen und als seinen Besitz zu erklären, damit beginnt, behauptet Rousseau, die Geschichte als ein stetes Hin und Her von Reichtum und Armut, von Gewinnern und Verlierern. Dabei ist der Zaun um das Rechteck gar nicht das Wesentliche. Das stellen vier Bauern fest, die Zäune um ihre kleinen rechteckigen Felder anlegen: Der erste Bauer hat ein Feld, das sieben Klafter lang, aber nur einen Klafter breit ist. Der zweite ein Feld, das sechs Klafter lang und zwei Klafter breit ist. Der dritte ein Feld, das fünf Klafter lang und drei Klafter breit ist. Und der vierte hat ein quadratisches Feld, das vier Klafter lang und vier Klafter breit ist. Alle vier Felder haben den gleichen Umfang. Alle vier Bauern brauchen Bretter für jeweils einen 16 Klafter umfassenden Zaun. In diesem Sinn sind alle vier Felder gleich groß. [Siehe Abb. 2]

Abb. 2: Links von oben nach unten die Skizzen dreier Felder: das erste sieben Klafter lang und einen Klafter breit, das zweite sechs Klafter lang und zwei Klafter breit, das dritte fünf Klafter lang und drei Klafter breit. Rechts unten die Skizze des quadratischen Feldes mit vier Klafter Seitenlänge. Alle vier Felder haben den gleichen Umfang, aber verschiedene Flächeninhalte.
Aber wenn es zur Ernte kommt, ärgert sich der erste Bauer, weil seine Nachbarbauern weitaus mehr ernten als er, der dritte und der vierte gar mehr als doppelt so viel. Denn auf den Umfang der Rechtecke kommt es bei der Ernte nicht an, sondern auf den Flächeninhalt, den die Rechtecke einnehmen. Da ist der erste Bauer arm dran, weil sein Feld nur sieben mal eins, also nur sieben Quadratklafter Fläche besitzt. (Ein Quadratklafter ist, wie das Wort sagt, der Flächeninhalt eines Quadrats mit einem Klafter Länge und einem Klafter Breite.) Der zweite Bauer hat wenigstens ein Feld mit sechs mal zwei, also mit zwölf Quadratklaftern Flächeninhalt. Und die Flächeninhalte der Felder des dritten und des vierten Bauern betragen fünf mal drei, also 15, und vier mal vier, also gar 16 Quadratklafter. Darum war seit jeher das Multiplizieren so wichtig: Die Flächeninhalte von Rechtecken kann man damit ausrechnen, wenn man deren Längen und Breiten kennt.
Natürlich wussten die Landwirte schon seit grauer Vorzeit, dass der Umfang ihrer Felder kaum eine Rolle spielt, sondern nur deren Flächeninhalt. Zwar kommt in manchen Volksschulbüchern noch immer die Aufgabe vor: „Ein Bauer umzäunt sein Feld. Es ist 30 Meter lang und zehn Meter breit. Wie lang ist der Zaun?“ Aber eine Fahrt übers Land belehrt, dass dieses Beispiel kaum Realitätsbezug hat. Felder sind nicht umzäunt. Wozu auch? Wenn ein Bauer argwöhnt, dass ihm der Nachbar ein Stück von einem seiner Felder wegnimmt, also etwas von seiner Fläche – und natürlich nicht von seinem Umfang – stiehlt, ruft er sofort den „Geometer“. Damit ist ein Vermessungsingenieur gemeint, der mit seinen mathematischen Kenntnissen feststellt, ob der Argwohn des Bauern berechtigt ist oder nicht. Landwirte verlassen sich auf die Mathematik. Sie tun gut daran.