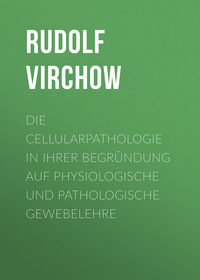Kitap dosya olarak indirilemez ancak uygulamamız üzerinden veya online olarak web sitemizden okunabilir.
Kitabı oku: «Die Cellularpathologie in ihrer Begründung auf physiologische und pathologische Gewebelehre», sayfa 11
Ich will damit jedoch keineswegs behauptet haben, dass alle Dinge, welche man gelegentlich elastische Fasern nennt, auf dieselbe Weise entstehen. Im Netzknorpel wird die Intercellularsubstanz von sehr starken, rauhen Fasern durchsetzt, welche die gewöhnlich runden Zellen umziehen, aber weder einen Zusammenhang mit ihnen haben, noch aus ihnen hervorgehen. Manche neuere Beobachter sind der Meinung, dass in ähnlicher Weise auch die elastischen Fasern des Bindegewebes Producte der Intercellularsubstanz seien. Dieses scheint mir unrichtig zu sein. Allerdings verdichtet sich auch die Intercellularsubstanz des Bindegewebes an gewissen Orten zu einer homogenen, glasartigen, strukturlosen Membran von ganz ähnlichem Aussehen, wie die elastischen Fasern. Dahin gehören namentlich die sogenannten Tunicae propriae der Drüsenkanäle, z. B. der Niere, der Schweissdrüsen, für welche die englische Terminologie den Namen der Basement membranes eingeführt hat. Dahin scheint auch das Sarkolemm der Muskelprimitivbündel zu zählen zu sein, welches allerdings den Eindruck einer Zellmembran macht, welches aber erst im Laufe der späteren Entwickelung mehr hervortritt und gelegentlich z. B. in den Trichinen-Kapseln eine kolossale Dicke erreicht. Manche dieser Bildungen hat man, nach Analogie der Chitinhäute niederer Thiere, als eine Ausscheidung der Zellen, als sogenannte Cuticulae aufgefasst, indess passt diese Bezeichnung nur für solche Häute, welche nach aussen von den Zellen liegen, nicht für solche, welche, wie die Tunicae propriae der Drüsenkanäle, nach innen von denselben sich befinden. Wenn ich daher für die elastischen Membranen eine Ableitung derselben aus der Intercellularsubstanz zulasse, so halte ich doch daran fest, dass die eigentlichen elastischen Fasern aus den Zellkörpern des Bindegewebes entstehen.
Bis jetzt ist nicht mit Sicherheit ermittelt, ob die Verdichtung (Sklerose) der Zellen bei dieser Umwandlung so weit fortgeht, dass ihre Leitungsfähigkeit völlig aufgehoben, ihr Lumen ganz beseitigt wird, oder ob im Innern eine kleine Höhlung übrig bleibt. Auf Querschnitten feiner elastischer Fasern sieht es so aus, als ob das Letztere der Fall sei, und man könnte sich daher vorstellen, dass bei der Umbildung der Bindegewebskörperchen in elastische Fasern eben nur eine Verdichtung und Verdickung mit gleichzeitiger chemischer Umwandlung an ihren äusseren Theilen stattfände, schliesslich jedoch ein Minimum des Zellenraumes übrig bliebe. Was für eine Substanz es ist, welche die elastischen Theile bildet, ist nicht ermittelt, weil sie absolut unlöslich ist; man kennt von der chemischen Natur dieses Gewebes nichts, als einen Theil seiner Zersetzungs-Produkte. Daraus lässt sich aber weder seine Zusammensetzung, noch seine chemische Stellung zu den übrigen Geweben beurtheilen.
Elastische Fasern finden sich überaus verbreitet in der äusseren Haut (Cutis), namentlich in den tieferen Schichten der eigentlichen Lederhaut; sie bedingen hauptsächlich die ausserordentliche Resistenz dieses Theiles, die sich auch nach dem Tode erhält und von der die Güte der Schuhsohlen und anderer, starker Abnutzung ausgesetzter, aus Leder gefertigter Geräthe abhängt. Die verschiedene Festigkeit der einzelnen Schichten der Haut beruht wesentlich auf ihrem grösseren oder geringeren Gehalt an elastischen Fasern. Den oberflächlichsten Theil der Cutis dicht unter dem Rete Malpighii bildet der Papillarkörper, worunter man nicht nur die Papillen selbst, sondern auch eine Lage von flach fortlaufender Cutissubstanz mit kleinen Bindegewebskörperchen zu verstehen hat. In die Papillen selbst steigen nur feine elastische Fasern und zwar in Bündelform auf. In der Basis der Papillen erscheinen dann zuerst feine und enge Maschennetze (Fig. 17, P, P), welche nach der Tiefe zu mit dem sehr dicken und groben elastischen Netz zusammenhängen, welches den mittleren, am meisten festen Theil der Haut, die eigentliche Lederhaut (Derma) durchsetzt. Darunter folgt endlich ein noch gröberes Maschennetz innerhalb der weniger dichten, aber immerhin noch sehr soliden, unteren Schicht der Cutis, welche endlich in das Fett- oder Unterhautgewebe (die Unterhaut) übergeht.
Wo eine solche Umwandlung der Bindegewebskörperchen in elastisches Gewebe stattgefunden hat, da trifft man manchmal fast gar keine deutlichen Zellen mehr. So ist es nicht bloss an der Cutis, sondern auch namentlich an gewissen Stellen der mittleren Arterienhaut, namentlich der Aorta. Hier wird das Netz von elastischen Fasern so überwiegend, dass es nur bei grosser Sorgfalt möglich ist, hier und da feine zellige Elemente dazwischen zu entdecken. In der Cutis dagegen findet man neben den elastischen Fasern eine etwas grössere Menge von kleinen Elementen, die ihre zellige Natur noch erhalten haben, allerdings in äusserst minutiöser Grösse, so dass man danach besonders suchen muss. Sie liegen gewöhnlich in den Räumen, welche von den grossmaschigen Netzen der elastischen Fasern umgrenzt werden; sie bilden hier entweder ein vollkommen anastomotisches, kleinmaschiges System, oder sie erscheinen auch wohl als mehr gesonderte, rundlich-ovale Gebilde, indem die einzelnen Zellen nicht deutlich mit einander in Verbindung stehen. Dies ist namentlich in dem Papillarkörper der Haut der Fall, der sowohl in seiner ebenen Schicht, als in den Papillen zahlreiche kernhaltige Zellen führt, im geraden Gegensatze zu der zugleich mehr gefässarmen eigentlichen Lederhaut. Es bedarf der Papillarkörper einer ungleich zahlreicheren Menge von Gefässen, da diese zugleich das Ernährungsmaterial für das ganze, über der Papille liegende und für sich gefässlose Oberhautstratum liefern müssen. Trotz der verhältnissmässigen Grösse dieser Gefässe bleibt doch nur eine kleine Menge Ernährungssaft der Papille als solcher zur Disposition. Jeder Papille entspricht daher ein gewisser Abschnitt der darüber liegenden Oberhaut, welcher mit der Papille zusammen einen einzigen vasculären oder Ernährungsbezirk darstellt. Innerhalb dieses Bezirkes zerfällt sowohl die Oberhaut, als auch die Papille als solche wieder in so viele Elementar- (histologische) Territorien, als überhaupt Elemente (Zellen) darin vorhanden sind.

Fig. 53. Injectionspräparat von der Haut, senkrechter Durchschnitt. E Epidermis, R Rete Malpighii, P die Hautpapillen mit den auf- und absteigenden Gefässen (Schlingen). C Cutis. Vergr. 11.
Die Unterhaut (tela subcutanea) besteht an den meisten Stellen des Körpers keineswegs, wie man noch jetzt so häufig hört, aus Zellgewebe, sondern aus Fettgewebe (panniculus adiposus). Sie verhält sich in dieser Beziehung ganz ähnlich, wie an sehr vielen Orten das subseröse Gewebe, welches gleichfalls eine vorwiegende Neigung zur Fettabsetzung erkennen lässt. Die subpericardialen, subpleuralen, subperitonäalen, subsynovialen Schichten sind bei gut genährten Personen mehr oder weniger vollständig aus Fettgewebe gebildet. Wesentlich verschieden verhält sich das submucöse Gewebe, welches wohl gelegentlich wahres Fettgewebe ist, jedoch meist aus loserem Bindegewebe, seltener aus Schleimgewebe besteht. Ihnen am nächsten steht unter den subcutanen Lagern die Unterhaut des Scrotum (Tunica dartos), welche überdies noch dadurch ein besonderes Interesse darbietet, dass sie ausnehmend reich an Gefässen und Nerven ist, ganz entsprechend der besonderen Bedeutung dieses Theiles, und dass sie ausserdem eine grosse Masse von organischen Muskeln und zwar von jenen kleinen Hautmuskeln besitzt, die ich früher erwähnt habe (S. 58). Letztere sind die eigentlich wirksamen Elemente der contractilen Tunica dartos. Gerade hier, wo man früher auf contractiles Zellgewebe zurückgegangen war, ist die Menge der kleinen Hautmuskeln überaus reichlich; die kräftigen Runzelungen des Hodensackes entstehen einzig und allein durch die Contraction dieser feinen Bündel, welche man namentlich nach Carminfärbung sehr leicht von dem Bindegewebe unterscheiden kann. Es sind Fascikel von ziemlich gleicher Breite, meist breiter, als die Bindegewebsbündel; die einzelnen Elemente sind in ihnen in Form von langen glatten Faserzellen zusammengeordnet. Jedes Muskel-Fascikel zeigt, wenn man es mit Essigsäure behandelt, in regelmässigen Abständen jene eigenthümlichen, langen, häufig stäbchenartigen Kerne der glatten Muskulatur, und zwischen denselben eine streifige Abtheilung nach den einzelnen Zellen, deren Inhalt ein leicht körniges Aussehen hat. Das sind die Runzler des Hodensackes (Corrugatores scroti). Daneben finden sich in der überaus weichen Haut auch noch eine gewisse Zahl von feinen elastischen Elementen und in grösserer Menge das gewöhnliche weiche, lockige Bindegewebe mit einer grossen Zahl verhältnissmässig umfangreicher, spindel- und netzförmiger, schwach granulirter Kernzellen.

Fig. 54. Schnitt aus der Tunica dartos des Scrotums. Man sieht nebeneinander parallel eine Arterie (a), eine Vene (v) und einen Nerven (n); erstere beide mit kleinen Aesten. Rechts und links davon organische Muskelbündel (m, m) und dazwischen weiches Bindegewebe (c, c) mit grossen anastomosirenden Zellen und feinen elastischen Fasern. Vergr. 300.
Das weiche Bindegewebe verhält sich daher, abgesehen von den in dasselbe eingelagerten, dem Bindegewebe als solchem nicht angehörigen Theilen (Gefässen, Nerven, Muskeln, Drüsen), wie das harte: überall ein Netz verzweigter und unter einander anastomosirender Zellen in einer, grossen Schwankungen der Consistenz und der inneren Zusammensetzung unterworfenen Grundsubstanz. Um jedoch die grosse Verschiedenheit der Ansichten, die noch immer über diesen schwierigen Gegenstand besteht, nicht zu verschweigen, so wollen wir hier erwähnen, dass eine grosse Zahl auch der neuesten Beobachter nicht bloss die zellige, sondern sogar die körperliche Natur der von mir beschriebenen Bindegewebszellen oder Bindegewebskörperchen, sowie aller der ihnen aequivalenten Gebilde (Knochen-, Hornhaut-, Sehnen-Körperchen) geradezu in Abrede stellt, und an die Stelle derselben blosse Zwischenräume, Aushöhlungen oder Lücken (Lacunen) setzt, welche sich zwischen den Bündeln oder Lamellen des Gewebes an den Punkten finden sollen, wo die Bündel oder Lamellen nicht vollständig mit einander in Berührung kommen. Die Erfahrung, dass die Bindegewebsmassen, welche an die Oberfläche treten, an verschiedenen Orten mit einer derberen, mehr homogenen, zuweilen elastischen oder glasartigen Haut oder Schicht (Tunica propria S. 134) bedeckt sind, ist zu Hülfe genommen worden, um zu erklären, dass auch jene Zwischenräume, Aushöhlungen oder Lücken von wirklichen Membranen umgrenzt sein könnten, ohne dass diese Membranen einem Zellkörper zugehörten. Selbst der Umstand, dass ich auf verschiedene Weise sowohl aus dem Binde- und Schleimgewebe, als auch aus Knochen und anderen Hartgebilden verästelte Körper isolirt habe, eine Erfahrung, welche durch zahlreiche andere Untersucher, wie Fel. Hoppe, His, Kölliker, H. Müller, Leydig, v. Hessling, A. Förster bestätigt ist, hat den Kritikern nicht genügt; man hat dagegen erklärt, dass auch eine blosse Lücke, die von Membranen umgrenzt sei, sich durch Auflösen der umliegenden Substanz isoliren lasse. Man übersah dabei, dass aus frischen Geweben die Isolations-Methode nicht bloss Membranen, sondern wirkliche Körper mit solidem Inhalt liefert. Solche Widersprüche lassen sich durch blosse Debatten und Reden überhaupt nicht zum Schweigen bringen. Hier kann nur die eigene Erfahrung genügen, sobald sie mit philosophischem Sinne, mit genauer Berücksichtigung der Histogenie und in möglich grösster Ausdehnung über das gesammte Gebiet der thierischen Organisation ausgeführt wird. Sicherlich gibt es Bindegewebslager und Bindegewebsbündel, deren oberflächlichste Schicht durch spätere Differenzirung eine hautartige Verdichtung erfahren hat, und welche also eine Art von Hülle oder Scheide besitzen, aber eben so sicher ist es, dass dies keine allgemein-gültige Erfahrung ist, und dass, selbst wenn sie allgemein wäre und wenn sie auch für die inneren Einrichtungen des weichen und harten Bindegewebes, der Knochen und Sehnen Gültigkeit hätte, daraus doch weiter nichts folgen würde, als dass auch die Bindegewebs-, Knochen- und Sehnenkörperchen sich, wie die Knorpelkörperchen, mit einer besondern Kapselmembran umgeben könnten. Nachdem selbst so hartnäckige Opponenten, wie Henle, zugestanden haben, dass im Innern jener sogenannten Lücken sehr häufig Kerne, Inhalt (Protoplasma), ja wirkliche Zellen zu finden seien, so bewegt sich der Streit nur noch um die Formel, nicht mehr um die Thatsachen. Meiner Anschauung genügt das Zugeständniss, dass in diesen Geweben, namentlich im Bindegewebe, verzweigte und zusammenhängende Röhrchen und Canälchen existiren, welche sich an gewissen Knotenpunkten zu grösseren Lacunen sammeln, und dass diese Röhrchen, Canälchen und Lacunen von zelligen Theilen erfüllt sind, welche sowohl bei der ersten Anlage des Gewebes vorhanden sind, als sich durch das ganze Leben des Individuums erhalten können28.
Diese persistirenden Zellen des Bindegewebes hat man früher völlig übersehen, indem man als die eigentlichen Elemente des Bindegewebes die Fibrillen desselben betrachtete. Wie wir schon früher (S. 41) gesehen haben, so liegen diese Fibrillen in der Regel in Bündeln zusammen. Trennt man die einzelnen Theile des Bindegewebes von einander, so erscheinen kleine Bündel von welliger Form und streifigem, fibrillärem Aussehen. Die Vorstellung von Reichert, dass dieses Aussehen nur durch Faltenbildung bedingt würde, darf in der Ausdehnung, wie sie aufgestellt wurde, nicht angenommen werden; man muss vielmehr neben den Fibrillen eine gleichmässige Grundmasse, eine Art von Kittsubstanz zulassen, welche die Fibrillen innerhalb des Bündels zusammenhält. Nach den Untersuchungen von Rollett scheint dies nicht selten auch im wahren Bindegewebe Mucin zu sein. Indess ist dies eine Frage von untergeordneter Bedeutung, in so fern es ganz und gar unzulässig ist, die der Intercellularsubstanz angehörenden Fibrillen des Bindegewebes als eigentliche organische Elemente zu betrachten. Dagegen ist es äusserst wichtig, zu wissen, dass überall, wo lockeres Bindegewebe sich findet, in der Unterhaut, im Zwischenmuskel-Gewebe, in den serösen Häuten, dasselbe durchzogen ist von meist anastomosirenden Zellen, welche auf Längsschnitten parallele Reihen, auf Querschnitten Netze bilden und welche in ähnlicher Weise die Bündel des Bindegewebes von einander scheiden, wie die Knochenkörperchen die Lamellen der Knochen, oder wie die Hornhautkörperchen die Blätter der Hornhaut.
Neben ihnen finden sich überall die mannichfachsten Gefässverästelungen, und zwar namentlich so viele Capillaren, dass eine besondere Leitungs-Einrichtung des Gewebes selbst geradezu unnöthig erscheinen könnte. Allein dieser Schluss ist nur bei oberflächlicher Betrachtung richtig. Eine genauere Erwägung ergiebt, dass auch diese Gewebe, so günstig ihre Capillarbahnen liegen, einer Einrichtung bedürfen, welche die Möglichkeit darbietet, dass eine Special-Vertheilung der ernährenden Säfte auf die einzelnen zelligen Bezirke in gleichmässiger und dem jeweiligen Bedürfnisse entsprechender Weise stattfinde. Erst wenn man die Aufnahme des Ernährungsmaterials als eine Folge der Thätigkeit (Anziehung) der Gewebs-Elemente selbst auffasst, begreift man, dass die einzelnen Bezirke nicht jeden Augenblick der Ueberschwemmung vom Blute aus preisgegeben sind, dass vielmehr das in dem Blute dargebotene Material nur nach dem wirklichen Bedarf in die Theile aufgenommen und den einzelnen Bezirken in verschiedenem Maasse zugeführt wird. So erklärt es sich auch, dass unter normalen Verhältnissen der eine Theil nicht durch die anderen in seinem Bestande wesentlich benachtheiligt wird.
Auf diese Weise erscheint die Ernährung in einer unmittelbaren Beziehung zu dem Leben der einzelnen Theile, dessen Fortdauer trotz der durch die Thätigkeit und die Verrichtungen des Theiles eintretenden Veränderungen ja eben nur möglich ist durch eine mit Wechsel der Stoffe verbundene Erhaltung und Ernährung der natürlichen Zusammensetzung. Diese Erhaltung setzt aber ihrerseits bleibende regulatorische Einrichtungen in jedem einzelnen Theile voraus, in der Art, dass der Theil für sich eine bestimmende Einwirkung auf Abgabe und Aufnahme von Stoffen ausübt, in ähnlicher Weise, wie dies auch bei den Theilen der Pflanze stattfindet. Denn der Begriff der Vegetation beherrscht dieses ganze Gebiet des thierischen Lebens. Schon die erste Darstellung, welche ich von den Ernährungseinheiten und Krankheitsheerden des menschlichen Körpers gegeben habe29, stützte sich wesentlich auf den Parallelismus, der durch das ganze Gebiet des Organischen geht, und jede weitere Forschung hat diese Anschauung nur bestärkt. Die einzelne Zelle innerhalb eines Gewebes wird nicht ernährt, sondern sie ernährt sich, d. h. sie entnimmt den Ernährungsflüssigkeiten, welche sich in ihrer Umgebung befinden, den für sie erforderlichen Theil. Sowohl quantitativ, als qualitativ ist die Ernährung daher ein Ergebniss der Thätigkeit der Zelle, wobei sie natürlich abhängig ist von Quantität und Qualität des ihr erreichbaren Ernährungsmaterials, aber keineswegs in der Art, dass sie genöthigt wäre, aufzunehmen, was und wie viel ihr zufliesst. Gleichwie die einzelne Zelle eines Pilzes oder einer Alge aus der Flüssigkeit, in der sie lebt, sich so viel und so beschaffenes Material nimmt, als sie für ihre Lebenszwecke braucht, so hat auch die Gewebszelle inmitten eines zusammengesetzten Organismus elective Fähigkeiten, vermöge welcher sie gewisse Stoffe verschmäht, andere aufnimmt und in sich verwendet. Das ist die eigentliche Nutrition im cellularen Sinne.
Siebentes Capitel.
Circulation und Blutmischung
Arterien. Ihre Zusammensetzung: Epithel, Intima, Media (Muscularis), Adventitia. Capillaren. Capillare Arterien und Venen. Continuität der Gefässwand. Porosität derselben. Hæmorrhagia per diapedesin. Venen. Gefässe in der Schwangerschaft.
Eigenschaften der Gefässwand:
1) Contractilität. Rhythmische Bewegung. Active oder Reizungs-Hyperämie. Ischämie. Gegenreize. Collaterale Fluxion.
2) Elasticität und Bedeutung derselben für die Schnelligkeit und Gleichmässigkeit des Blutstromes. Erweiterung der Gefässe.
3) Permeabilität. Diffusion. Specifische Affinitäten. Verhältniss von Blutzufuhr und Ernährung. Die Drüsensecretion (Leber). Specifische Thätigkeit der Gewebselemente.
Dyskrasie. Transitorischer Charakter und localer Ursprung derselben. Säuferdyskrasie. Hämorrhagische Diathese. Syphilis.
In den letzten Capiteln habe ich in eingehender Weise versucht, ein Bild von den feineren Einrichtungen für die Saftströmungen innerhalb der Gewebe zu liefern, und zwar namentlich von denjenigen, wo die Säfte selbst sich der Beobachtung mehr entziehen. Wenden wir uns nunmehr zu den gröberen Wegen und den edleren Säften, welche in der gangbaren Anschauung bis jetzt eigentlich allein Berücksichtigung fanden.

Fig. 55. A. Epithel von der Cruralarterie (Archiv f. path. Anat. Bd. III. Fig. 9 und 12. S. 569). a Kerntheilung.
B. Epithel von grösseren Venen. a, a Grössere, granulirte, runde, einkernige Zellen (farblose Blutkörperchen?). b, b Längliche und spindelförmige Zellen mit getheiltem Kern und Kernkörperchen. c Grosse, platte Zellen mit zwei Kernen, von denen jeder drei Kernkörperchen besitzt und in Theilung begriffen ist. d Zusammenhängendes Epithel, die Kerne in progressiver Theilung, eine Zelle mit sechs Kernen. Vergr. 320.
Die Vertheilung des Blutes im Körper ist zunächst abhängig von der Vertheilung der Gefässe innerhalb der einzelnen Organe. Indem die Arterien sich in immer feinere Aeste auflösen, ändert sich allmählich auch der Habitus ihrer Wandungen, so dass endlich feine Kanäle mit einer scheinbar so einfachen Wand, wie sie überhaupt im Körper angetroffen wird, sogenannte Haarröhrchen (Capillaren), daraus hervorgehen. Histologisch ist dabei Folgendes zu bemerken:
Jede Arterie hat verhältnissmässig dicke Wandungen, und selbst an denjenigen Arterien, die man mit blossem Auge eben noch als feinste Fädchen verfolgen kann, unterscheidet man mit Hülfe des Mikroskopes nicht bloss die bekannten drei Häute, sondern noch ausser diesen eine feine Epithelialschicht, welche die innere Oberfläche bekleidet; sie pflegt gewöhnlich nicht als eine besondere Haut bezeichnet zu werden. Die innere und äussere Haut (Intima und Adventitia) sind wesentlich Bindegewebsbildungen, welche in grösseren Arterien einen zunehmenden Gehalt an elastischen Fasern erkennen lassen; zwischen ihnen liegt die verhältnissmässig dicke, mittlere oder Ringfaserhaut, welche als Sitz der Muskulatur fast den wichtigsten Bestandtheil der Arterienwand ausmacht. Die Muskulatur findet sich am reichlichsten in den mittleren und kleineren Arterien, während in den ganz grossen, namentlich in der Aorta, elastische Blätter den überwiegenden Bestandtheil auch der Ringfaserhaut ausmachen. An kleinen Arterien bemerkt man bei mikroskopischer Untersuchung leicht innerhalb dieser mittleren Haut (vergl. Fig. 28 b, b. Fig. 54 a) kleine Quer-Abtheilungen, entsprechend den einzelnen musculösen Faserzellen, welche so dicht um das Gefäss herumliegen, dass wir Faserzelle neben Faserzelle fast ohne irgend eine Unterbrechung finden. Die Dicke dieser Schicht kann man durch die Begrenzung, welche sie nach innen und aussen durch Längsfaserhäute erfährt, bequem erkennen; das einzige Täuschende sind runde Zeichnungen, welche man hie und da in der Dicke der Ringfaserhaut, aber nur am Rande der Gefässe (Fig. 28 b, b. Fig. 56 m, m) erblickt, und welche wie eingestreute runde Zellen oder Kerne aussehen. Dies sind die im scheinbaren Querschnitte gesehenen Faserzellen oder deren Kerne. Am deutlichsten aber erkennt man die Lage der Media nach Behandlung mit Essigsäure, welche in der Flächenansicht des Gefässes längliche, quergelagerte Kerne in grosser Zahl hervortreten lässt.

Fig. 56. Kleinere Arterie aus der Sehnenscheide der Extensoren einer frisch amputirten Hand. a, a Adventitia. m, m Media mit starker Muskelhaut, i, i Intima, theils mit Längsfalten, theils mit Längskernen, an dem Seitenaste aus den durchrissenen äusseren Häuten hervorstehend. Vergr. 300.
Diese Schicht ist es, welche im Allgemeinen der Arterie ihre Besonderheit gibt, und welche sie am deutlichsten unterscheidet von den Venen. Freilich gibt es zahlreiche Venen im Körper, die bedeutende Muskelschichten besitzen, z. B. die oberflächlichen Hautvenen, besonders an den Extremitäten, indess tritt doch bei keiner derselben die Muskelschicht als eine so deutlich abgegrenzte, gleichsam selbständige Haut hervor, wie die Media der Arterien. Bei den kleineren Gefässen beschränkt sich dieses Vorkommen einer deutlich ausgesprochenen Ringfaserhaut wesentlich auf arterielle Gefässe, so dass man sofort geneigt ist, wo man mikroskopisch einen solchen Bau findet, auch die arterielle Natur des Gefässes anzunehmen.
Diese auch bei mikroskopischer Betrachtung immer noch grösseren Arterien, die freilich selbst im gefüllten Zustande für das blosse Auge nur als rothe Fäden erscheinen, gehen nach und nach in kleinere über. Bei dreihundertmaliger Vergrösserung sehen wir sie sich in Aeste auflösen, und auch auf diese setzen sich, selbst wenn sie sehr klein (im vulgären Sinne schon capillar) sind, zunächst die drei Häute noch fort, Erst an den kleinsten Aesten verschwindet endlich die Muskelhaut, indem die Abstände zwischen den einzelnen Querfasern immer grösser werden und zugleich immer deutlicher die innere Haut durch sie hindurchscheint, deren längsliegende Kerne sich mit denen der mittleren unter einem rechten Winkel kreuzen (Fig. 28 D, E). Auch die Adventitia oder äussere Haut lässt sich noch eine Strecke weit verfolgen (an manchen Stellen, wie am Gehirn, häufig durch Einstreuung von Fett oder Pigment deutlicher bezeichnet, Fig. 28 D, E), bis endlich auch sie sich verliert und nur die einfache Haar-Röhre übrig bleibt (Fig. 4, c). Die Vermuthung würde also dafür sprechen, dass die eigentlichen Capillar-Membranen mit der Intima der grösseren Gefässe zu vergleichen wären, indess haben die neueren Erfahrungen (S. 60) vielmehr die Anschauung genährt, dass auch die Intima der Arterien in den Capillaren verschwinde und dass die Epithelialschicht zuletzt allein übrig bleibe.
Ich bemerke dabei ausdrücklich, dass die gewöhnliche Sprache der Pathologen und noch mehr die der Aerzte den Ausdruck der Capillaren in einer sehr willkürlichen Weise verwendet, und dass namentlich sehr häufig Gefässe, die mit blossem Auge noch als Linien, Striche oder Netze erkannt werden, Capillaren genannt werden. Dies sind jedoch in der Regel wirkliche Arterien oder Venen: Capillaren im strengen Sinne des Wortes sind makroskopisch unsichtbar. Man mag nun immerhin auch von capillaren Arterien und capillaren Venen sprechen, indess folgen aus einem solchen Sprachgebrauch leicht grosse Irrthümer, und derselbe ist daher keineswegs empfehlenswerth. Man muss aber wissen, dass selbst in der mikrographischen Sprache bis in die neueste Zeit hinein ähnliche Verwechselungen sehr gewöhnlich waren und dass daraus manche Missverständnisse sich erklären, welche bei einer strengeren Terminologie leicht hätten vermieden werden können.
Innerhalb der eigentlich capillären Auflösung ist an den Gefässen weiter nichts bemerkbar, als die früher schon erwähnten Kerne, deren Längsausdehnung der Längsaxe des Gefässes entspricht, und welche so in die Gefässwand eingesetzt sind, dass man eine zellige Abtheilung um sie herum ohne besondere chemische Hülfsmittel nicht weiter zu erkennen vermag. Die Gefässhaut erscheint hier ganz gleichmässig, absolut homogen und absolut continuirlich Fig. 4, c). Während man noch vor 20 Jahren darüber discutirte, ob es nicht Gefässe gäbe, welche keine eigentlichen Wandungen hätten und nur Aushöhlungen, Ausgrabungen des Parenchyms30 der Organe seien, sowie darüber, ob Gefässe dadurch entstehen könnten, dass von den alten Lichtungen aus sich neue Bahnen durch Auseinanderdrängen des benachbarten Parenchyms eröffneten, so ist heut zu Tage kein Zweifel mehr, dass das menschliche Gefässsystem, mit Ausnahme der Milz und der mütterlichen Placenta, überall continuirlich durch Membranen geschlossen ist. An diesen Membranen ist es nicht mehr möglich, eine Porosität zu sehen. Selbst die feinen Poren, welche man in der letzten Zeit an verschiedenen anderen Theilen wahrgenommen, haben bis jetzt an der Gefässhaut kein Analogon gefunden; wenn man von der Porosität der Gefässwand spricht, so kann dies nur in physikalischem Sinne von unsichtbaren, eigentlich molekularen Interstitien oder in grob mechanischem Sinne von wirklichen Continuitätstrennungen geschehen. Eine Collodiumhaut erscheint nicht homogener, nicht continuirlicher, als die Capillarhaut. Eine Reihe von Möglichkeiten, die man früher zuliess, z. B. dass an gewissen Punkten die Continuität der Capillarmembran nicht bestände, fallen einfach weg. Von einer „Transsudation“ oder Diapedese des Blutes durch die Gefässhaut, ohne Ruptur oder Hiatus derselben, kann gar nicht weiter die Rede sein. Denn obwohl wir die Rupturstelle oder Spalte nicht in jedem einzelnen Falle anatomisch nachweisen können, so ist es doch ganz undenkbar, dass das Blut mit seinen Körperchen anders, als durch ein Loch in der Gefässwand austreten könne. Dies versteht sich nach histologischen Erfahrungen so sehr von selbst, dass darüber keine Discussion zulässig ist.
Nachdem die Capillaren eine Zeit lang fortgegangen sind, so setzen sich nach und nach aus ihnen kleine Venen zusammen, welche gewöhnlich in nächster Nähe der Arterien zurücklaufen (Fig. 54, v). Nicht ganz selten wird eine Arterie von zwei Venen begleitet, die zu beiden Seiten derselben liegen. An den Venen fehlt im Allgemeinen die charakteristische Ringfaserhaut der Arterien, oder sie ist wenigstens sehr viel weniger ausgebildet. Dafür trifft man in der Media der stärkeren Venen derbere Lagen, die sich nicht so sehr durch die Abwesenheit von Muskel-Elementen, als durch das reichlichere Vorkommen longitudinell verlaufender elastischer Fasern charakterisiren; je nach den verschiedenen Localitäten zeigen sie verschiedene Mächtigkeit. Nach innen folgen dann die weicheren und feineren Bindegewebslagen der Intima, und auf dieser findet sich wieder zuletzt ein plattes, ausserordentlich durchscheinendes Epitheliallager, das am Schnittende sehr leicht aus dem Gefässe hervortritt und oft den Eindruck von Spindelzellen macht, so dass es leicht verwechselt werden kann mit spindelförmigen Muskelzellen (Fig. 57). Die kleinsten Venen besitzen ein ähnliches Epithel, bestehen aber ausserdem eigentlich ganz aus einem mit Längskernen versehenen Bindegewebe (Fig. 54, v).

Fig. 57. Epithel der Nierengefässe. A. Flache, längs gefaltete Spindelzellen mit grossen Kernen vom Neugebornen. B. Bandartige, fast homogene Epithelplatte mit Längskernen vom Erwachsenen. Vergr. 350.
Diese Verhältnisse erleiden keine wesentliche Aenderung, wenn auch die einzelnen Theile des Gefässapparates die äusserste Vergrösserung erfahren. Am besten sieht man dies bei der Schwangerschaft, wo nicht bloss am Uterus, sondern auch an der Scheide, an den Tuben und Eierstöcken, sowie an den Mutterbändern sowohl die grossen und kleinen Arterien und Venen, als auch die Capillaren eine so beträchtliche Erweiterung zeigen, dass das übrige Gewebe, trotzdem dass es sich gleichfalls nicht unerheblich vergrössert, dadurch wesentlich in den Hintergrund gedrängt wird. Indess eignen sich doch gerade Theile des puerperalen Geschlechtsapparates vortrefflich dazu, das Verhältniss der Gewebs-Elemente zu den Gefässbezirken zu übersehen. An den Fimbrien der Tuben sieht man innerhalb der Schlingennetze, welche die sehr weiten Capillaren gegen den Rand hin bilden, immer noch eine grössere Zahl von grossen Bindegewebszellen zerstreut, von denen nur einzelne den Gefässen unmittelbar anliegen. In den Eierstöcken, besonders aber an den Alae vespertilionum findet man ausserdem sehr schön ein Verhältniss, welches sich an den Anhängen des Generations-Apparates öfter wiederholt, ähnlich dem, wie wir es beim Scrotum betrachtet haben (S. 137); die Gefässe werden nehmlich von ziemlich beträchtlichen Zügen glatter Muskeln begleitet, welche nicht ihnen angehören, sondern nur dem Gefässverlaufe folgen und zum Theil die Gefässe in sich aufnehmen. Es ist dies ein äusserst wichtiges Element, insofern die Contractionsverhältnisse jener Ligamente, welche man gewöhnlich nicht als muskulös betrachtet, keinesweges bloss den Blutgefässen zuzuschreiben sind, wie erst neuerlich James Traer nachzuweisen gesucht hat; vielmehr gehen reichliche Züge von Muskeln mitten durch die Ligamente fort, welche in Folge davon bei der menstrualen Erregung in gleicher Weise die Möglichkeit zu Zusammenziehungen darbieten, wie wir sie an den äusseren Abschnitten der Geschlechtswege mit so grosser Deutlichkeit wahrnehmen können. An der weiblichen Scheide habe ich im Prolapsus auf mechanische oder psychische Erregungen eben so starke Querrunzelungen auftreten und bei Nachlass derselben wieder verschwinden sehen, wie es am männlichen Scrotum bekannt ist. —