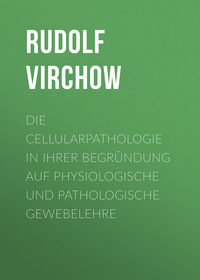Kitabı oku: «Die Cellularpathologie in ihrer Begründung auf physiologische und pathologische Gewebelehre», sayfa 34
Neunzehntes Capitel.
Gemischte, activ-passive Prozesse. Entzündung
Fettmetamorphose als Entzündungs-Ausgang. Unterschied zwischen primärer (einfacher) und secundärer (entzündlicher) Fettmetamorphose. Nieren, Muskeln.
Atheromatöser Prozess der Arterien. Atheromatie und Ossification als Folgen der Arteriosklerose. Entzündlicher Charakter der letzteren: Endoarteriitis chronica deformans s. nodosa. Bildung der Atheromheerde. Cholestearin-Abscheidung. Ossification. Ulceration. Analogie mit der Endocarditis.
Die Entzündung. Die vier Cardinalsymptome und deren Vorherrschen in den einzelnen Schulen. Die thermische und vasculäre Theorie, die neuropathologische, die Exsudatlehre. Entzündungsreiz. Functio laesa. Die Entzündung in gefässlosen und in gefässhaltigen Theilen. Das Exsudat als Folge der Gewebsthätigkeit: Schleim und Fibrin. Die Entzündung als zusammengesetzter Reizungsvorgang. Parenchymatöse und exsudative (secretorische) Form. Klinische und anatomische Bedeutung der Entzündung. Irrthum von der einheitlichen Natur der Entzündungs-Vorgänge. Multiplicität der entzündlichen Prozesse.
Die Betrachtung der passiven Prozesse hatte uns zu einer Darstellung der Vorgänge bei der Fettmetamorphose geführt. Ich sage Fettmetamorphose, einmal weil unter der Bezeichnung der fettigen Degeneration im Laufe der Zeit zu vielerlei Vorgänge zusammengeworfen sind, andermal weil ich in der That die Ansicht hege, dass das Fett hier durch eine chemische Metamorphose aus dem früheren Zelleninhalt, also vielleicht aus eiweissartiger Substanz erzeugt wird. Jedenfalls geht nicht nur die normale Struktur der Theile dabei zu Grunde, sondern es tritt auch an die Stelle der histologischen Elemente, welche zerfallen und sich auflösen, eine nicht mehr organische, rein emulsive Masse, es bildet sich, kurz gesagt, ein fettiger Detritus. Es macht dabei nichts aus, ob eine Eiterzelle, ein Bindegewebskörperchen, eine Nerven- oder Muskelfaser, ein Gefäss die Veränderung erfährt; das Resultat ist immer dasselbe: ein milchiger Detritus, eine amorphe Anhäufung von Fett- oder Oeltheilchen in einer mehr oder weniger eiweissreichen Flüssigkeit. Wenn wir für alle Fälle der Fettmetamorphose diese Uebereinstimmung festhalten, so folgt daraus doch keinesweges, dass der Werth dieser Veränderung in Beziehung auf die Krankheitsvorgänge, im Laufe welcher sie eintritt, jedesmal gleich sei. Man kann das schon daraus abnehmen, dass, während ich diese Metamorphose unter der Kategorie der rein passiven Störungen vorgeführt habe, gerade eines der Gebilde, welches dabei am häufigsten auftritt, die Körnchenkugel, lange Zeit hindurch als das specifische Element der Entzündung betrachtet worden ist. Jahrelang sah man die Entzündungskugel für eine wesentliche, pathognomonische und daher diagnostische Erscheinung des Entzündungsprozesses an, und in der That, die Häufigkeit, mit welcher man in entzündeten Theilen fettig degenerirte Zellen findet, beweist genügend, dass im Laufe der entzündlichen Prozesse, welche wir nimmermehr als einfach passive Vorgänge betrachten können, solche Umwandlungen geschehen. Es handelt sich also darum, eine Unterscheidung beider Reihen, der einfach passiven und der entzündlichen, zu finden.
Freilich hat diese Unterscheidung in einzelnen Fällen ihre sehr grossen Schwierigkeiten. Meiner Ueberzeugung nach besteht die einzige Möglichkeit einer Orientirung darin, dass man untersucht, ob der Zustand der fettigen Degeneration ein primärer oder ein secundärer ist, ob er eintritt, sobald überhaupt eine Störung bemerkbar wird, oder ob er erst erfolgt, nachdem eine andere bemerkbare Störung vorangegangen ist. Die secundäre Fettmetamorphose, bei welcher erst in zweiter Linie diese eigenthümliche Umwandelung zu Stande kommt, folgt in der Regel auf ein erstes actives oder irritatives Stadium; eine ganze Reihe derjenigen Prozesse, welche wir ohne Umstände Entzündungen nennen, verläuft in der Weise, dass als zweites oder drittes anatomisches Stadium eine fettige Metamorphose der Gewebe auftritt. Diese entsteht also hier nicht als das unmittelbare Resultat der Reizung des Theiles, sondern wo wir Gelegenheit haben, die Geschichte der Veränderung genauer zu verfolgen, da zeigt sich fast immer, dass dem Stadium der fettigen Degeneration ein anderes Stadium voraufgeht234, nehmlich das der trüben Schwellung, in welchem die Theile sich vergrössern, an Umfang und zugleich an Dichte zunehmen, indem sie eine grosse Menge von neuem Material in sich aufsaugen. Absichtlich sage ich aufsaugen235, weil ich es für falsch halte, dass der Theil etwa von aussen genöthigt worden ist, dieses Material aufzunehmen, dass er etwa durch Exsudat von den Gefässen aus überschwemmt worden ist. Dieselben Erscheinungen treten auch an Theilen auf, die keine Gefässe haben. Aber erst dann, wenn die Ansammlung ein solches Maass erreicht hat, dass die Constitution in Frage gestellt wird, leitet sich ein fettiger Zerfall im Inneren der Elemente ein. So können wir die fettige Degeneration des Nierenepithels als ein späteres Stadium der Bright'schen Krankheit, oder, wie ich sage, der parenchymatösen Nephritis bezeichnen; ihr geht ein Stadium der Hyperämie und Schwellung voraus, wo jede Epithelzelle eine grosse Quantität von opaker Masse in sich ansammelt, ohne dass im Anfange auch nur eine Spur von Fetttröpfchen zu bemerken ist236. So schwillt der Muskel unter Einwirkungen, welche nach dem allgemeinen Zugeständniss eine Entzündung machen, z. B. nach Verwundungen, nach chemischen Aetzungen; seine Primitivbündel werden breiter und trüber, und in einem zweiten Stadium beginnt in ihnen dieselbe fettige Degeneration, welche wir andere Male, z. B. bei Lähmungen, direct auftreten sehen237.
Man kann also, wenn man ganz allgemein spricht, allerdings sagen, dass es eine entzündliche Form der fettigen Degeneration gibt. Allein, genau genommen, ist diese entzündliche Form nur ein späteres Stadium, ein Ausgang, welcher den eintretenden Zerfall der Gewebsstruktur anzeigt, wo der Theil nicht mehr im Stande ist, seine Sonderexistenz fortzuführen, sondern wo er so weit dem Spiele der chemischen Kräfte seiner constituirenden Theile verfällt, dass das nächste Resultat seine vollständige Auflösung ist. Gerade diese Art von Entzündungszuständen hat eine sehr grosse Bedeutung, weil an allen Theilen, wo die wesentlichen Elemente in dieser Weise verändert werden, überhaupt keine unmittelbare, nutritive oder einfach regenerative Restitution möglich ist. Wenn eine Muskelentzündung besteht, bei welcher die Muskelprimitivbündel der fettigen Degeneration verfallen, so gehen sie auch regelmässig zu Grunde, und wir finden nachher an der Stelle, wo die Degeneration stattgefunden hatte, eine, wenn auch nicht offene, Lücke (einen Defect) im Muskelfleisch. Die Niere, deren Epithel in fettige Degeneration übergeht, schrumpft fast immer zusammen; das Resultat ist eine bleibende Atrophie. Ausnahmsweise kommt vielleicht etwas zu Stande, was als Regeneration des Epithels gedeutet werden könnte, aber gewöhnlich ist ein Zusammensinken der ganzen Struktur die Folge. Dasselbe sehen wir am Gehirne bei der gelben Erweichung, gleichviel, wie sie bedingt sein mag. Ob Entzündung oder nicht vorherging, es bildet sich ein Heerd, welcher sich nie wieder mit Nervenmasse ausfüllt. Vielleicht, dass eine einfache Flüssigkeit die fehlenden Gewebe ersetzt; von irgend einer Herstellung eines neuen, functionell wirksamen Theiles kann niemals die Rede sein.
So muss man es sich erklären, dass scheinbar sehr ähnliche Zustände, welche man vom pathologisch-anatomischen Standpunkte aus als identisch erklären möchte, vom klinischen Standpunkte aus weit auseinander liegen, ja dass man an denselben Theilen dieselben Veränderungen trifft, ohne dass doch der Gesammtprozess, welchem sie angehören, derselbe war. Wenn ein Muskel einfach fettig degenerirt, so kann das Primitivbündel ebenso aussehen, als wenn eine Entzündung darauf eingewirkt hat. Die Myocarditis erzeugt ganz analoge Formen der fettigen Degeneration innerhalb des Herzfleisches, wie die übermässige Dilatation der Herzhöhlen. Wenn eine der letzteren z. B. durch Hemmung des Blutstromes oder Incontinenz der Klappen dauernd sehr ausgespannt wird, so tritt an dem am meisten gespannten Theile sehr häufig eine fettige Degeneration des Muskelfleisches ein. Diese gleicht morphologisch so vollständig einem Stadium der Myocarditis, dass in vielen Fällen überhaupt gar nicht mit Sicherheit zu sagen ist, auf welche Weise der Prozess entstanden sein mag.
Versuchen wir, die Methode der Lösung solcher Schwierigkeiten an einer wichtigen, häufigen und zugleich vielfach missverstandenen Krankheit darzulegen, nehmlich an dem sogenannten atheromatösen Prozesse der Arterien238. Gerade bei ihm ist die Confusion in der Deutung der Veränderungen vielleicht am grössten gewesen.
Zu keiner Zeit im Laufe dieses Jahrhunderts hat man sich vollständig über das geeinigt, was man unter dem Ausdrucke der atheromatösen Veränderung an einem Gefässe verstehen wollte. Der Eine hat den Begriff weiter, der Andere hat ihn enger gefasst, und doch ist er vielleicht von Allen zu weit gefasst worden. Als nehmlich die Anatomen des vorigen Jahrhunderts den Namen des Atheroms auf eine bestimmte Veränderung der Arterienhäute anwandten, hatten sie natürlich einen ähnlichen Zustand im Sinne, wie derjenige ist, welchen man schon seit dem griechischen Alterthume an der Haut mit dem Namen des Atheroms, des Grützbalges belegt hatte239. Es versteht sich danach von selbst, dass der Begriff des Atheroms sich auf einen geschlossenen Heerd, eine Art von Balggeschwulst (Tumor cysticus) bezieht. Niemand hat etwas an der Haut Atherom genannt, was offen und frei zu Tage lag. Es war daher ein sonderbares Missverständniss, als man neuerlich anfing, an den Gefässen auch solche Veränderungen Atherome zu nennen, welche nicht abgeschlossen in der Tiefe liegen, sondern ganz und gar der Oberfläche angehören. Anstatt, wie es ursprünglich gemeint war, einen geschlossenen Heerd atheromatös zu nennen, hat man damit häufig eine Veränderung bezeichnet, welche in der innersten Arterienhaut ganz oberflächlich bestand. Als man anfing, die Sache feiner zu untersuchen, und als man an sehr verschiedenen Punkten der Gefässwand, sowohl bei Atherom, als ohne dasselbe, fettige Partikeln fand (Fig. 122), als man sich endlich überzeugte, dass der Prozess der fettigen Degeneration immer derselbe und mit der atheromatösen Veränderung nahezu identisch sei, so wurde es Sitte, alle Formen der fettigen Degeneration an den Arterien in der Bezeichnung des Atheroms oder der Atherose zu vereinigen. Nach und nach kam man sogar dahin, von einer atheromatösen Veränderung solcher Gefässe zu sprechen, welche nur eine einfache Haut haben, denn auch an den Capillaren stösst man auf fettige Processe.
Seit Langem hat es ferner Beobachter gegeben, welche die Ossification der Gefässe als eine mit dem Atherom zusammengehörige Veränderung betrachteten. Haller und Crell glaubten, dass die Ossification aus der atheromatösen Masse hervorginge, und dass die letztere ein Saft sei, welcher ähnlich, wie man es von dem unter dem Periost des Knochens ausschwitzenden Safte annahm, fähig sei, aus sich Knochenplatten zu erzeugen. Später erkannte man freilich, dass Atheromatie und Ossification zwei parallele Vorgänge seien, welche aber auf einen gemeinschaftlichen Anfang hinwiesen. Es wäre nun wohl logisch gewesen, wenn man sich zunächst darüber geeinigt hätte, welches dieser gemeinschaftliche Anfang wäre, von dem die atheromatöse Veränderung und die Ossification ausgingen. Statt dessen gerieth man in die Bahn der fettigen Entartungen und dehnte den atheromatösen Prozess über eine Reihe von kleinen Gefässen aus, an denen die Bildung irgend eines wirklich dem atheromatösen Heerde der Haut vergleichbaren geschlossenen Sackes oder Balges überhaupt unmöglich ist.
Nun liegt aber die Sache auch hier sehr einfach so, dass man an den Gefässen zwei, ihrem endlichen Resultate nach sehr analoge Prozesse trennen muss: zuerst die einfache (passive) Fettmetamorphose, welche ohne ein weiter erkennbares Vorstadium eintritt, wo die vorhandenen Elemente unmittelbar in fettige Degeneration übergehen und zerstört werden, und wodurch eben nur ein mehr oder weniger ausgedehnter Verlust (Usur) von Bestandtheilen der Gefässwand zu Stande kommt; sodann eine zweite Reihe von Vorgängen, wo wir vor der Fettmetamorphose ein Stadium der Reizung unterscheiden können, welches übereinstimmt mit dem Stadium der Schwellung, Vergrösserung, Trübung, das wir an anderen entzündeten Stellen sehen. Ich habe daher kein Bedenken getragen, in dieser Frage mich ganz auf die Seite der alten Anschauung zu stellen, und als den Ausgangspunkt der sogenannten atheromatösen Degeneration eine Entzündung der Gefässwand zuzulassen (Endoarteriitis); und ich habe mich weiterhin bemüht zu zeigen, dass diese Art von entzündlicher Erkrankung der Gefässwand in der That genau dasselbe ist, was man allgemein an den Herzwandungen eine Endocarditis nennt. Zwischen beiden Prozessen besteht kein anderer Unterschied, als dass die Endocarditis häufiger acut, die Endoarteriitis häufiger chronisch verläuft.
Mit einer solchen Scheidung der Prozesse an den Arterien in einfach degenerative (passive) und entzündliche (active) erklärt sich sofort der verschiedene Verlauf. Trügerisch ist nur der Umstand, dass beide Prozesse sich gelegentlich in demselben Falle gleichzeitig finden. Neben den charakteristischen Umwandlungen der chronisch entzündlichen Theile in der Tiefe finden sich an der Oberfläche nicht selten einfach fettige Veränderungen.

Fig. 128. Verticalschnitt durch die Aortenwand an einer sklerotischen, zur Bildung eines Atheroms fortschreitenden Stelle. mm' Tunica media, i i' i″ Tunica intima. Bei S die Höhe der sklerotischen Stelle gegen die Gefässlichtung, i die innerste, über den ganzen Heerd fortlaufende Lage der Intima, i' die wuchernde, sklerosirende und schon zur Fettmetamorphose sich anschickende Schicht, i″ die schon fettig metamorphosirte, bei e, e direkt erweichende, zunächst an die Media anstossende Lage. Vergr. 20.
Betrachten wir nun die Atheromatie etwas genauer, z. B. an der Aorta, wo der Prozess am gewöhnlichsten ist. Im Anfange (d. h. eigentlich zu einer Zeit, wo noch nichts Atheromatöses vorhanden ist) entsteht an der Stelle, wo die Reizung stattgefunden hat, eine Anschwellung, kleiner oder grösser, nicht selten so gross, dass sie als wirklicher Buckel über das Niveau der inneren Oberfläche hervorragt. Diese Hervorragungen unterscheiden sich von der Nachbarschaft durch ihr durchscheinendes, hornhautartiges Aussehen. In der Tiefe sehen sie mehr trübe aus. Hat die Veränderung eine gewisse Dauer gehabt, so zeigen sich die weiteren Umwandelungen nicht an der Oberfläche, sondern unmittelbar da, wo die Intima die Media berührt, wie das die Alten sehr gut beschrieben haben. Wie oft haben sie mit Bestimmtheit behauptet, dass man die innere Haut über die veränderte Stelle hinweg abziehen könne! Daraus ging die Schilderung von Haller hervor, dass die breiartige, atheromatöse Masse in einer geschlossenen Höhle, wie eine kleine Balggeschwulst, zwischen Intima und Media läge. Nur das war falsch, dass man die Geschwulst als einen besonderen, von den Gefässhäuten trennbaren Körper betrachtete, über welchen die sonst unveränderte Intima einfach hinwegliefe. Es ist vielmehr die stark verdickte Intima selbst, welche ohne Grenze in die Geschwulst übergeht. Je weiter der Prozess fortschreitet, um so mehr bildet sich aus der Erweichung und dem Zerfalle der tiefsten Lagen der Intima ein geschlossener Heerd, während die oberflächlichen Schichten sich noch unversehrt erhalten; zuletzt kann es sein, dass der Heerd fluctuirt und beim Einschnitte eine breiige Materie sich entleert, wie der Eiter beim Einschnitte in einen Abscess.
Untersucht man nun die Masse, welche am Ende des Prozesses vorhanden ist, so sieht man zahlreiche Cholestearinplatten, welche oft schon für das blosse Auge als glitzernde Scheibchen hervortreten: grosse rhombische Tafeln, welche meist zu vielen nebeneinanderliegen, sich decken und im Ganzen einen Glimmerreflex erzeugen. Neben diesen Platten finden sich die unter dem Mikroskope bei durchfallendem Lichte schwarz erscheinenden Körnchenkugeln, innerhalb derer die einzelnen Fettkörnchen zuerst ganz fein sind. Die Kugeln sind gewöhnlich in grosser Masse vorhanden; einzelne sieht man zerfallen, sich auseinander lösen und Partikelchen davon, wie in der Milch, umherschwimmen. Daneben mehr oder weniger grosse amorphe Gewebsfragmente, welche noch zusammenhalten und durch die Erweichung der übrigen, nicht fettig veränderten Gewebssubstanz entstehen; in sie sind hie und da Körnerhaufen eingesetzt. Diese drei Bestandtheile zusammen, das Cholestearin, die Körnchenzellen und die Fettkörnchen, endlich grössere Klumpen von halberweichter Substanz, sind es, welche den breiigen Habitus des atheromatösen Heerdes bedingen, und welche zusammengenommen in der That eine gewisse Aehnlichkeit mit dem Inhalte eines Grützbeutels der äusseren Haut erzeugen.

Fig. 129. Der atheromatöse Brei aus einem Aortenheerde. a a' Flüssiges Fett, entstanden durch Fettmetamorphose der Zellen der Intima (a), welche sich in Körnchenkugeln (a' a') umbilden, dann zerfallen und kleine und grosse Oeltropfen frei werden lassen (fettiger Detritus). b Amorphe körnig-faltige Schollen erweichten und gequollenen Gewebes. c c' Cholestearinkrystalle: c die grossen rhombischen Tafeln, c' c' feine, rhombische Nadeln. Vergr. 300.
Was das Cholestearin anbetrifft, so ist es keineswegs ein specifisches Product, welches dieser Art von fettiger Umwandelung für sich zugehörte. Vielmehr sehen wir überall, wo fettige Producte innerhalb einer abgeschlossenen Höhle, welche dem Stoffwechsel wenig zugänglich ist, längere Zeit stagniren, dass das Fett Cholestearin abscheidet, z. B. in der Flüssigkeit alter Hydrocelen, Strumen, Eierstockscysten. Fast alle Fettmassen, die wir im Körper antreffen, enthalten eine gewisse Quantität von Cholestearin gebunden. Ob das freiwerdende Cholestearin vorher schon vorhanden war, oder ob an den Stellen eine wirkliche Neubildung desselben erfolgt, darüber kann man bis jetzt nichts sagen, da bekanntlich noch gar keine chemische Thatsache ermittelt ist, welche über den Hergang bei der Bildung des Cholestearins und über die Stoffe, aus welchen Cholestearin sich bilden mag, irgend einen Aufschluss gäbe. Soviel muss man festhalten, dass das Cholestearin ein spätes Abscheidungsproduct stagnirender, namentlich fetthaltiger Theile ist.
Wenn man nun die erste Entwickelung der atheromatösen Stellen der Arterien histologisch erforscht, so stösst man vor der Zeit, wo breiige Substanz in dem Heerde des Atheroms liegt, auf ein Stadium, wo man nichts weiter findet, als eine Fettmetamorphose, durch welche Körnchenzellen in der gewöhnlichen Weise aus den Elementen des Gewebes hervorgehen, und man überzeugt sich deutlich, dass der Vorgang in diesem Stadium absolut nicht verschieden ist von dem, welchen wir bei dem Herzen und bei der Niere in dem Stadium der fettigen Metamorphose vorfanden (S. 425, 427). In dieser Zeit, unmittelbar vor der Bildung des Heerdes, stellt sich das Verhältniss bei starker Vergrösserung so dar: Auf einem Durchschnitte (Fig. 130, a, a') sehen wir die eingestreuten fettig degenerirenden Elemente gegen die Mitte hin grösser werden und dichter liegen, aber im Allgemeinen noch die Form von Zellen bewahren; gegen den Umfang des Heerdes hin sind sie kleiner und spärlicher. Alle diese Zellen sind mit kleinen, das Licht stark reflectirenden, fettigen oder öligen Körnchen gefüllt. Dadurch entsteht für das blosse Auge auf einem Durchschnitte ein weisslicher oder weissgelblicher Fleck. Zwischen diesen Körnchenzellen befindet sich eine maschige Grundsubstanz, die eigentlich faserige Intercellularsubstanz der Intima, welche wir deutlich nach aussen in die normale Intima sich fortsetzen sehen.

Fig. 130. Verticaler Durchschnitt aus einer sklerotischen, sich fettig metamorphosirenden Platte der Aorta (Tunica intima, nahe der Oberfläche): i der innerste Theil der Haut mit einzelnen und zu mehreren gruppirten (getheilten), runden Kernen. h die Schicht der sich vergrössernden Zellen: man sieht Maschennetze mit spindelförmigen Zellen, welche durchschnittene knorpelartige Körperchen umschliessen. p Wucherungsschicht: Theilung der Kerne und Zellen. a a' die atheromatös werdende Schicht: a der Beginn des Prozesses, a' der vorgerückte Zustand der Fettmetamorphose. Vergr. 300.
Für die Deutung der Vorgänge ist es aber ganz besonders wichtig, dass man sich unmittelbar davon überzeugen kann, dass die Faserlage, welche über dem Heerde liegt, ebenso in die oberflächliche Faserlage der benachbarten normalen Intima übergeht, wie die Faserlage der degenerirten Stelle in die tieferen Faserlagen der normalen Intima. Auf diese Weise wird die, auch von Rokitansky längere Zeit vertheidigte Ansicht widerlegt, dass es sich ursprünglich um eine Auflagerung auf die Fläche der inneren Haut handele. Man sieht auf einem Durchschnitte ganz evident, wie die äussersten Schichten in einem Bogen über die ganze Schwellung hinweglaufen, aus der Intima hervorkommen und in sie zurückkehren. Die Alten hatten also ganz Recht, wenn sie in dem Stadium, wo die Bildung des Atherom-Heerdes schon vorgerückt ist, sagten, man könne die Intima über den Heerd herüber im Zusammenhange abziehen. Nur ist das nicht die ganze Intima, vielmehr überzeugt man sich, dass die unteren Schichten des Heerdes jenseits der Grenze desselben ebenfalls in die tieferen Schichten der normalen Intima fortgehen, dass also hier nicht, wie die Alten annahmen, eine Zwischenlagerung zwischen Intima und Media stattfindet, sondern das Ganze, was wir vor uns haben, degenerirte Intima ist.
In einzelnen besonders heftigen Fällen erscheint auch an den Arterien die nekrobiotische Erweichung nicht als Folge einer rein fettigen Metamorphose, sondern als directes Entzündungsproduct. Während im Umfange ein fettiger Zerfall stattfindet, tritt im Centrum der Veränderungsstelle ein gelbliches, trübes Wesen auf, unter welchem die Substanz fast unmittelbar in ein Gemisch grober Bröckel (Fig. 128, e, e. Fig. 129, b) erweicht und zerfällt.
Es fragt sich in letzter Instanz, wo eigentlich der Sitz der fettigen Degeneration ist. Man kann sich auch hier wieder denken, dass das Fett in Zwischenräume (Interstitien) zwischen den Lamellen der Intima abgelagert werde; und es gibt noch heute einen kleineren Theil von Histologen, welche nicht anerkennen, dass das Bindegewebe nur Zellen, aber keine einfachen Lücken enthält. Untersucht man die veränderten Stellen nach der Oberfläche hin, so sieht man, dass dasselbe Gefüge, welches an den fettigen Theilen hervortritt, sich auch an den bloss hornigen oder halbknorpeligen Lagen erkennen lässt. Faserzüge, zwischen welchen von Strecke zu Strecke kleine linsenförmige Lücken erscheinen, finden sich hier, wie auch an der normalen Intima; in den Lücken und in den Faserzügen liegen aber zellige Theile (Fig. 130, h, p). Die Vergrösserung, welche die Stelle erfahren hat, und welche wir Sklerose nennen, beruht darauf, dass, während die faserige Intercellularsubstanz dicker und dichter wird, die zelligen Elemente sich vergrössern und eine Vermehrung ihrer Kerne eintritt, so dass man nicht selten Räume findet, in denen ganze Haufen von Kernen liegen. Damit leitet sich der Prozess ein. Weiterhin kommen Theilungen der Zellen vor, und man trifft eine grosse Masse von jungen Elementen. Diese sind es, welche nachher der Sitz der fettigen Degeneration werden (Fig. 130, a, a') und dann wirklich zu Grunde gehen. Demnach haben wir auch hier wieder einen activen Prozess, der wirklich neues Gewebe hervorbringt, dann aber durch seine eigene Entwickelung dem Zerfalle entgegeneilt.
Kennt man diese Entwickelung, so begreift es sich, dass eine zweite Möglichkeit des Ausganges neben der fettigen Degeneration besteht, nehmlich die Ossification. Denn es handelt sich hier wirklich um eine Ossification, und nicht, wie man in neuerer Zeit behauptet hat, um eine blosse Verkalkung: die Platten, welche die innere Wand des Gefässes durchsetzen, sind wirkliche, wenn auch etwas rohe Knochenplatten. Da sie aus derselben sklerotischen Substanz sich bilden, aus der in anderen Fällen die fettige Masse wird, und da ein wirkliches Gewebe nur aus einem früheren Gewebe hervorgehen kann, so folgt von selbst, dass wir auch beim Ausgange in Fettmetamorphose nicht eine einfache Ausstreuung von Fett annehmen können, welche in beliebige Zwischenräume erfolgte.
Die Ossification geschieht hier gerade so, wie wenn sich unter Entzündungs-Erscheinungen an der Oberfläche des Knochens eine (periostitische) Knochenlage bildete. Die Osteophyten der inneren Schädeldecke und der Hirnhäute zeigen dieselbe Entwickelung, wie die ossificirenden Platten der inneren Haut der Aorta und selbst der Venen. Ihr erstes Stadium besteht immer in der vermehrten Bildung von bindegewebigen, sklerosirenden Verdickungen, in welche erst spät die Ablagerung der Kalksalze erfolgt. Sobald diese wirkliche Ossification besteht, so können wir gar nicht umhin, den Vorgang als einen aus einer Reizung der Theile zu neuen, formativen Actionen hervorgegangenen zu betrachten; er fällt also in den Begriff der Entzündung oder wenigstens derjenigen irritativen Prozesse, welche einer Entzündung ausserordentlich nahe stehen.
Gelangt man demnach von beiden Endpunkten des Prozesses aus, sowohl von der Atheromatie, als von der Ossification, zu demselben Resultate, dass die Knoten und Buckel, welche im Stadium der Sklerose die innere Fläche der Gefässe verunstalten, auf einen activen Prozess, auf wirkliche formative Reizung zurückführen, so kann man den Prozess gewiss nicht besser bezeichnen, als mit dem Namen der Endoarteriitis chronica deformans s. nodosa. Der an sich passive Charakter des fettigen Endstadiums (Ausganges) ändert nichts an dem activen, irritativen Anfangsstadium. Nur muss man sich stets erinnern, dass eine wesentliche Verschiedenheit zwischen diesem Prozesse und der einfachen fettigen Degeneration besteht, welche am besten an einem grossen Gefässe, z. B. der Aorta, zu erkennen ist. Bei der letzteren entsteht an der Oberfläche der Intima eine ganz leichte Anschwellung, welche sofort mit weggenommen wird, sobald man einen oberflächlichen Schnitt abträgt; darunter liegt noch eine starke Lage intacter Intima. Bei der Endoarteriitis dagegen haben wir im letzten Stadium einen tief unter der oft normalen Oberfläche liegenden Heerd, welcher später aufbricht, seinen Inhalt entleert und das atheromatöse Geschwür bildet. Dieses entsteht zuerst als ein feines Loch der Intima, durch welches der dicke, zähe Inhalt des Atheromheerdes in Form eines Pfropfes an die Oberfläche drängt; nach und nach entleert sich immer mehr von diesem Inhalte, wird vom Blutstrome fortgerissen, und zuletzt behalten wir ein mehr oder weniger grosses Geschwür zurück, welches bis auf die Media gehen kann, ja nicht selten diese mit betheiligt. Immer handelt es sich also um eine schwere Erkrankung des Gefässes, welche zu einer eben solchen Destruction führt, wie sie bei anderen heftigen entzündlichen Prozessen vorkommt.
Wendet man diese Erfahrung auf die Geschichte der Endocarditis240 an, so findet man die ganze Angelegenheit auch da. Auch an den Herzklappen gibt es einfach fettige Degenerationen, sowohl an der Oberfläche, als auch in der Tiefe. Diese verlaufen gewöhnlich so, dass bei Lebzeiten keine Störung erkennbar wird, und dass wir von unserem gegenwärtigen Erfahrungs-Standpunkte aus keine gröbere anatomische Störung angeben könnten, welche die weitere Folge davon wäre. Dagegen das, was wir Endocarditis nennen, was nachweisbar im Verlaufe des Rheumatismus entsteht und unzweifelhaft als eine Art von Aequivalent (Metastase) für den Rheumatismus der peripherischen Theile auftreten kann, beginnt mit einer Schwellung der erkrankten Stelle selbst. Die zelligen Elemente nehmen mehr Material auf, die Stelle wird uneben, höckerig. Verläuft der Prozess mehr langsam, so entsteht entweder eine Excrescenz (Condylom), oder die Verdickung breitet sich mehr hügelig aus und wird später der Sitz einer Verkalkung oder wirklichen Verknöcherung. Hat der Prozess einen acuteren Verlauf, so kommt es zu fettiger Degeneration oder Erweichung, wo die Klappen durch den Blutstrom zertrümmert werden, Bruchstücke sich ablösen und embolische Heerde an entfernteren Punkten entstehen (Fig. 82, S. 246).

Fig. 131. Condylomatöse Excrescenzen der Valvula mitralis: einfache körnige Anschwellungen (Granulationen), grössere Hervorragungen (Vegetationen), einzelne zottig, einzelne ästig und wieder knospend; in allen elastischen Fasern aufsteigend. Vergr. 70.
Nur auf diese Weise, indem man die Anfänge der Veränderungen beobachtet, ist es möglich, sichere und für die Praxis brauchbare Urtheile über die pathologischen Prozesse zu gewinnen. Niemals darf man sich bestimmen lassen, von der Differenz der klinischen Prozesse ausgehend, die endlichen Producte derselben als nothwendig verschieden zu betrachten. Die heftigsten Entzündungsprozesse, welche in ganz kurzer Zeit verlaufen, können dieselben Ausgänge machen, welche in anderen Fällen langsamer und ohne Entzündung entstehen.
Ich habe nicht die Absicht, die Reihe der verschiedenen passiven Störungen, welche möglicherweise im späteren Verlaufe von Reizungszuständen auftreten können, im Einzelnen zu verfolgen. Wir würden sonst in der Geschichte fast aller degenerativen Atrophien analoge Beispiele finden können. Ueberall muss man die Zustände, in denen ein Theil direkt der Sitz einer solchen Rückbildung wird, von denjenigen unterscheiden, wo er vorher eine active Veränderung erfuhr. Das ist die erste Vorbedingung zur vorurtheilsfreien, wirklich gegenständlichen Erkenntniss der Entzündung überhaupt, zu deren Besprechung wir uns gegenwärtig wenden wollen.
Der Begriff der Entzündung hat sich unter der Einwirkung der Erfahrungen, von welchen ich schon in dem Vorhergehenden einen gewissen Theil besprochen habe, wesentlich verändert. Während man noch bis vor kurzer Zeit gewohnt war, die Entzündung ontologisch, als einen seinem Wesen nach überall gleichartigen Vorgang zu betrachten, so ist nach meinen Untersuchungen nichts übrig geblieben, als alles Ontologische von dem Entzündungs-Begriffe abzustreifen, und die Entzündung nicht mehr als einen seinem Wesen nach von den übrigen verschiedenen Prozess, sondern nur als eine dem Verlaufe nach eigenthümliche Form verschiedener Prozesse anzusehen241.