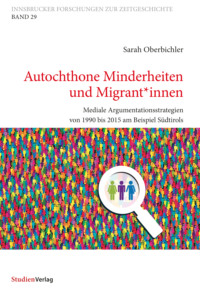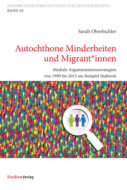Kitabı oku: «Autochthone Minderheiten und Migrant*innen», sayfa 8
138 Margarete Jäger / Regina Wamper (Hrsg.), Von der Willkommenskultur zur Notstandsstimmung. Der Fluchtdiskurs in deutschen Medien 2015 und 2016, Duisburg 2017, 181.
139 Yasemin Shooman, Keine Frage des Glaubens. Zur Rassifizierung von „Kultur“ und „Religion“ im antimuslimischen Rassismus, in: Sebastian Friedrich (Hrsg.), Rassismus in der Leistungsgesellschaft. Analysen und kritische Perspektiven zu den rassistischen Normalisierungsprozessen der „Sarrazindebatte“, Münster 2011, 59–76. Ebenda, 26.
140 Marieluise Mühe, Rassistische Diskurse im Einwanderungsland Deutschland. Das Aushandeln von Flucht und Asyl über soziale Medien im lokalen Raum, Working Paper Nr. 15 / Center for North African and Middle Eastern Politics, Freie Universität Berlin, Berlin 2017.
141 Sebastian Friedrich, Rassismus in der Leistungsgesellschaft. Einleitung, in: Friedrich (Hrsg.), Rassismus in der Leistungsgesellschaft, 8–38.
142 Ebenda, 26.
143 Hart, Critical Discourse Analysis.
144 Aidan McGarry / Helen Drake, The Politicization of Roma as an Ethnic „Other”: Security Discourse in France and the Politics of Belonging, in: Umut Korkut / Gregg Bucken-Knapp / Aidan McGarry / Jonas Hinnfors / Helen Drake (Hrsg.), The Discourse and Politics of Migration in Europe (=Europe in Transition: The NYU European Studies Series), New York 2013, 73–93.
145 Mikko Kuisma, „Good“ and „Bad“ Immigrants: The Economic Nationalism of the True Finns’ Immigration Discourse, in: Korkut / Bucken-Knapp / McGarry / Hinnfors / Drake (Hrsg.), The Discourse and Politics of Migration in Europe, 93–109.
146 Elaine Burroughs, Discursive representations of ‘illegal immigration’ in the Irish newsprint media: The domination and multiple facets of the ‘control’ argumentation, in: Discourse & Society (2015), Nr. 26(2), 165–183.
147 Joachim Landwehr, Historische Diskursanalyse, Frankfurt am Main 2008, 15.
148 Reiner Keller, Diskursforschung. Eine Einführung für SozialwissenschaftlerInnen (=Qualitative Sozialforschung), Wiesbaden 42011, 27.
149 Kathrin Braun, Im Kampf um Bedeutung: Diskurstheorie und Diskursanalyse in der interpretativen Policy Analyse, in: Zeitschrift für Diskursforschung/Journal for Discourse Studies (2014), Nr. 1(4), 77–101, 92 ff.
150 Keller, Diskursforschung, 27.
151 Van Leeuwen / Wodak, Legitimizing immigration control, 85.
152 Ruth Wodak / Katharina Köhler, Wer oder ist „fremd“? Diskurshistorische Analyse fremdenfeindlicher Rhetorik in Österreich, in: SWS-Rundschau (2010), Nr. 50(1), 33–55, 35.
153 Van Leeuwen / Wodak, Legitimizing immigration control, 91.
154 Christopher Hart, Argumentation meets adapted cognition: Manipulation in media discourse on immigration, in: Journal of Pragmatics (2013), Nr. 59, 200–209, 201.
155 Martin Reisigl / Ruth Wodak, Discourse and Discrimination: Rhetorics of Rasism and Antisemitism, London-New York 2011, 74 ff.
156 Martin Reisigl, Rechtspopulistische und faschistische Rhetorik: ein Vergleich, in: Totalitarismus und Demokratie, (2012), Nr. 9(2), 303–323.
157 Manfred Kienpointner, Topoi, in: Sven Roth / Martin Wengeler / Alexander Ziem (Hrsg.), Handbuch Sprache in Politik und Gesellschaft (=Handbücher Sprachwissen, 19), Berlin-Boston 2017, 187–212, 210.
158 Claudia Bluhm / Dirk Deissler / Joachim Scharloth / Anja Stukenbrock, Linguistische Diskursanalyse: Überblick, Probleme, Perspektiven, in: Sprache und Literatur in Wissenschaft und Unterricht 88 (2000), 3–19, 10.
159 Martin Wengeler, Historische Diskurssemantik als Analyse von Argumentationstopoi, in: Dietrich Busse / Wolfgang Teubert (Hrsg.), Linguistische Diskursanalyse. Neue Perspektiven, Wiesbaden 2013, 189–215, 189.
160 Ebenda.
161 Bluhm / Deissler / Scharloth / Stukenbrock, Linguistische Diskursanalyse, 10.
162 Martin Reisigl, Die Stellung der historischen Diskurssemantik in der linguistischen Diskursforschung, in: Busse / Teubert (Hrsg.), Linguistische Diskursanalyse, 243–273, 258.
163 Kienpointner, Topoi, 203.
164 Bluhm / Deissler / Scharloth / Stukenbrock, Linguistische Diskursanalyse, 10.
165 Kienpointner, Topoi, 203.
166 Noah Bubenhofer / Joachim Scharloth‚ Maschinelle Textanalyse im Zeichen von Big Data und Data-driven Turn – Überblick und Desiderate, in: Zeitschrift für germanistische Linguistik (ZGL) (2015), Nr. 43(1), 1–26, 1.
167 Matthias Lemke / Andreas Niekler / Gary S. Schaal / Gregor Wiedemann, Content Analysis between Quality and Quantity. Fulfilling Blended-Reading Requirements for the Social Sciences with a Scalable Text Mining Infrastructure, in: Datenbank Spektrum (2015), Nr. 15, 7–14; Gerhard Heyer / Uwe Quasthoff / Thomas Wittig, Text Mining: Wissensrohstoff Text. Konzepte, Algorithmen, Ergebnisse, Bochum 2006.
168 Gregor Wiedemann, Opening up to Big Data: Computer-Assisted Analysis of Textual Data in Social Sciences, in: Forum: Qualitative Sozialforschung (2013), Nr. 14(2), 23.
169 Zum Beispiel: Veronica Koller / Gerlinde Mautner, Computer Applications in Critical Discourse Analysis, in: Carolin Coffin / Ann Hewings / Kieran O’Halloran (Hrsg.), Applying English Grammar: Corpus and Functional Approaches, London 2004, 216–228, 218.
170 Costas Gabrielatos / Paul Baker, Fleeing, Sneaking, Flooding: A Corpus Analysis of Discursive Constructions of Refugees and Asylum Seekers in the UK Press 1996-2005, in: Journal of English Linguistics (2008), Nr. 36, 5–38, 7.
171 Ebenda.
172 Alyona Boeva, Discursive construction of refugees, migrants and asylum seekers in British and American news sources, in: Procedia – Social and Behavioral Sciences (2016), Nr. 236, 53–58.
173 Miriam Butt / Gerhard Heyer / Katharina Holzinger / Cathleen Kantner / Daniel A. Keim / Jonas Kuhn / Gary Schaal / André Blessing / Sebastian Dumm / Mennatallah El-Assady / Valentin Gold / Matthias Lemke / Maike Müller / Andreas Niekler / Maximilian Overbeck / Gregor Wiedemann, Argumentanalyse in digitalen Textkorpora, [http://www.dhd2016.de/abstracts/sektionen-001.html], eingesehen am 12.01.2018.
174 Franko Moretti, Conjectures on world literature, in: New Left Review (2000), Nr. 1, 54–68.
175 Matthew Jockers, Macroanalysis: Digital Methods and Literary History, Urbana 2013.
176 Ebenda, 9.
177 Jesper Verhoff, The cultural-historical value of and problems with digitized advertisements. Historical newspapers and the portable radio, 1950-1969, in: Tijdschrift voor tijdschriftstudies 38 (2015), 51–60, 55.
178 Claudia Fraas / Christian Pentzold, Big Data vs. Slow Understanding? Voraussetzungen und Vorgehen computerunterstützter Analyse transmedialer multimodaler Diskurse, in: Zeitschrift für germanistische Linguistik (ZGL) (2015). Nr. 43(1), 122–133, 130.
179 Alexander Stulpe / Matthias Lemke, Blended Reading. Theoretische und praktische Dimensionen der Analyse von Text und sozialer Wirklichkeit im Zeitalter der Digitalisierung, in: Matthias Lemke / Gregor Wiedemann (Hrsg.), Text Mining in den Sozialwissenschaften. Grundlagen und Anwendungen zwischen qualitativer und quantitativer Diskursanalyse, Wiesbaden 2016, 16–62, 18 ff.
180 Jeffrey Drouin, Close- and Distant-Reading Modernism: Network Analysis, Text Mining, and Teaching the Little Review, in: The Journal of Modern Periodical Studies (2014), Nr. 5(1), 110–135, 111 f.
181 Gabrielatos / Baker, Fleeing, Sneaking, Flooding, 34.
182 Noah Bubenhofer, Quantitativ informierte qualitative Diskursanalyse. Korpuslinguistische Zugänge zu Einzeltexten und Serien, in: Kersten Sven Roth / Carmen Spiegel (Hrsg.), Angewandte Diskurslinguistik. Felder, Probleme, Perspektiven, Berlin 2013, 109–134, 112 f.
183 Fraas / Pentzold, Big Data vs. Slow Understanding, 130.
184 Danah Boyd / Kate Crawford, Critical Questions for Big Data, in: Information, Communication & Society (2012), Nr. 15(5), 662–679, 670 f.
185 Drouin, Close- And Distant-Reading Modernism, 110-135.
186 Paul Baker, Using Corpora in Discourse Analysis, New York 2006.
187 Tim Hitchcock, Big Data, Small Data and Meaning, abgedruckt in: [http://historyonics.blogspot.nl/2014/11/big-data-small-data-and-meaning*9.html], eingesehen am 04.11.2017.
188 Fraas / Pentzold, Big Data vs. Slow Understanding, 122–133.
189 Matthias Lemke / Alexander Stulpe, Text und soziale Wirklichkeit. Theoretische Grundlagen und empirische Anwendung von Text-Mining-Verfahren in sozialwissenschaftlicher Perspektive, in: Zeitschrift für germanistische Linguistik (ZGL) (2015), Nr. 43(1) 52–83.
190 Das Buch von Matthias Lemke und Gregor Wiedemann (2016): Text Mining in den Sozialwissenschaften. Grundlagen und Anwendungen zwischen qualitativer und quantitativer Diskursanalyse fasst eine Reihe von Autoren zusammen, die zu genannten Forschungserkenntnissen gekommen sind.
191 Yanni Alexander Loukissas, A place for Big Data: Close and distant readings of accessions data from the Arnold Arboretum, in: Big Data & Society (2016), 1–20.
192 Athesia Medien, Markt und Mediendaten, in: [http://www.athesiamedien.it/Werben-Startseite/Dolomiten/Dolomiten/(wd)/Markt-%20&%20Mediendaten], eingesehen am 09.05.2018.
193 Hermann Atz, Der (ethnische) Medienkonsum der Südtiroler Bevölkerung. Voraussetzungen, Rahmenbedingungen und Einflussfaktoren auf die Nutzung von Medien in der Mutter- und der Zweitsprache, in: Pallaver (Hrsg.), Die ethnisch halbierte Wirklichkeit, 67–88, 68 ff.
194 Ebenda, 42.
195 Judith Klein, Südtirols Medienlandschaft, in: Medienimpulse 1 (2015), 1–9, 6, [http://www.medienimpulse.at/pdf/Medienimpulse*Suedtirols*Medienlandschaft*Klein*20150319.pdf], eingesehen am 05.08.2017.
196 Leo Hillebrand, Getrennte Wege. Die Entwicklung des ethnischen Mediensystems in Südtirol, in: Pallaver (Hrsg.), Die ethnisch halbierte Wirklichkeit, 41–66, 43.
197 Klein, Südtirols Medienlandschaft [http://www.medienimpulse.at/pdf/Medienimpulse*Suedtirols*Medienlandschaft*Klein*20150319.pdf], eingesehen am 05.08.2017.
198 Hillebrand, Getrennte Wege, 41–66, 61.
199 Atz, Der (ethnische) Medienkonsum der Südtiroler, 75.
200 Günther Pallaver, Die ethnische Berichterstattung der Südtiroler Medien. Print- und elektronische Medien im Vergleich. Ergebnisse quantitativer Untersuchungen, in: Pallaver (Hrsg.), Die ethnisch halbierte Wirklichkeit, 88–115, 88.
201 Günther Pallaver, Demokratie und Medien in ethnischen fragmentierten Gesellschaften. Theoretische Überlegungen zur Überwindung kommunikativer Schranken, in: Pallaver (Hrsg.), Die ethnisch halbierte Wirklichkeit, 9–36, 12 ff.
202 Friedrich Blahusch, Zuwanderungspolitik im Spannungsfeld ordnungspolitischer und ethnisch-nationalistischer Legitimationsmuster, Frankfurt am Main 1999, 11.
203 Günther Pallaver, Voraussetzungen für eine sprachgruppenübergreifende „Wir-Identität“. Zehn Thesen für eine gemeinsame Kommunikation in Südtirol, in: Pallaver (Hrsg.), Die ethnisch halbierte Wirklichkeit, 134–138, 138.
204 Atz, Der (ethnische) Medienkonsum der Südtiroler, 75.
205 Florian Platter, „Der Rundfunk gehört den Bürgern!“. Konzept zur Gründung eines nicht-kommerziellen, partizipativen, multilingualen und interkulturellen Offenen Fernsehkanals in der Autonomen Provinz Bozen – Südtirol, Diplomarbeit, Wien 2009, 143 und 175.
206 ASTAT Nr. 29/2015, Ausländische Wohnbevölkerung 2014, Bozen 2015, 4–9.
207 Antje Plaikner, Lesernähe und regionale Tageszeitungen, in: Valentin Dander / Veronika Gründhammer / Heike Ortner / Daniel Pfurtscheller / Michaela Rizzolli (Hrsg.), Medienräume. Materialität und Regionalität, Innsbruck 2013, 147–163, 157.
208 ASTAT Nr. 29/2015, Ausländische Wohnbevölkerung 2014, Bozen 2015, 4–9.
209 http://www.altoadige.kataweb.it/altoadige/
210 Konstantin Baierer / Philipp Zumstein, Verbesserung der OCR in digitalen Sammlungen von Bibliotheken, in: Journal for Library Culture / Zeitschrift für Bibliothekskultur (2016), Nr. 4(2), 72–83, 73.
211 Günter Mühlberger, Digitalisierung historischer Zeitungen aus dem Blickwinkel der automatisierten Text- und Strukturerkennung (OCR), in: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie (ZfBB) (2011), Nr. 58(1), 10–18, 17.
212 Pallaver, Die ethnische Berichterstattung, 88–99.
213 Eva Pfanzelter, Menschenhass 2016? „Soziale“ Medien und Migration, in: Pfanzelter / Rupnow (Hrsg.), einheimisch – zweiheimisch – mehrheimisch, 183–203.
214 ASTAT Nr. 20/2007, Die Lesegewohnheiten der Südtiroler – 2006, Bozen 2007. 5 ff.
215 Carolin Hermann, Im Dienste der örtlichen Lebenswelt. Lokale Presse im ländlichen Raum, Opladen 1993, 15 ff.
216 Pallaver, Demokratie und Medien, 12 ff.
217 Hermann, Im Dienste der örtlichen Lebenswelt, 25 ff.
218 Constanze Spiess, Diskurshandlungen: Theorie und Methode linguistischer Diskursanalyse am Beispiel der Bioethikdebatte (=Sprache und Wissen 7), Berlin-Boston 2011, 274.
219 Sonja Baláž, Die Integration der Russischsprachigen in die estnische Gesellschaft: Diskursanalyse der estnischsprachigen Tageszeitung Postimees (1995-1999), Dissertation, Greifswald 2011, 38; Nicolas Ruth, Was ist ACTA? Eine Diskurs- und Medienanalyse zum Ursprung des Urheberstreits (=Populäre Kultur und Medien 6), Berlin 2013, 57.
220 Jim Riordan / Sue Bridger (Hrsg.) Dear Comrade Editor. Reader’s Letters to the Soviet Press under Perestroika, Bloomington-Indianapolis 1992, 2.
221 Spiess, Diskurshandlungen, 274.
222 Wengeler, Historische Diskurssemantik.
223 Ebenda, 190.
224 Ebenda, 189–193.
225 Martin Wengeler, Zur historischen Kontinuität von Argumentationsmustern im Migrationsdiskurs, in: Butterwegge / Hentges (Hrsg.), Massenmedien, Migration und Integration, 11–34, 13.
226 Wengeler, Historische Diskurssemantik, 191.
227 Josef Kopperschmidt, Methodik der Argumentationsanalyse, Stuttgart-Bad Cannstatt 1998.
228 Manfred Kienpointner, Alltagslogik: Struktur und Funktion von Argumentationsmustern, Stuttgart-Bad Cannstatt 1992.
229 Wengeler, Historische Diskurssemantik, 189–193.
230 „Ein Topos ist ein Standard des von einer Gesellschaft jeweils internalisierten Bewusstseins-, Sprachund/oder Verhaltenshabitus, ein Strukturelement des sprachlich-sozialen Kommunikationsfuges, eine Determinante des in einer Gesellschaft jeweils herrschenden Selbstverständnisses und des seine Tradition und Konventionen regenerierenden Bildungssystems“. Abgedruckt in: Lothar Bornscheuer, Topik. Zur Struktur der gesellschaftlichen Einbildungskraft, Frankfurt am Main 1976, 96.
231 Martin Wengeler, Argumentation im Einwanderungsdiskurs. Ein Vergleich der Zeiträume 1970-1973, in: Jung / Wengeler / Böke (Hrsg.), Die Sprache des Migrationsdiskurses, 124.
232 Kienpointner, Alltagslogik.
233 Wengeler, Historische Diskurssemantik, 193.
234 Ebenda, 194 f.
235 Wengeler, Argumentation im Einwanderungsdiskurs, 125.
236 Wengeler, Historische Diskurssemantik, 200–202; Martin Wengeler, „Ausländer dürfen nicht Sündenböcke sein“-Diskurslinguistische Methodik, präsentiert am Beispiel zweier Zeitungstexte, in: Ingo H. Warnke / Jürgen Spitzmüller, Methoden der Diskurslinguistik. Sprachwissenschaftliche Zugänge zu transtextuellen Ebenen, Berlin-New York 2008, 207–236, 216.
237 Zum Thema „kulturelles Gedächtnis“ vgl. Jan Assmann, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen, München 52005.
238 Karin Böke / Matthias Jung / Thomas Niehr / Martin Wengeler, Vergleichende Diskurslinguistik. Überlegungen zur Analyse internationaler und intralingualer Textkorpora, in: Martin Wengeler (Hrsg.), Sprachgeschichte als Zeitgeschichte, Hildesheim-Zürich-New York, 2005, 245–283, 264–270.
239 Matouschek, Soziodiskursive Analyse, 114 f.
240 Ebenda.
241 Yvonne Ehrenspeck / Alexander Geimer / Steffen Lepa, Inhaltsanalyse, in: Uwe Sander / Friederike von Gross / Kai-Uwe Hugger, Handbuch Medienpädagogik, Wiesbaden 2008, 351–256, 351.
242 Stulpe / Lemke, Blended Reading, 43 ff.
243 Agnes Mühlmeyer Mentzel, Das Datenkonzept von ATLAS.ti und sein Gewinn für „Grounded-Theorie“ Forschungsarbeiten, in: [http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/article/view/1621/3126], eingesehen am 08.02.2015.
244 Stulpe / Lemke, Blended Reading, 44.
245 Gregor Wiedemann / Matthias Lemke / Andreas Niekler, Postdemokratie und Neoliberalismus – Zur Nutzung neoliberaler Argumentation in der Bundesrepublik Deutschland 1949–2011. Ein Werkstattbericht, in: Zeitschrift für Politische Theorie (2013), Nr. 4(1), 80–96, 90.
246 Girardi, Geschichtlicher Abriss, 78.
247 Bubenhofer, Quantitativ informierte qualitative Diskursanalyse, 112 ff.
248 Tze-I Yang / Andrew J. Torget / Rada Mihalcea, Topic Modeling on Historical Newspaper, in: Proceedings of the 5th ACL-HLT Workshop on Language Technology for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities, Portland, OR, USA, 96–104, 97.
249 Noah Bubenhofer, Korpuslinguistische Analyse von Argumentationsmustern, in: [https://www.bubenhofer.com/korpuslinguistik/kurs/index.php?id=anwendungen*argumentation.html], eingesehen am 23.10.2017.
250 Vgl. Wengeler, Topos und Diskurs. (Ein Teil der Muster sind von Wengeler entlehnt, andere haben sich aus der Analyse der Südtiroler Tageszeitungen ergeben).
Teil 2
1. Migration in Südtirol – Historische Hintergründe und vergleichende Medienanalyse
Das Kapitel Historische Hintergründe und vergleichende Medienanalyse bespricht die Auswertung fünf zentraler Südtiroler Migrationsdiskurse (Flüchtlingsdiskurs, Moscheebaudiskurs, Barackenlagerdiskurs, Wohnbaudiskurs und Integrationsdiskurs). Flucht als eine Form der unfreiwilligen Migration wird hierbei ebenfalls unter dem Begriff Migration zusammengefasst und Migration als Überbegriff für jegliche Form der Wanderung verwendet.251 Selbstverständlich gilt es zu unterscheiden zwischen (Arbeits-)migrant*innen und Flüchtlingen, wenn auch die Tageszeitungen gerade diese Unterscheidung manchmal gar nicht zulassen. Flucht ist nicht erst seit heute – auch nicht erst seit den 1990er-Jahren – ein Thema für Südtirol. Wie im nachfolgenden Kapitel aufgezeigt wird, haben Flüchtlingsbewegungen in Südtirol eine lange Geschichte. Deshalb – und auch wegen der aktuellen Brisanz des Themas – wurde der Flüchtlingsdiskurs als eigenständiger Diskurs in die Arbeit aufgenommen.
Zur Kontextualisierung der Diskurse wurden Wortprotokolle, Gesetzesentwürfe, Beschlussanträge und Anfragen des Südtiroler Landtags, die online abgerufen werden können,252 sowie ASTAT-Statistiken und Archivmaterial der Caritas ausgewertet. Dieser Kontextualisierung folgt die vergleichende Medienanalyse. Dafür wurden insgesamt 3.468 Artikel der Dolomiten und 2.616 Artikel der Alto Adige nach Argumentationen untersucht und beide Tageszeitungen gegenübergestellt.
Einzelne Ausschnitte aus diesem Kapitel wurden in Beiträgen von Sammelbänden oder Zeitschriften publiziert.253
1.1 Flucht und Vertreibung nach Südtirol von 1990 bis heute
Der politische und historische Rahmen
Über 60 Millionen Menschen sind seit 2014 aufgrund von Kriegen, Terror und Menschenrechtsverletzungen aus ihrem Heimatland geflohen, die höchste Zahl, die das UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) jemals verzeichnete und die höchste Zahl seit dem Zweiten Weltkrieg.254 Lediglich ein Bruchteil aller Geflohenen nahm und nimmt den gefährlichen Weg nach Europa auf sich und die meisten Menschen suchen Schutz in Nachbarländern wie dem Libanon oder der Türkei.255 Trotzdem entwickelte sich die Flüchtlingsfrage in Europa zu einer der größten Herausforderungen der Zeit, Folgen, wie der Rückzug auf den Nationalstaat, Wiedereinführung von Grenzkontrollen oder sogar der Austritt aus der Europäischen Union wie im Fall Großbritanniens, stellen die Europäische Union vor eine Zerreißprobe.
Auch Südtirol wurde und wird als Grenzregion und wichtiges Durchzugsland in den Norden mit den Herausforderungen der Fluchtbewegungen konfrontiert. Vergessen wird jedoch allzu leicht, dass Vertreibung und Flucht kein neues Phänomen für Europa und auch nicht für Südtirol darstellen. Bereits nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Südtirol zum Transitland für Tausende Geflüchtete: italienische Zivilisten, illegal zurückkehrende Optant*innen, Jüd*innen sowie vor der alliierten Justiz fliehende Nationalsozialisten*innen.256 In den 1990er-Jahren kam es erneut zu Massenfluchtbewegungen, diesmal aus Albanien und Jugoslawien. Seit 2011 sind es Flüchtende aus Afrika, Asien und dem Nahen Osten, die in Europa Schutze vor Verfolgung, Terror und Krieg suchen.