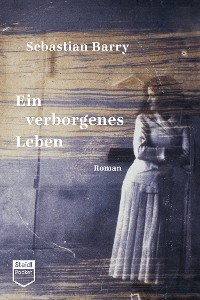Kitabı oku: «Ein verborgenes Leben (Steidl Pocket)», sayfa 2
ZWEITES KAPITEL
Dr. Grenes Aufzeichnungen
(Leitender Psychiater, Roscommon Regional Mental Hospital)
Dieses Gebäude ist in einem schrecklichen Zustand, wie schrecklich, konnten wir so richtig erst dem Bericht der Bauaufsicht entnehmen. Die drei mutigen Männer, die unter das uralte Dach kletterten, berichten, dass viele Dachbalken kurz vor dem Einsturz stehen, als spiegelten Haupt und Glieder der Institution die Verfassung vieler der armen Insassen darunter wider. Statt Insassen sollte ich schreiben: Patienten. Da das Gebäude jedoch Ende des achtzehnten Jahrhunderts als mildtätige Einrichtung, als »Heilstätte für die überlegene Behandlung kranker Sitze der Gedanken« errichtet wurde, kommt einem stets das Wort »Insassen« in den Sinn. Wie heilsam und wie überlegen, darüber lässt sich heute nur spekulieren. Mitte des neunzehnten Jahrhunderts herrschte dank der revolutionären Ideen verschiedener Ärzte in den Irrenanstalten tatsächlich eine Periode wirklicher Aufklärung: Zwangsjacken kamen nur selten zum Einsatz, gute Ernährung wurde für ratsam erachtet, ebenso viel Bewegung und geistige Anregung. Was ein großer Fortschritt gegenüber den Praktiken von Bedlam war, wo brüllende Bestien am Boden festgekettet waren. Danach wendeten sich die Dinge wieder zum Schlechteren, und kein feinfühliger Mensch würde freiwillig Historiker der irischen Irrenanstalten zu Anfang des vergangenen Jahrhunderts sein wollen, mit ihren Klitoridektomien, Tauchbädern und Einläufen. Das vergangene Jahrhundert ist »mein« Jahrhundert, da ich zur Jahrhundertwende siebenundfünfzig war und es schwerfällt, in diesem Alter einem neuen Jahrhundert noch sein Herz und seine Aufmerksamkeit zu schenken. Fand ich jedenfalls. Und finde es noch immer. Leider bin ich nun schon fast fünfundsechzig.
Da das Gebäude sein Alter so zwingend unter Beweis stellt, werden wir es räumen müssen. Im Ministerium heißt es, mit dem Neubau werde so gut wie unverzüglich begonnen. Das mag zutreffen oder eine leere Phrase sein. Aber wie sollen wir in unserer Arbeit fortfahren, bis uns der Neubau wirklich zur Verfügung steht, philosophisch gefragt: Wie können wir eine Vielzahl von Patienten, deren DNA sich höchstwahrscheinlich längst mit dem Mörtel des Gebäudes vermischt hat, hier herauslösen? Im Haupttrakt sind fünfzig steinalte Frauen untergebracht, so alt, dass ihr Alter etwas Ewiges, etwas Fortdauerndes hat, und so bettlägerig und wund gelegen, dass es etwas Gewalttätiges hätte, sie an einen anderen Ort zu schaffen.
Vermutlich sträube ich mich innerlich gegen die Vorstellung auszuziehen, so wie jeder vernünftige Mensch es tut, wenn ein Umzug erwogen wird. Zweifellos werden wir ihn mit dem üblichen Chaos und Trauma bewerkstelligen.
Auch die Wärter und Pfleger sind längst Bestandteil des Gebäudes, wie die Fledermäuse unter dem Dach und die Ratten in den Kellern. Und von beiden gibt es, wie ich höre, eine Unzahl, auch wenn ich die Ratten Gott sei Dank nur ein einziges Mal gesehen habe, nämlich als der Ostflügel in Brand geriet und ich die schwarzen Schatten zu den unteren Türen hinaus und durch die Hecken in die Getreidefelder des Bauern flitzen sah. Als sie flohen, warf der Feuerschein eine seltsame Orangenmarmeladenfarbe auf ihren Rücken. Ich bin überzeugt, dass sie gleich, als die Feuerwehrleute Entwarnung gaben, wieder in das neue Dunkel huschten.
Also, irgendwann müssen wir hier raus. Daher muss ich der neuen Gesetzgebung entsprechend beurteilen, wer von den Patienten wieder in die Gemeinschaft (was immer das ist, o Herr!) entlassen werden kann und welcher Kategorie jeder der anderen Patienten zuzurechnen ist. Viele von ihnen werden über die neue Einrichtung, den modernen Verputz, die gute Isolierung und Heizung entsetzt sein. Noch das Stöhnen des Windes in den Gängen, selbst an stillen Tagen – wie geht das eigentlich? vielleicht ein Vakuum, hervorgerufen von Kälte und Wärme in verschie denen Teilen des Krankenhauses? –, werden sie vermissen, die leise Hintergrundmusik ihrer Träume und ihrer »Verrücktheiten«. Da bin ich mir sicher. Die armen alten Kerle in den vor langer Zeit von den Krankenhausschneidern angefertigten schwarzen Anzügen, die nicht so sehr verrückt als vielmehr obdachlos und steinalt sind und wie Soldaten irgendeines vergessenen Unabhängigkeits- oder Indianerkrieges in den Räumen des älteren Westflügels hausen, werden sich außerhalb dieses verlorenen Grund und Bodens von Roscommon nicht wiedererkennen.
Diese Notwendigkeit wird mich vor eine Aufgabe stellen, der ich lange aus dem Weg gegangen bin, nämlich herauszufinden, welche Umstände einige der Patienten hierhergeführt haben und ob sie tatsächlich, wie es in einigen tragischen Fällen zutraf, eher aus sozialen als aus medizinischen Gründen eingewiesen wurden. Denn ein so großer Narr bin ich nicht, zu glauben, dass alle »Irren« hier drin wirklich verrückt sind oder es waren, bevor sie hierherkamen und von einer Art viraler Verrücktheit erfasst wurden. In der allwissenden breiten Öffentlichkeit, oder sagen wir: in der öffentlichen Meinung, wie sie sich in den Zeitungen niederschlägt, gelten diese Menschen als »freiheitswürdig« oder »entlassungswürdig«. Was durchaus zutreffen mag, doch Kreaturen, die so lange im Zwinger gehalten und eingesperrt wurden, empfinden Freiheit und Entlassung als äußerst fragwürdige Errungenschaften, so wie die osteuropäischen Länder nach dem Kommunismus. Und auf gleiche Weise spüre ich in mir einen sonderbaren Widerwillen dagegen, irgendjemanden gehen zu sehen. Woher kommt das? Ist es die Besorgnis des Zoowärters? Werden sich meine Polarbären auch am Pol zurechtfinden? Vermutlich greift dieser Gedanke zu kurz. Nun ja, wir werden sehen.
Insbesondere meine alte Freundin Mrs McNulty werde ich ansprechen müssen, die nicht nur die älteste Person an diesem Ort, sondern in Roscommon, vielleicht sogar in Irland ist. Betagt war sie schon vor dreißig Jahren, als sie hierherkam, obwohl sie damals die elementare Kraft einer – ich weiß nicht, einer Naturgewalt besaß. Sie ist ein bemerkenswerter Mensch, und obwohl lange Zeiträume verstrichen sind, in denen ich sie nicht oder nur flüchtig zu Gesicht bekommen habe, bin ich mir ihrer stets bewusst und vergesse nicht, mich nach ihr zu erkundigen. Ich fürchte, sie ist eine Art Prüfstein für mich. Sie gehört zum lebenden Inventar und repräsentiert nicht nur die Anstalt, sondern auf eigentümliche Art auch meine eigene Geschichte, mein eigenes Leben, »ist Leitstern, der verirrte Schiffe lenkt«, wie Shakespeare es nennt. Meine Eheprobleme mit der armen Bet, meine gedrückte Stimmung, mein mitunter sinkender Mut, mein Gefühl, nicht voranzukommen, mein dies, mein das – meine Dummheit im Umgang mit Menschen vermutlich. Während die Verhältnisse sich unausweichlich verändert haben, ist sie sich gleich geblieben, auch wenn sie natürlich im Lauf der Jahre schwächer und schmächtiger geworden ist. Ist sie inzwischen hundert? Unten im Aufenthaltsraum hat sie immer Klavier gespielt, ziemlich gekonnt, Lieder und Jazzmelodien der Zwanziger- und Dreißigerjahre. Ich weiß nicht, wo sie die aufgeschnappt hat. Sie hat immer in einem dieser schrecklichen Krankenhauskittel dagesessen, aber ausgesehen hat sie wie eine Königin, mit ihrem langen silbernen Haar, das ihr offen auf den Rücken fiel, und ihrem eindrucksvollen Gesicht, obwohl sie damals bereits siebzig war. Eigentlich war sie noch immer sehr schön, und weiß Gott, wie sie ausgesehen haben muss, als sie noch jung war. Aus dem Rahmen fallend, die Verkörperung von etwas Außergewöhnlichem, vielleicht sogar Fremdartigem in dieser provinziellen Welt. Als in späteren Jahren ein milder Rheumatismus einsetzte – sie duldete das Wort nicht, nannte es ein »Zaudern« ihrer Finger –, hörte sie mit dem Klavierspielen auf. Vielleicht hätte sie fast ebenso gut weiterspielen können, aber »fast ebenso gut« stellte sie nicht zufrieden. So ging uns der Klang von Mrs McNultys Jazzspiel verloren.
Nachzutragen ist, dass das Klavier, von Holzwürmern befallen, später mit lautem, unmusikalischem Geklirr in einem Container landete.
Jetzt muss ich also zu ihr und sie nach diesem und jenem befragen. Ich bin unerklärlich nervös deswegen. Warum sollte ich nervös sein? Ich glaube, weil sie so viel älter ist als ich und, obwohl sie zu tiefem Schweigen neigt, eine äußerst angenehme Gesellschaft, so wie eine ältere Kollegin, die man verehrt. Ich glaube, das ist es. Vielleicht auch, weil ich den Verdacht habe, dass sie mich ebenso gern mag wie ich sie. Dabei wüsste ich nicht einmal, weshalb sie mich mag. Ich habe mir eine Neugier auf sie bewahrt, bin aber nie in ihr Leben eingetaucht, was man mir als professionellem Psychiater wohl anlasten könnte. Dennoch, so ist es nun einmal, sie mag mich. Doch um nichts in der Welt würde ich diese Zuneigung, deren Grundlage, meine ich, erschüttern wollen. Ich muss also vorsichtig zu Werke gehen.
Roseannes Selbstzeugnis
Wie gern würde ich sagen, ich hätte meinen Vater so sehr geliebt, dass ich ohne ihn nicht hätte leben können, aber ein solches Eingeständnis würde sich mit der Zeit als falsch erweisen. Diejenigen, die wir lieben, diese unentbehrlichen Wesen, werden uns entrissen nach dem Willen des Allmächtigen oder der Teufel, die sich seines Thrones bemächtigt haben. Es ist, als würde uns bei ihrem Tod ein riesiger Bleiklumpen auf die Seele gelegt, und wenn diese Seele vorher schwerelos war, so ist sie jetzt eine verborgene und verderbliche Last in unserem Innersten.
Als ich etwa zehn war, nahm mich mein Vater in einem Anfall von Erziehungswut mit in die Spitze des hohen, schlanken Turmes auf dem Friedhof. Es war einer jener schönen, stolzen, grazilen Bauten, die die Mönche in Zeiten der Gefahr und der Verheerung errichtet hatten. Er stand in einer mit Brennnesseln bewachsenen Ecke des Friedhofs und wurde nicht weiter beachtet. Wer in Sligo aufgewachsen war, für den war er einfach da. Aber zweifellos war er eine unvergleichliche Kostbarkeit, erbaut mit nur einem Hauch von Mörtel zwischen den Steinen, deren jeder der Krümmung des Turmes folgte und von den Maurern des Mittelalters mit größter Präzision eingefügt worden war. Natürlich war es ein katholischer Friedhof. Mein Vater hatte seine Anstellung nicht aufgrund seiner Konfession erhalten, sondern weil er bei jedermann in der Stadt beliebt war und die Katholiken nichts dagegen einzuwenden hatten, dass ihre Gräber von einem Presbyterianer ausgehoben wurden, solange dieser nur sympathisch war. Denn zu der Zeit herrschte zwischen den Kirchen oft besseres Einvernehmen, als wir meinen, und oft wird vergessen, dass, wie mein Vater oft betonte, die anderen von der anglikanischen Staatskirche abweichenden Bekenntnisse unter den Strafgesetzen längst verflossener Tage eben so zu leiden hatten wie das katholische. Dort, wo Freundschaft besteht, gibt es jedenfalls nur selten Schwierigkeiten mit der Konfession. Erst später wurde der Unterschied zum Abgrenzungsmerkmal. Zumindest weiß ich, dass der katholische Gemeindepfarrer, ein kleiner, forscher, flinker Mann namens Father Gaunt, der später, in meiner eigenen Geschichte, eine so große Rolle spielen sollte, falls ein kleiner Mann eine große Rolle spielen kann, ihn sehr gut leiden mochte.
Es war die Zeit kurz nach dem Ersten Weltkrieg, und in den Schützengräben der Geschichte befasst sich der Verstand vielleicht mit Merkwürdigkeiten, mit erzieherischen Verschrobenheiten wie jener, auf die er es an jenem Tag mit mir abgesehen hatte. Andernfalls könnte ich mir nicht erklären, weshalb ein erwachsener Mann sein Kind zusammen mit einem Sack voll Hämmer und Federn in die Spitze eines alten Turmes mitnehmen sollte.
Ganz Sligo – Fluss, Kirchen, Häuser – breitete sich strahlenförmig vom Fuß des Turmes aus, zumindest hatte es von der kleinen Fensteröffnung in der Spitze den Anschein. Ein vorüberfliegender Vogel hätte zwei aufgeregte Gesichter sehen können, die gleichzeitig hinaus zuspähen versuchten. Ich verlagerte mein Gewicht auf meine Zehen und stieß dabei gegen die Unterseite seines Kinns.
»Roseanne, liebstes Kind, ich hab mich heute Morgen schon rasiert, und dir mit deinem Goldschopf wird das ohnehin nicht gelingen.«
Denn es stimmte, dass ich weiches Haar hatte, das schimmerte wie Gold – wie das Gold jener Mönche. Golden wie der Glanz alter Buchkunst.
»Papa«, sagte ich, »lass endlich die Hämmer und die Federn fallen und lass uns sehen, was dabei herauskommt.«
»Ach«, sagte er, »ich bin müde vom Aufstieg, wir wollen erst unsere Blicke über Sligo wandern lassen, bevor wir unser Experiment in Angriff nehmen.«
Er hatte abgewartet und einen windstillen Tag für sein Vorhaben ausgewählt. Er wollte mir die uralte Prämisse beweisen, dass im Reich der Theorie alle Körper dieselbe Fallgeschwindigkeit haben.
»Alle Körper fallen gleich schnell«, hatte er gesagt, »im Reich der Theorie. Und ich werde es dir beweisen. Ich werde es mir selbst beweisen.«
Wir hatten vor dem knisternden Kohlenfeuer gesessen.
»Alle Körper mögen gleich schnell fallen, wie du sagst«, meldete sich meine Mutter aus ihrer Ecke des Zimmers zu Wort. »Aber nur selten steigt einer auf.«
Ich glaube nicht, dass dies eine Stichelei war, eher eine Feststellung. Jedenfalls blickte er mit jener vollkommenen Gemütsruhe zu ihr hinüber, die sie selbst so meisterlich beherrschte und die sie ihn gelehrt hatte.
Es kommt mir seltsam vor, dies alles hier in diesem dunkel gewordenen Zimmer aufzuschreiben, es mit blauer Kugelschreibertinte hinzukritzeln, die beiden vor meinem geistigen Auge oder irgendwo hinter den Augen, in der verdüsterten Schale meines Schädels, zu sehen, noch immer präsent, wahrhaft lebendig und gesprächig, als sei ihre Zeit die wahre Zeit und meine nur eine Illusion. Und zum tausendsten Mal rührt es mein Herz, zu sehen, wie schön sie ist, wie geschmackvoll, wie liebenswürdig und leuchtend, mit ihrem Southamptoner Akzent, der den Kieseln am Strand gleicht, wenn die Wellen sie hin und her rollen, ein weiches Rascheln und Rauschen, das in meinen Träumen nachklingt. Allerdings stimmt es auch, dass sie mich, wenn ich ungezogen war, wenn sie Sorge hatte, mein Pfad könnte von dem Pfad abweichen, den sie für mich ausersehen hatte, zu verprügeln pflegte, selbst bei nichtigen Anlässen. Aber damals war es eine Selbstverständlichkeit, Kinder zu schlagen.
Jetzt also rangelten unsere beiden Gesichter um den besten Platz, eingerahmt von dem alten Rahmen des kleinen Guckfensters der Mönche. Welche längst verschwundenen Gesichter hatten dort hinausgespäht, welche unter ihren Kapuzen schwitzenden Mönche hatten zu erkennen versucht, wo die Wikingerhorden waren, die kommen würden, sie zu morden und ihnen ihre Bücher, ihre Gefäße und ihre Münzen zu rauben? Kein Maurer überlässt den Wikingern gern ein großes Fenster, und jenes Fenster zeugte noch immer von alter Angst und Gefahr.
Nach einiger Zeit war klar, dass sich sein Experiment unmöglich durchführen ließ, solange wir alle beide dort standen. Einer von uns würde das Ergebnis verpassen. So schickte er mich allein über die feuchte steinerne Treppe nach unten, und noch heute kann ich das nasse Gemäuer unter meiner Hand spüren und das seltsame Entsetzen, von ihm getrennt zu sein, das mich erfasste. In meiner kleinen Brust schlug es so heftig, als sei eine furchtsame Taube darin gefangen.
Ich trat aus dem Turm und stellte mich, wie er mir aus Angst, die herabfallenden Hämmer könnten mich erschlagen, befohlen hatte, ein Stück vom Sockel entfernt auf. Von unten wirkte der Turm riesig, an jenem Tag schien er bis zu den schmutzig grauen Wolken aufzuragen. Bis in den Himmel. Kein Lüftchen regte sich. Die verwilderten Gräber dieses Friedhofsabschnitts, die Gräber von Männern und Frauen eines Jahrhunderts, als die Menschen sich nur unbehauene Steine leisten konnten, auf denen kein Name geschrieben stand, wirkten nun anders, da ich allein war, ganz anders, so als könnten sich die armen Gerippe gegen mich erheben und mich in ihrem ewigen Hunger verschlingen. Als ich so auf dem Rasen stand, fühlte ich mich wie ein Kind auf einer Felsenklippe, wie in jener Szene aus dem alten Stück König Lear, in der der Freund des Königs sich einbildet, von einem Felsvorsprung hinabzustürzen, obwohl dort gar kein Felsvorsprung ist. Wenn man es liest, glaubt man selbst daran, dass es einen solchen Felsvorsprung gibt, und stürzt zusammen mit dem Freund des Königs hinab. Aber pflichtgetreu, pflichtgetreu, liebevoll, liebevoll schaute ich hinauf. Es ist kein Verbrechen, den eigenen Vater zu lieben, es ist kein Verbrechen, keine Kritik an ihm üben zu wollen – und immerhin kannte ich ihn bis in die Anfangsjahre meines Frauseins, oder doch fast, in jenen Jahren also, wenn ein Mädchen dazu neigt, von seinen Eltern enttäuscht zu sein. Es ist kein Verbrechen, zu spüren, wie das eigene Herz ihm entgegenschlägt, oder doch dem biss chen, das ich von ihm sehen konnte, denn jetzt ragte sein Arm aus der kleinen Fensteröffnung, und der Sack hing in der irischen Luft. Jetzt rief er mir etwas zu, und ich konnte seine Worte kaum verstehen. Doch nach ein paar Anläufen glaubte ich ihn sagen zu hören:
»Hältst du auch genügend Abstand, liebstes Kind?«
»Ich halte genügend Abstand, Papa«, rief ich, ich schrie es fast, so weit mussten meine Worte nach oben steigen, und so klein war das Fenster, durch das sie hindurch mussten, um an seine Ohren zu dringen.
»Dann lass ich den Sack jetzt los. Pass auf, pass auf!«, rief er.
»Ja, Papa, ich passe auf!«
So gut er konnte, lockerte er mit den Fingern einer Hand die Öffnung des Sacks und schüttete den Inhalt aus. Ich hatte gesehen, was er hineingetan hatte. Eine Handvoll Federn aus dem Federkissen ihres Bettes, die er gegen den kreischenden Einspruch seiner Frau herausgerupft hatte, und zwei Maurerhämmer, die er verwahrte, um die Mäuerchen und Grabsteine der Gräber instand zu setzen.
Unverwandt starrte ich hinauf. Vielleicht hörte ich ja eine wundersame Musik. Das Kja-kja der Dohlen und das Rrrah-rrrah der Saatkrähen in den großen Buchen dort vereinte sich in meinem Kopf zu einer Melodie. Ich verrenkte mir den Hals, so gespannt war ich, das Ergebnis dieses eleganten Experiments zu beobachten, ein Ergebnis, das mir meinem Vater zufolge im Leben noch gute Dienste erweisen würde: als Grundlage einer eigenständigen Philosophie.
Obwohl nicht der leiseste Windhauch ging, schwebten die Federn sogleich davon, verstreuten sich wie bei einer kleinen Explosion, stoben sogar grau zu den grauen Wolken auf und waren fast nicht mehr zu sehen. Die Federn schwebten, schwebten davon.
Vom Turm rief mein Vater, rief in hellster Aufregung: »Was siehst du, was siehst du?«
Was sah ich, was wusste ich? Manchmal glaube ich, es ist der Hang zur Lächerlichkeit bei einem Menschen, zu einer womöglich aus Verzweiflung geborenen Lächerlichkeit, wie sie auch Eneas McNulty – noch wissen Sie nicht, wer das ist – so viele Jahre später an den Tag legen sollte, der einen mit Liebe zu diesem Menschen geradezu durchbohrt. Das alles: nicht wissen, nicht sehen, ist Liebe. Für immer stehe ich dort, verrenke mir den Hals, um zu sehen, spähe und recke meinen steifen Nacken, und sei es aus keinem anderen Grund als aus Liebe zu ihm. Die Federn schweben davon, schweben und wirbeln davon. Mein Vater ruft und ruft. Mein Herz schlägt ihm entgegen. Die Hämmer fallen noch immer.
DRITTES KAPITEL
Liebe Leserin, lieber Leser! Wenn Sie sanft- und gutmütig sind, wünschte ich, ich könnte Ihnen die Hand drücken. Ich wünsche mir – allerlei Unmögliches. Doch auch wenn ich Sie nicht um mich habe, so habe ich doch andere Dinge. Es gibt Augenblicke, da ich von einer unerklärlichen Freude durchdrungen bin, als besäße ich, indem ich gar nichts besitze, die ganze Welt. Als hätte ich, indem ich bis in diesen Raum vorgedrungen bin, das Vorzimmer zum Paradies gefunden, und bald wird es sich mir öffnen, und ich werde ins Paradies eingehen wie eine Frau, die für ihre Schmerzen entschädigt wird, eingehen in diese grünen Wiesen und hingeschmiegten Gehöfte. So grün, dass das Gras geradezu leuchtet!
Heute Morgen kam Dr. Grene herein, und hastig musste ich meine Blätter zusammenraffen und verstecken. Denn ich wollte nicht, dass er sie sieht oder mich ausfragt, denn dies hier enthält bereits Geheimnisse, und meine Geheimnisse sind mein Glück und mein Heil. Gottlob hörte ich ihn schon von weitem den Gang entlangkommen, denn er hat Eisenbeschläge unter den Absätzen. Gottlob leide ich auch kein bisschen an Rheumatismus oder sonst irgendeinem Gebrechen, das mit meinem Alter zu tun hat, zumindest nicht in den Beinen. Meine Hände, meine Hände sind leider nicht mehr, was sie mal waren, aber die Beine halten sich wacker. Die Mäuse, die hinter der Scheuerleiste entlanghuschen, sind zwar schneller, aber das waren sie schließlich schon immer. Eine Maus ist eine fantastische Athletin, wenn’s drauf ankommt, da gibt’s kein Vertun. Aber bei Dr. Grene war ich schnell genug.
Er klopfte an, was schon mal ein Fortschritt ist gegenüber dem armen Teufel, der mein Zimmer putzt, John Kane, falls sein Name so geschrieben wird – ich schreibe ihn zum ersten Mal auf –, und als er die Tür endlich öffnete, saß ich an einem leeren Tisch.
Da ich Dr. Grene nicht für einen schlechten Menschen halte, lächelte ich.
Es war ein Morgen von beträchtlicher Kälte, und auf alles im Zimmer hatte sich ein Frostschleier gelegt. Alles schimmerte. Ich selbst hatte mich in meine vier Kleider gemummt, und mir war mollig warm.
»Hmm, hmm«, sagte er. »Roseanne. Hmm. Wie geht es Ihnen denn so, Mrs McNulty?«
»Mir geht es sehr gut, Dr. Grene«, sagte ich. »Das ist aber freundlich von Ihnen, mich zu besuchen.«
»Es ist meine Pflicht, Sie zu besuchen«, entgegnete er. »Ist das Zimmer heute schon geputzt worden?«
»Nein«, antwortete ich. »Aber John wird bestimmt bald hier sein.«
»Das nehme ich auch an«, sagte Dr. Grene.
Dann durchquerte er das Zimmer und sah aus dem Fens ter.
»Heute ist der bislang kälteste Tag des Jahres«, sagte er.
»Bislang«, sagte ich.
»Und haben Sie alles, was Sie brauchen?«
»Im Großen und Ganzen ja«, antwortete ich.
Dann setzte er sich auf mein Bett, als sei es das reinlichste Bett der Christenheit, was ich zu bezweifeln wage, streckte die Beine aus und betrachtete seine Schuhe. Sein langer, ergrauender Bart war scharf wie eine Eisenaxt. Gestutzt wie eine Hecke. Der Bart eines Heiligen. Neben ihm auf dem Bett stand ein Teller, auf dem sich noch die verschmierten Überreste der Bohnen vom Vorabend befanden.
»Pythagoras«, sagte er, »glaubte an die Seelenwanderung und hat uns den Genuss von Bohnen untersagt, damit wir nicht die Seele unserer Großmutter verspeisen.«
»Oh«, machte ich.
»Das kann man bei Horaz nachlesen«, sagte er.
»Gebackene Bohnen von Batchelor?«
»Vermutlich nicht.«
Dr. Grene beantwortete meine Frage mit gewohnt ernster Miene. Das Schöne an Dr. Grene ist, dass er überhaupt keinen Sinn für Humor hat, was ihn fast schon wieder humorvoll wirken lässt. Glauben Sie mir, an einem Ort wie diesem ist das eine schätzenswerte Eigenschaft.
»Also«, sagte er, »Ihnen geht es so weit ganz gut?«
»Ja.«
»Wie alt sind Sie inzwischen, Roseanne?«
»Hundert, glaube ich.«
»Finden Sie es nicht bemerkenswert, dass es Ihnen mit hundert noch so gut geht?«, fragte er, als hätte er zu diesem Umstand irgendwie beigetragen, was er ja vielleicht auch hat. Immerhin bin ich schon seit rund dreißig Jahren, vielleicht noch länger, in seiner Obhut. Dabei ist er selbst alt geworden, wenn auch nicht so alt wie ich.
»Ich finde es äußerst bemerkenswert. Aber, Herr Doktor, ich finde so viele Dinge bemerkenswert. Ich finde Mäuse bemerkenswert, ich finde die seltsamen grünen Sonnenstrahlen bemerkenswert, die durchs Fenster herein klettern. Auch Ihren heutigen Besuch finde ich bemerkenswert.«
»Es tut mir leid zu hören, dass Sie noch immer Mäuse haben.«
»Hier wird es immer Mäuse geben.«
»Aber stellt John denn keine Fallen auf?«
»Das schon, aber er spannt die Sprungfedern nicht richtig, und die Mäuse können den Käse problemlos fressen und entwischen wie Jesse James und sein Bruder Frank.«
Jetzt nahm Dr. Grene seine Augenbrauen zwischen zwei Finger seiner rechten Hand und massierte sie eine Weile. Danach rieb er sich die Nase und stöhnte. Das Stöhnen enthielt all die Jahre, die er in dieser Anstalt verbracht hatte, all die Vormittage seines Lebens hier, all das sinnlose Geschwätz über Mäuse, Behandlungsmethoden und Alter.
»Wissen Sie, Roseanne«, sagte er, »da ich mich unlängst mit der rechtlichen Position aller unserer Insassen befassen musste, von der in der Öffentlichkeit so viel die Rede ist, habe ich mir noch einmal Ihre Aufnahmepapiere angeschaut, und ich muss gestehen –«
All dies sagte er in denkbar gelassenem Tonfall.
»Gestehen?«, fragte ich, um ihn zu ermuntern. Ich wusste, dass er dazu neigte, zu verstummen und privaten Gedanken nachzuhängen.
»O ja – entschuldigen Sie. Hmm, ja, ich wollte Sie fragen, Roseanne, ob Sie sich vielleicht noch an die näheren Umstände Ihrer Aufnahme hier erinnern können. Das wäre sehr hilfreich – wenn Sie es könnten. Den Grund nenne ich Ihnen gleich – wenn es denn sein muss.«
Dr. Grene lächelte, und ich hatte den Verdacht, dass die letzte Bemerkung scherzhaft gemeint war, auch wenn ich nicht verstand, was daran komisch sein sollte, zumal er sich normalerweise, wie gesagt, nie an Humor versuchte. Insofern vermutete ich, dass etwas Ungewöhnliches in ihm vorging.
Aber dann, fast so schlimm wie er, vergaß ich, ihm zu antworten.
»Können Sie sich an irgendetwas davon erinnern?«
»Sie meinen meine Ankunft, Dr. Grene?«
»Ja, ich glaube, die meine ich.«
»Nein«, sagte ich, denn eine entschiedene, eine unverfrorene Lüge war die beste Antwort.
»Nun«, sagte er, »leider ist ein Großteil unseres Archivs im Keller von Generationen von Mäusen als Bettstatt benutzt worden, ist ja auch kein Wunder, und nun ist alles ziemlich ruiniert und unlesbar. Über Ihre ohnehin schon schmale Akte sind sie auf höchst bemerkenswerte Weise hergefallen. Sie würde einem ägyptischen Grabmal alle Ehre machen. Bei der leisesten Berührung droht sie zu zerfallen.«
Danach herrschte langes Schweigen. Ich lächelte und lächelte. Ich versuchte mir vorzustellen, wie ich in seinen Augen wohl aussah. Ein Gesicht, so zerknittert und alt, so altersversunken.
»Natürlich kenne ich Sie sehr gut. Im Lauf der Jahre haben wir uns ja oft genug unterhalten. Ich wünschte, ich hätte mir mehr Notizen gemacht. Es sind nur wenige Seiten, was Sie nicht überraschen dürfte. Etwas in mir sträubt sich dagegen, mir viele Notizen zu machen, was in meinem Metier vielleicht nicht eben nachahmenswert ist. Manchmal heißt es, wir bewirken nichts, für niemanden. Aber ich hoffe doch, dass wir unser Bestes für Sie getan haben, trotz meines sträflichen Mangels an Notizen. Ich hoffe es wirklich. Ich freue mich, dass Sie sagen, es gehe Ihnen gut. Mir würde der Gedanke gefallen, dass Sie hier glücklich sind.«
Ich beschenkte ihn mit meinem ältesten Altfrauenlächeln, als verstünde ich nicht recht.
»Weiß Gott«, sagte er dann mit einer gewissen geistigen Eleganz, »niemand könnte hier glücklich sein.«
»Ich bin glücklich«, erwiderte ich.
»Wissen Sie«, sagte er, »ich glaube Ihnen. Ich glaube, Sie sind der glücklichste Mensch, den ich kenne. Aber ich fürchte, ich werde Ihren Fall neu bewerten müssen, Roseanne, da es in den Zeitungen einen Aufschrei der Entrüstung gegeben hat über – darüber, dass Leute, die eher aus sozialen als aus medizinischen Gründen eingesperrt wurden, weiterhin, weiterhin –«
»Festgehalten werden?«
»Ja, ja, festgehalten werden. Und zwar bis auf den heutigen Tag festgehalten werden. Natürlich sind Sie seit vielen, vielen Jahren hier, ich vermute fast, es sind vielleicht schon fünfzig?«
»Ich weiß es nicht mehr, Dr. Grene. Mag wohl sein.«
»Möglicherweise betrachten Sie diese Anstalt ja auch als Ihr Zuhause.«
»Nein.«
»Nun, wie jeder andere haben Sie das Recht, frei zu sein, wenn Sie für … für die Freiheit taugen. Ich vermute, selbst mit einhundert Jahren möchten Sie vielleicht … möchten Sie vielleicht umherspazieren und im Sommer im Meer baden und die Rosen riechen –«
»Nein!«
Eigentlich wollte ich gar nicht schreien, aber wie Sie merken werden, ist der bloße Gedanke an derlei kleine Aktivitäten, die die meisten Menschen mit Behagen und Lebensglück verbinden, noch immer ein Messer in meinem Herzen.
»Verzeihung?«
»Nein, nein, bitte fahren Sie fort.«
»Wie auch immer, falls ich feststellen sollte, dass Sie ohne wirklichen Grund, sozusagen ohne medizinische Grundlage hier sind, müsste ich mich um eine andere Regelung bemühen. Ich möchte Sie nicht beunruhigen. Und ich habe nicht die Absicht, meine liebe Roseanne, Sie in die Kälte hinauszuschicken. Nein, nein, dies wäre eine sorgfältig abgestimmte Maßnahme und bedarf, wie gesagt, meiner vorherigen Neubewertung. Fragen, ich würde Sie befragen müssen – bis zu einem gewissen Grad.«
Ich war mir ihres Ursprungs nicht ganz sicher, aber in mir breitete sich ein Gefühl der Angst aus, so wie ich mir vorstelle, dass sich das Gift gespaltener Atome in den Menschen der Außenbezirke von Hiroshima ausgebreitet und sie ebenso sicher getötet hat wie die Explosion selbst. Angst wie eine Krankheit, die Erinnerung an eine Krankheit, zum ersten Mal seit vielen Jahren verspürte ich sie.
»Fehlt Ihnen etwas, Roseanne? Bitte regen Sie sich nicht auf.«
»Natürlich will ich meine Freiheit, Dr. Grene. Aber sie ängstigt mich auch.«
»Der Gewinn der Freiheit«, sagte Dr. Grene freundlich, »vollzieht sich stets in einer Atmosphäre der Ungewissheit. Wenigstens in diesem Land. Vielleicht in allen Ländern.«
»Mord«, sagte ich.
»Ja, manchmal«, sagte er sanft.
Dann schwiegen wir, und ich betrachtete das solide Rechteck aus Sonnenlicht im Zimmer. Dort hatte sich uralter Staub abgesetzt.